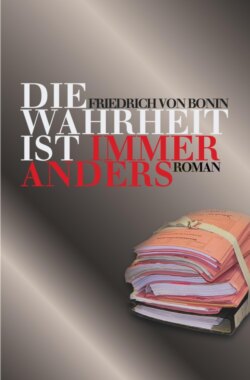Читать книгу Die Wahrheit ist immer anders - Friedrich von Bonin - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление7.
Eduard Eschenburg versuchte, sich zu konzentrieren, es gelang ihm nicht. Immer wieder schoben sich die Bilder von dem blutenden stolpernden alten Juden vor die Akten und er erkannte, heute würde er nicht mehr arbeiten können. Er packte daher seine Sachen zusammen, meldete sich bei seiner Sekretärin ab und fuhr nach Hause.
Anheimelnd sah die Villa Eschenburg aus, die Fenster im warmen Licht bei der beginnenden Winterdämmerung. Das Erdgeschoss war erleuchtet, Eduard Eschenburg war erleichtert, seine Frau war offensichtlich zu Hause, ihn würde die warme Stimmung seines Heims umfangen, wenn er die Tür öffnete, er konnte die widerlichen Eindrücke des Nachmittags vergessen. Er ging durch die Gartentür, durch den Vorgarten, in dem Andrea ihre geliebten Rosen mit Nadelholzästen und Stroh vor dem Winterfrost geschützt hatte und öffnete die Haustür.
Andrea, die ihm entgegenkam, sah sofort, dass etwas geschehen war.
„Eduard, wieso kommst du so früh? Was ist passiert?“
„Horden der SS haben Aaron Liebermanns Laden geplündert, zerstört und ihn selbst schlimm zugerichtet.“
„Aber Eduard, warum macht dir das so viel aus? Irgendwann müssen doch die Juden zurückgedrängt werden, sonst machen sie doch unseren Staat kaputt, das weißt du doch.“
Andrea hatte nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten sehr schnell deren Behauptung übernommen, die Juden seien schädlich für das Reich und die Menschheit und Eduard hatte nie gewagt, ihr darin zu widersprechen.
„Ich weiß, aber du hast das nicht mit angesehen, es waren lauter junge Leute, brutale Männer, die keine Skrupel hatten, den alten Juden mit Stockschlägen zu malträtieren, das musste doch nun wirklich nicht sein.“
„Eduard, sei vorsichtig, was du sagst, du weißt, heute Abend kommt Alfons Hellmann mit Agnes. Wenn der hört, dass du den Juden verteidigst, ist möglicherweise die Freundschaft in Gefahr und du weißt, wie wichtig er für deinen Posten ist.“
Eduard Eschenburg sah Andrea verliebt an. Sie war auch jetzt noch mit ihren neununddreißig Jahren eine schöne Frau. Schlank und aufrecht ging sie, sie war ebenso groß wie ihr Mann, mit ihrem schmalen Gesicht, den schwarzen Haaren, die das Gesicht umflossen, mit der hohen Stirn, auf der die ersten Querfalten zu sehen waren und mit den dunkelbraunen, weit auseinander stehenden Augen. Ihre Augen waren es, die Eduard von Anfang an angezogen hatten, vor dreizehn Jahren, als sie noch Studenten waren. Und Eduard liebte sie immer noch, immer noch dieses schöne Gesicht und ihre unaufgeregte Klugheit, die sie auch jetzt wieder bewies. Und sie hatte ja recht: Das Wohlwollen des Gruppenführers der SS war für sie wichtig, die Behörden wussten, dass Eschenburg erst sehr spät der Partei beigetreten war und betrachteten ihn und seine Familie mit Misstrauen. War dieser Mann wirklich geeignet, das hohe Amt des Finanzstadtrates weiter auszuüben, war er auf ihrer politischen Linie, widersprach er nicht zu oft?
Und dann misstrauten sie auch nicht nur Eduard Eschenburg persönlich, sondern seiner Herkunft aus einer großbürgerlichen Familie in der Stadt. Die Villa, in der sie wohnten und an der sie sehr hingen, war die nicht etwas zu groß? Sie hatten die Familie auf Herz und Nieren geprüft, auf ihre Vorfahren, hatten aber nichts als arische Abstammung feststellen können.
Alfons Hellmann war zwar ebenso wie Eschenburg der Partei spät beigetreten, auch er hatte eine großbürgerliche Vergangenheit. Hellmann hatte allerdings viel schneller und radikaler als Eschenburg die Diktion und die Ideologie der Partei übernommen, so dass an seiner Treue nie Zweifel aufkamen. Er hatte sehr schnell eine steile Karriere in der SS gemacht.
Und dabei hatte Alfons Hellmann ihnen immer beigestanden, hatte geholfen, ihre Abstammungspapiere zu besorgen und an der richtigen Stelle abzuliefern.
Heute Abend allerdings sah Eschenburg dem Besuch des Generals der SS mit gemischten Gefühlen entgegen, er war nicht sicher, ob er über das, was er erlebt hatte, würde schweigen können.
Alfons Hellmann war immer noch ein großer Mann von jetzt Anfang vierzig, dessen ursprünglich schlanke militärisch straffe Figur anfing, auseinanderzugehen. Seinen Bauchansatz konnte auch die eng geschnittene schwarze Uniform, die er trug, nicht verbergen, ein leichtes Doppelkinn weichte den klaren rechteckigen Schnitt des Gesichtes auf. Die Stimme allerdings war frisch und sympathisch wie eh und je.
„Eschenburg, junger Mann, wirst du vielleicht immer kleiner?“ begrüßte er Eschenburg, den er um fast eine Kopflänge überragte.
„Klar, und zwar so viel kleiner, wie du immer größer wirst“, lachte Eschenburg zurück. Das war ihre Art, sich zu begrüßen, Hellmann hatte sich angewöhnt, Eschenburg als „junger Mann“ zu bezeichnen, obwohl beide etwa gleich alt waren.
Sie gingen gemeinsam zu Tisch, Agnes Hellmann mit Andrea und Eduard mit Alfons Hellmann plaudernd, scherzend, so wie immer. Sie aßen.
„Eschenburg, mein Lieber, du bist heute so still, was ist los?“ wunderte sich auf einmal Hellmann. In der Tat hatte sich Eduard gegen seine sonstige Gewohnheit am Gespräch kaum beteiligt, hatte seiner Frau das Wort überlassen. Auf die Frage Hellmanns setzte er an, sah aber den warnenden Blick seiner Frau.
„Nein“, sagte er trotzig, „vielmehr doch, es geht mir heute nicht sehr gut.“ Und er berichtete von den Geschehnissen, die er auf dem Marktplatz beobachtet hatte.
Hellmann sah ihn scharf an.
„Und das hat unserem Eschenburg nicht gefallen, was er da gesehen hat?“ fragte er bitter. „Ja, Eschenburg, das ist nun so: wir müssen unser deutsches Volk sauber halten, das ist kein Spaß, und nicht immer bedienen wir uns dabei der edelsten Elemente. Ich weiß wohl, dass wir manche Rabauken in unseren Reihen haben, aber die brauchen wir nun mal. Stell dir vor, wir hätten lauter kleine sensible Eschenburgs, wer sollte dann die Reinigungsarbeiten vornehmen?“
Eschenburg fuhr auf. Das klinge ja, als wenn man eine Wohnung putze. Man könne doch Deutschland wohl auch von unliebsamen Elementen entfernen ohne solche Randalierereien.
„Da spricht der Bürger“, nickte Hellmann. „Ich will dir mal was sagen, Eschenburg. Dein Vater war Bauunternehmer, der hatte das Ohr noch am Volk, der wusste noch, wie man aufräumt. Aber du, du bist schon vollkommen verbürgert. Aber pass nur auf, dass du diese Gedanken niemals außerhalb dieses Kreises äußerst, es könnte dir schlecht bekommen, und dann kann ich dich nicht mehr beschützen. Und nun lass uns über Erfreulicheres reden.“
Eduard Eschenburg begnügte sich damit, vor allem, weil seine Frau ihn weiter bestürzt ansah: Noch nie hatte er sich so weit vorgewagt, er brachte nicht nur sich in Gefahr, auch sie und sein Amt als Finanzstadtrat.
Langsam beruhigte er sich. Er hatte im Krieg Schlimmeres gesehen als den blutüberströmten Juden, er war selbst kriminell gewesen, erinnerte er sich.