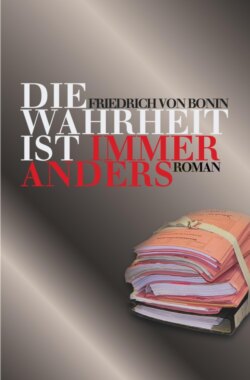Читать книгу Die Wahrheit ist immer anders - Friedrich von Bonin - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление5.
Am nächsten Tag fuhr ich zur gewohnten Zeit in mein Büro, allerdings ohne das Frühstück, das die Familie üblicherweise gemeinsam einnahm. In der Nacht hatte es nun doch zu tauen begonnen, endlich waren nach zwei Wochen die Temperaturen über den Gefrierpunkt gestiegen. Als ich aus dem Haus trat, war es noch dunkel, ich konnte das eigenartige Geräusch hören, das entsteht, wenn Schnee taut: Überall rieselte es, Feuchtigkeit lag in der Luft, dem Schnee war hier, in dem Vorgarten unserer Villa, noch keine Veränderung anzusehen, strahlend weiß spiegelte er das Licht der Außenlaterne zurück. Ich fuhr aus der Vorstadt in das Zentrum, den vertrauten Weg entlang, erst aus dem Viertel, in dem ich wohnte, auf die vierspurige Ausfallstraße, die sich verbreiterte auf erst sechs, dann acht Spuren, immer Richtung Zentrum, die Stadt wurde dichter, die Häuser höher, der Verkehr aufreibender, bis ich in der Straße anlangte, in der mein Büro lag und in die Tiefgarage einfuhr, in der meine Gesellschaft einen Platz für mein Fahrzeug gemietet hatte. Je weiter ich mich dem Zentrum näherte, desto grauer und schmutziger wurde der Schnee, von den Räumfahrzeugen an die Seite geschoben und dort mit dem Dreck der vorbeifahrenden Fahrzeuge in schmutziges Grau verwandelt. Ich betrat die Räume meines Büros.
„Herr Eschenburg, gut, dass Sie kommen“, Frau Seibold, meine Sekretärin, stand hinter ihrem Schreibtisch auf und kam mir entgegen, „ich habe mir schon Sorgen gemacht, wie es Ihnen geht. Wie war es denn bei Dr. Dragon? Soll ich Ihnen erst einmal einen Kaffee machen?“
Nach der spöttischen Behandlung, die ich zu Hause erfahren hatte, tat mir der mitfühlende Ton in meinem Büro gut.
„Danke, Frau Seibold, es geht mir gut, aber einen Kaffee könnte ich jetzt brauchen, vielleicht können Sie organisieren, dass mir ein Croissant besorgt wird, ich habe wenig gefrühstückt heute Morgen. Und dann wäre es nett, wenn Sie mir Telefongespräche vom Halse halten könnten, jedenfalls bis Mittag.“
„Gerne, aber Herr Randemann hat angerufen, er möchte Sie dringend sprechen, ob Sie ihn zurückrufen könnten, hat er gefragt.“
Ich seufzte. Herr Randemann war Staatssekretär im Finanzministerium, ich musste dringend mit ihm sprechen, klar, es galt, Entscheidungen zu treffen über unsere Haltung zur neuen Unternehmenssteuer. Natürlich hatten wir uns dagegen ausgesprochen, aber ganz zu verhindern würde sie wohl nicht sein. Es galt nun auszuhandeln, was genau eine solche Steuer für uns bedeutete, für die in meiner Gesellschaft zusammengefassten Betriebe, Banken und Industrieunternehmen. Aber waren nicht unsere Anwälte seit langem in das Verfahren eingebunden? Was sollte ich dabei?
Aber ich machte mir etwas vor. Wir mussten Vorschläge machen, und die mussten von uns, das heißt von mir, kommen, nicht von unseren Anwälten. Seit vier Wochen hielten wir im Gesellschafterkreise Marathonsitzungen ab, um unseren Kurs festzulegen, erst vor zwei Tagen hatte ich meine Verhaltensmaßregeln bekommen.
Ich schloss die Augen. „Herr Randemann wird mindestens warten müssen, bis ich meinen Mantel ausgezogen und mich aufgewärmt habe, aber gut, wenn er noch einmal anruft, sagen Sie ihm, dass ich mich heute Nachmittag bei ihm melden werde.“
Damit ging ich in mein Büro und schloss die Tür hinter mir, gestört nur noch einmal, als unsere Auszubildende Kaffee und Croissants brachte.
Ich atmete auf, als ich den dampfenden Kaffee und das Gebäck vor mir auf dem Schreibtisch stehen hatte. Mein Büro war konservativ elegant eingerichtet, solide, auch kostspielig, so reich, wie es die von meinen Gesellschaftern für die Einrichtung gesetzten Grenzen erlaubt hatten, Grenzen, die zugegebenermaßen großzügig bemessen waren.
Mein Schreibtisch war ein alter solider schwerer Eichentisch, mit einer mächtigen Platte, zwei stabilen Seitenteilen und einem kompakten Balken, der knapp über dem Boden die Seitenteile verband. Ich benutzte ihn gern, um dort meine Füße abzustützen. Der Schreibtisch enthielt keinerlei Container, alles, was ich zum Arbeiten brauchte, war offen abgelegt.
Der Tisch stand vor den bodentiefen Fenstern, auf der den Fenstern gegenüberliegenden Seite hatte ich eine Besprechungsecke eingerichtet, mit einem ebenfalls aus Eiche bestehenden Tisch und sechs bequem gepolsterten Ledersesseln darum.
Den alten Parkettfußboden hatte ich aufarbeiten lassen und nur in die Nähe des Schreibtisches einen alten Perserteppich aus prächtigen Farben gelegt, den ich auf einer Reise nach Nordafrika erstanden hatte.
Der Raum war wohlig warm geheizt, und dennoch fröstelte ich plötzlich.
Hier war es gewesen, in diesem Büro, ich hatte gerade Besuch von einem Gesellschafter meines Arbeitgebers, Herrn Ratenberg, als es unvermittelt hart und knöchern an meine Tür klopfte. Ich war sofort alarmiert, Frau Seibold, meine Sekretärin, kam nie herein, wenn ich Besuch hatte, und wenn schon, klopfte sie nie an. Ich hatte mich im Schreck halb erhoben, als die Tür auch schon geöffnet wurde, ehe ich noch mein Herein sagen konnte. Es trat ein hagerer Herr in etwa meinem Alter, begleitet von zwei jüngeren Männern, ein.
„Guten Tag, Pagelsdorf ist mein Name, ich bin Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht in Königsfeld. Herr Eschenburg?“ Die Stimme des Staatsanwaltes klang schnarrend, militärisch, als ob er jeden menschlichen Zug vermeiden wollte. Ich nickte nur, er fuhr schon fort.
„Herr Eschenburg, ich habe hier eine richterliche Verfügung, aufgrund derer ich mit meinen Begleitern, den Kommissaren Hüne und Meinert, Ihre Büroräume zu durchsuchen gezwungen bin. Bitte machen Sie uns keine Schwierigkeiten.“
Ich hatte mich ganz erhoben, um eine Begrüßung auszusprechen, sank aber angesichts dieser Worte auf meinen Stuhl zurück, die Knie wurden mir schwach.
„Was wirft man mir denn vor?“ fragte ich lau.
„Hier ist die Durchschrift des Durchsuchungsbeschlusses, bitte lesen Sie, daraus können Sie den Vorwurf sehen. Wer sind Sie?“ unterbrach er sich und wandte sich an meinen Besucher.
„Mein Name ist Ratenberg, ich besuche Herrn Eschenburg, wir sind aber gerade fertig geworden. Herr Eschenburg, ich lasse sie dann jetzt allein, oder?“
„Herr Ratenberg, in welcher Beziehung stehen Sie zu Herrn Eschenburg, ich weiß nicht, ob ich Sie so ohne weiteres gehen lassen kann.“
Damit kam der Staatsanwalt bei meinem Besucher allerdings schlecht an.
„Was sagen Sie? Ob Sie mich gehen lassen können?“ Mit scharfer Stimme, die ich aus Auseinandersetzungen der Gesellschafter kannte, wies Ratenberg den Staatsanwalt in seine Schranken. „Die Frage ist nicht, ob Sie mich gehen lassen können, sondern, ob Sie einen Grund haben, mich in dieser Weise in Ihre Angelegenheiten einzubeziehen. Pagelsdorf war der Name? Mir scheint, den muss ich mir merken. Guten Tag.“ Mit diesem scharfen Gruß wendete sich mein Besucher ab und verließ das Büro.
Mir hatte der Ton gutgetan und mir geholfen, mich vom ersten Schrecken zu erholen.
„Geben Sie mir also bitte den Beschluss, ich werde ihn lesen und dann entscheiden, was wir tun.“
Ich nahm das Papier aus seinen Händen entgegen und begann zu lesen. Tatsächlich: Das Amtsgericht Königsfeld hatte verfügt, dass meine Büroräume durchsucht würden, weil ich im Verdacht stand, an einer nur ansatzweise beschriebenen Bestechungsaffäre beteiligt zu sein.
„Bitte, an dem Beschluss scheint alles korrekt zu sein. Ich stehe Ihnen zur Verfügung, Herr Oberstaatsanwalt. Wo wollen Sie beginnen?“ Ich hatte gelernt, nachzugeben, wenn mir nichts Anderes übrigblieb, und das hier war so ein Fall. Ich wusste, dass die meisten Menschen bei einem solchen Überfall der Staatsgewalt nach ihrem Anwalt riefen, aber was hätten unsere Anwälte jetzt tun können? Gut, sie hätten einen Vertreter in mein Büro geschickt mit der Folge, dass nicht nur ich, sondern auch mein Anwalt den Beamten beim Durchsuchen zusah. Einzig Frau Seibold musste beruhigt werden, sie war schon deshalb vollkommen aufgelöst, weil sie die Herren nicht am Betreten meines Büros hatte hindern können, und nun kramten die auch noch ihren und meinen Schreibtisch herum. Aber ich tröstete sie sehr schnell, weil ich ihr die Sache als reine Routineangelegenheit schilderte, die sich sehr bald aufklären würde.
Die Beamten waren jetzt, da sie sich meiner Kooperation sicher sahen, sogar höflich, sie durchsuchten die Räume, die Schreibtische und die Schränke in meinem Büro mit der größtmöglichen Rücksicht, wie mir Pagelsdorf versicherte.
Ich war nach dem anfänglichen Schrecken, den ein solcher Besuch bereitet, auch nicht mehr allzu sehr beunruhigt, wusste ich doch, dass von allen Unterlagen und Akten, mit denen ich in meinem Büro arbeitete, Kopien gut verwahrt im Tresor eines der Gesellschafter meiner Gesellschaft lagen, so dass meine Arbeit kaum behindert werden würde. Und kompromittierendes Material, so es denn überhaupt welches gab, hätte ich ohnehin nicht hier aufbewahrt.
Die Beamten hatten vorgesorgt, sie hatten einen rollbaren Aktentransporter mitgebracht, in den sie nach zwei Stunden Durchsuchung die beschlagnahmten Akten luden und das Büro verließen.
Das Ergebnis dieser Durchsuchung und der weiteren Ermittlungen lagen heute vor mir als Anklage auf dem Schreibtisch. Ich begann nun doch zu lesen.