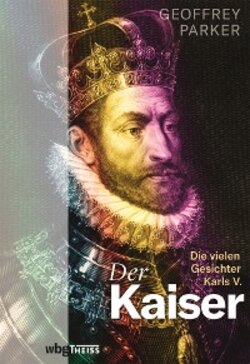Читать книгу Der Kaiser - Geoffrey Parker - Страница 7
Vorbemerkung zu Orts- und Personennamen
ОглавлениеWo zur Bezeichnung nicht deutschsprachiger Orte eine allgemein übliche deutsche Namensvariante existiert (wie etwa in den Fällen von Lissabon, Straßburg oder Venedig), wird diese im Folgenden verwendet. Einen Sonderfall bildet die Hauptstadt des Osmanischen Reiches: Wo sie in den zitierten Quellen erwähnt wird, ist gemäß dem zeitgenössischen Sprachgebrauch von »Konstantinopel« die Rede, ansonsten von »Istanbul«. Entsprechend wird bei Personen, wenn im Deutschen eine bestimmte Namensform etabliert ist (wie bei Franz I., Clemens VII. oder Don Juan de Austria), diese durchgehend verwendet. In allen anderen Fällen habe ich die Namensvariante bevorzugt, die die betreffende Person selbst verwendet hat. Ausnahmen wurden gemacht, sobald mehrere Personen denselben Namen tragen. Obwohl aus dem Zusammenhang meist eindeutig hervorgeht, wer jeweils gemeint ist, nenne ich Karls jüngste Schwester »Catalina« und die Tante der beiden »Katharina« (von Aragón). Mit »Margarete« bezeichne ich Karls Tante, Erzherzogin von Österreich und Herzoginwitwe von Savoyen, während mit »Margarita« Karls uneheliche Tochter gemeint ist, die Herzogin von Florenz und später von Parma (die in zeitgenössischen Quellen schlicht »Madama« heißt). Schreibe ich »María«, ist in der Regel Karls ältere Tochter gemeint; »Maria« hingegen bezeichnet seine Schwester, die Königin (ab 1526 Königinwitwe) von Ungarn; und »Mary« ist entweder eine Schwester oder die ältere Tochter Heinrichs VIII. von England (mit beiden war Karl – zu unterschiedlichen Zeiten – einmal verlobt).
Personen, bei denen sich die Anrede oder der Titel über die Jahre verändert hat, stellen uns vor eine besondere Herausforderung. Antoine Perrenot de Granvelle (1517–1586) trat zwischen 1540 und 1562 als Bischof von Arras auf, danach als Kardinal Granvelle; ich bezeichne ihn dennoch stets als »Perrenot«, um ihn von seinem Vater, Nicolas Perrenot de Granvelle (1486–1550), zu unterscheiden, den ich durchweg als »Granvelle« bezeichne.21 Karls Großvater Maximilian (1459–1519) hat im Lauf seines Lebens ebenfalls verschiedene Titel getragen. Er begann seine Laufbahn als Erzherzog von Österreich, wurde dann 1477 durch seine Heirat mit Maria von Burgund aber auch Herzog von Burgund. Ab 1486 durfte er sich »römischer König« nennen, ab 1508 dann »erwählter römischer Kaiser«. Ab dem Tod seines Vaters Friedrichs III. im Jahr 1493 bezeichneten die Zeitgenossen Maximilian jedoch in aller Regel schon als »den Kaiser«, und so halte auch ich es in diesem Buch. Auch Karl V. war nach seiner Krönung zum rex Romanorum erst einmal »erwählter römischer Kaiser« – also etwa »Kaiser in spe« –, bis der Papst ihm zehn Jahre später tatsächlich die Kaiserkrone aufs Haupt setzte. Schon seit 1520 nannten ihn freilich die meisten Zeitgenossen schlicht »den Kaiser«. Karl selbst verwendete in seinen verschiedenen Herrschaftsgebieten den dort jeweils üblichen Herrschertitel: In Spanien nannte er sich rey católico (»katholischer König«), ein Titel, der seinen Großeltern Ferdinand und Isabella 1496 vom Papst verliehen worden war. Auch unterzeichnete er alle Schriftstücke mit »Yo el Rey« (»Ich, der König«) – selbst dann, wenn es sich um Briefe an seine Frau oder seine Kinder handelte. Dokumente in lateinischer, deutscher oder italienischer Sprache unterschrieb er als »Carol« oder »Carolus«; französischsprachige als »Charles«. In diesem Buch wird Karl von seiner Krönung zum römisch-deutschen König im Jahr 1520 bis zur Übertragung der Kaiserwürde auf seinen Bruder Ferdinand im Jahr 1558 als »Kaiser« bezeichnet. Wo vom »Reich« die Rede ist, ist das »Heilige Römische Reich deutscher Nation« gemeint, über das Karl als Kaiser herrschte.
Zuletzt muss noch bedacht werden, dass manche Begriffe im Laufe der Geschichte ihre Bedeutung geändert haben. So war die Bedeutung des Begriffs »Protestanten« bei seinem Auftauchen 1529 zunächst eine politische. Gemeint waren diejenigen Reichsstände, die in der »Protestation zu Speyer« auf dem Reichstag von 1529 gegen die Aufhebung der drei Jahre zuvor beschlossenen Tolerierung der Lutheraner im Reich protestiert hatten. Im Jahr darauf erhielt der Begriff dann auch eine konfessionelle Dimension, als die Anhänger Martin Luthers dem Reichstag zu Augsburg ihre Confessio vorlegten. Dieses »Augsburger Bekenntnis« blieb jedoch, wie Robert Scribner angemerkt hat, während Karls gesamter Regierungszeit »eine Art von politisch-religiösem Mischwesen, eine theologische Stellungnahme, die unter politisch-diplomatischem Druck ausgearbeitet worden war, um den Erfordernissen einer politischen Situation gerecht zu werden«. Der Kaiser sprach, ohne näher zu unterscheiden, mal von jenen, »die von der wahren Kirche abgefallen sind«, dann wieder von »Protestanten« oder von »Lutheranern«. Als »Lutheraner« bezeichnete er selbst Theologen wie Heinrich Bullinger in Zürich und Martin Bucer in Straßburg, die bestimmte Aspekte der lutherischen Lehre ablehnten. In diesem Buch werden »Lutheraner« jedoch ausschließlich die Anhänger Martin Luthers genannt, während »Protestanten« all diejenigen heißen, die die Autorität des Papstes ablehnten.22