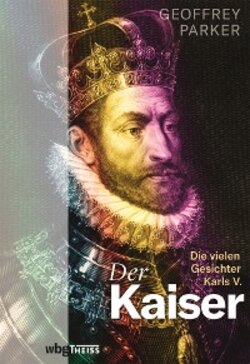Читать книгу Der Kaiser - Geoffrey Parker - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1Vom Herzog von Luxemburg zum Infanten von Kastilien (1500–1508) Der Herzog von Luxemburg
Оглавление»Wir beginnen mit seiner Abstammung«: Mit diesen Worten eröffnet Pedro Mexía seine 1548 verfasste Biografie Karls V., und im ersten Kapitel – unter der Überschrift »Von der erhabenen, vortrefflichen und unzweifelhaften Stammfolge und Herkunft dieses großen Fürsten« – führt Mexía die Vorfahren Karls aus den vergangenen tausend Jahren auf.1 Zwar hat der Autor damit Karls wichtigstes Startkapital – seine »erhabene« Familie nämlich – richtig erkannt, aber die Rückschau führte auch zu einer gewissen Übertreibung. Zur Zeit von Karls Geburt im Jahr 1500 war sein Vater, Erzherzog Philipp von Österreich, zwar der potenzielle Erbe all der Territorien, über die sein Vater Maximilian als Oberhaupt des Hauses Habsburg gebot, herrschte aber lediglich über einige niederländische Provinzen, die er von seiner Mutter, der Herzogin Maria von Burgund, geerbt hatte. Karls Mutter Johanna konnte sich ursprünglich keine vergleichbaren Hoffnungen auf ein großes Erbe machen, denn sie war nur das dritte Kind ihrer Eltern, Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragón, die beide dem spanischen Königshaus Trastámara entstammten und gemeinhin als los reyes católicos (»die Katholischen Könige«) bekannt waren – den Titel hatte ihnen ein wohlmeinender spanischer Papst verliehen.
Die drei Dynastien – Habsburg, Kastilien und Aragón – hatten eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Vor allem verfolgten sie alle eine auf Ausbau ihrer Hausmacht bedachte Heiratspolitik. So hatten über mehrere Generationen Infanten aus dem aragonesischen Zweig des Hauses Trastámara Infantinnen aus dem kastilischen Zweig geheiratet und umgekehrt. Das Ziel dieser Taktik war es, die beiden Königreiche Kastilien und Aragón zu vereinen. Auch mit dem Haus Avis, dessen Angehörige über Portugal herrschten, gingen die Trastámara Ehen ein, weil sie hofften, auf diese Weise die ganze Iberische Halbinsel unter einer Krone vereinen zu können. Die Herzöge von Burgund hatten einen solchen »Heiratsimperialismus« von Anfang an verfolgt – 1369 heiratete der erste Burgunderherzog die Erbin der Grafschaft Flandern – und gewannen den Großteil ihrer niederländischen Besitztümer auf dem Erbweg. Bei den Habsburgern wurden Ehen ebenfalls arrangiert, mit dem Ziel, weitere Territorien zu erwerben, aber auch, um die Bande zwischen den Familienzweigen zu festigen. Diese Strategie ist in einer Devise festgehalten, die erstmals nach der Heirat Maximilians von Österreich mit Maria von Burgund im Jahr 1477 populär wurde:
»Bella gerant alii; tu, felix Austria, nube
Nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus.«
»Kriege lass andere führen, du, glückliches Österreich, heirat’!
Denn was den anderen Mars, Venus, die Göttin, gibt’s dir.«2
Doch der »Heiratsimperialismus« hatte seinen Preis, denn die Reiche, die auf seiner Grundlage errichtet wurden, waren das genaue Gegenteil eines modernen Staatswesens: Oft war dynastische Loyalität das Einzige, was sie zusammenhielt, und ihre Herrscher neigten dazu, ihre Herrschaftsgebiete, ganz egal, wie weit verstreut sie lagen, als ihren persönlichen Besitz anzusehen, als ein Familienerbe, das unversehrt an die nächste Generation weitergegeben werden musste. So versicherte Karl seinem Sohn Philipp 1543, dass es sein oberstes Ziel sei, »dir kein kleineres Erbe zu hinterlassen, als ich es einst selbst empfangen habe«.3
Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den drei Dynastien war ihre Furcht vor Frankreich. Burgund hatte in den 1470er-Jahren antifranzösische Bündnisse mit Aragón geschlossen, und ein Jahrzehnt später schlug Maximilian vor, seinen einzigen Sohn mit einer spanischen Infantin zu verheiraten. Die Verhandlungen gerieten indes ins Stocken, bis der französische König Karl VIII. 1494 in Italien einmarschierte und im Triumph auf Neapel vorstieß, um seine dynastischen Ansprüche auch auf dieses Königreich geltend zu machen. Im Jahr darauf warnte Maximilian die Katholischen Könige, dass, »wenn der König von Frankreich erst einmal Neapel gewonnen hat, er auch die anderen italienischen Staaten wird besetzen wollen«. Um sie davon zu überzeugen, dass sie »sich zur Wehr setzen und den König von Frankreich angreifen« sollten, schlug Maximilian eine Doppelhochzeit vor: zwischen seiner Tochter Margarete und dem spanischen Infanten Johann (Juan) sowie zwischen seinem eigenen Erben Philipp und Johanns jüngerer Schwester Johanna. Die Verträge zu dieser Hochzeit wurden im Januar 1495 unterzeichnet, und die spanische Prinzessin traf im Oktober 1496 in Lier bei Antwerpen ein, wo das Paar die Ehe vollzog. Keiner konnte ahnen, dass ihr Sohn einmal über das größte Reich herrschen sollte, das die Welt seit einem Jahrtausend gesehen hatte (Tafel 1).4
Der zukünftige Karl V. machte sich zum ersten Mal noch aus dem Mutterleib heraus bemerkbar. Im September 1499 bestellte Philipp »eine Hebamme aus der Stadt Lille« herbei, um Johanna »zu sehen und zu besuchen«; und vier Monate später entsandte er einen Kurier »mit äußerster Geschwindigkeit, Tag und Nacht, ohne Männer noch Pferde zu schonen«, um den Abt eines Klosters bei Lille zu bitten, seine wertvollste Reliquie leihweise herauszugeben: den »Ring der Jungfrau«, den angeblich Josef seiner Braut Maria bei ihrer Heirat an den Finger gesteckt hatte. Wie es hieß, sollte er »Frauen unter der Niederkunft Trostund Hilfe spenden«. Einigen Berichten zufolge erwies der Ring sich als überaus wirksam: Johannas Wehen setzten ein, als sie gerade an einem Ball teilnahm, der im Palast der Grafen von Flandern in Gent stattfand. Sie schaffte es gerade noch in die nächste Latrine, da war der künftige Kaiser auch schon geboren. Es war der 24. Februar 1500, der Matthiastag.5 Sobald den Genter Bürgern die Nachricht von Karls Geburt zu Ohren kam, war die Freude groß, wie ein Augenzeuge berichtet, der zufällig auch der führende Dichter der Stadt war:
»Groß und Klein schrie ›Österreich‹ und ›Burgund‹
Drei Stunden lang und in der ganzen Stadt.
Alle liefen umher und riefen die frohe Nachricht aus
vom [neugeborenen] Friedensfürsten.«
Philipp gab indessen Order, dass alle größeren Städte der Niederlande »Prozessionen, Feuerwerke und öffentliche Spiele« vorbereiten sollten, um die Geburt seines Erben zu feiern. Außerdem bestellte er die Spitzen des Klerus ein, damit sie an der Taufe des Knaben teilnahmen.6 Auch sandte er einen Eilboten zu seiner Schwester Margarete, die sich gerade auf der Rückreise aus Spanien befand, und »flehte sie an, sich nur zu beeilen, damit sie das Kind bei der Taufe am Taufbecken in ihren Händen halten« und Karls Patin werden könne. Sobald Margarete eintraf, bedrängte sie ihren Bruder, seinen Sohn »Maximilian« taufen zu lassen nach ihrer beider Vater, aber Philipp entschied sich, das Kind nach seinem Großvater zu nennen, dem Burgunderherzog Karl dem Kühnen. Zugleich verlieh er dem Neugeborenen allerdings auch den Titel eines »Herzogs von Luxemburg« – eine Würde, die gleich mehreren von Maximilians Vorfahren zuteilgeworden war.7
Karls Großeltern reagierten unterschiedlich. »Als seine Großmutter, die Königin Isabella, von seiner Geburt erfuhr … gedachte sie der Worte der Schrift, dass Matthias, der Apostel Jesu, durch das Los erwählt worden war; und da sie wusste, welch große Hoffnungen an die Geburt ihres Enkelsohnes geknüpft waren, der so viele und große Königreiche und Herrschaften erben sollte, so sprach sie: ›Das glückliche Los ist auf Matthias gefallen.‹« In Deutschland erklärte Kaiser Maximilian sich »vollkommen zufrieden mit dem Namen« des Kindes »wegen der Zuneigung, die ich für meinen lieben Herrn Schwiegervater, den Herzog Karl, hege«.8 In Gent bereitete der Magistrat derweil eine Reihe von Triumphbögen vor, die jeweils eines der Reiche darstellen sollten, die das Kind, so es denn überleben sollte, von seinem Vater und Großvater erben würde. Andere Triumphbögen repräsentierten die Tugenden Weisheit, Gerechtigkeit und Friedfertigkeit. Am Abend des 7. März 1500 begleitete eine lange Prozession den Säugling über einen eigens errichteten Laufsteg vom Palast zur örtlichen Pfarrkirche, wo die Taufe stattfinden sollte. Tausende Fackeln entlang des Weges »machten die Nacht zum Tage« (wie ein völlig überwältigter Chronist festgehalten hat) und verschafften den zahlreichen Schaulustigen eine glänzende Sicht darauf, wie die Amtsträger und Höflinge gemessenen Schrittes an ihnen vorbeizogen, bis endlich der kleine Karl und seine vier Taufpaten erschienen. Jeder von ihnen sollte in den frühen Lebensjahren des Knaben eine entscheidende Rolle spielen: seine (Stief-)Urgroßmutter Margarete von York, die Witwe Karls des Kühnen; seine Tante Margarete von Österreich; sowie Charles de Croÿ, Fürst von Chimay, und Jean de Glymes, Herr von Bergen, zwei bedeutende niederländische Adlige. Die Symbolik dieser Reihenfolge war für die Zeitgenossen unübersehbar: Philipp, dem der Ehrenplatz am Ende des Zuges eigentlich zugestanden hätte, trat ihn an seinen Sohn ab, der so – indem er die Huldigung seiner zukünftigen Untertanen entgegennahm – zum gleichen Zeitpunkt sein weltliches Erbe antrat, wie er durch die Taufe zu einem Glied der christlichen Kirche wurde.
« Schon seit Beginn der Geschichtsschreibung über Karl ist seine Abstammung stets ein Thema gewesen − und das aus gutem Grund. Denn schließlich hatte erst eine bemerkenswerte Abfolge von Geburten, Heiraten und Todesfällen dazu geführt, dass das Erbe von vier europäischen Dynastien unter seiner Herrschaft vereint wurde. Allerdings hatten Karls Großeltern dies so nicht beabsichtigt, und es wäre auch nie so gekommen, wenn die ehelichen Verbindungen zwischen der Infantin Isabella und Manuel von Portugal, zwischen dem Infanten Johann von Kastilien und Margarete von Österreich oder zwischen Ferdinand von Aragón und Germaine de Foix einen Erben hervorgebracht hätten, der das Erwachsenenalter erreichte.
Für dieses ungewöhnliche Arrangement hatte Philipp gute Gründe. Zwar führte er zahlreiche Titel, doch hatten seine Vorfahren sie Stück für Stück über den Zeitraum eines guten Jahrhunderts hinweg zusammengetragen, meist durch Heirat. Wie Rolf Strøm-Olsen dargelegt hat, »bot Karls Taufe dem habsburgischen Hof eine der seltenen Gelegenheiten, Ansprüche auch auf überregionale Legitimität, Macht und Autorität geltend zu machen«. Das verlieh der Zeremonie von Gent »in ritueller Hinsicht zumindest etwas von der Bedeutung, die anderswo in Europa den Krönungszeremonien zukam – Zeremonien, die den Herrschern der Niederlande versagt blieben«.9
Ganz vertraute Philipp den braven Bürgern von Gent jedoch nicht. Drei Wochen vor Karls Geburt ordnete er an, dass 30 Bogenschützen und 25 Hellebardisten fortan »bereitstehen [sollten] ab der Zeit, da der Erzherzog des Morgens aufsteht, um ihn auf dem Weg zur Messe zu begleiten«. Ohne ausdrückliche Genehmigung, hieß es weiter, durfte diese Leibwache »den Palast nicht verlassen«, sondern sollte »die Person des Erzherzogs schirmen und beschützen«, Tag und Nacht.10 Derlei Vorkehrungen waren alles andere als müßig: Nach dem Tod Marias von Burgund im Jahr 1482 hatte die Stadt Gent sich geweigert, ihren Ehemann Maximilian als Herrscher über die burgundischen Niederlande und Vormund ihrer unmündigen Kinder anzuerkennen. Vielmehr ließen die Stadtoberen den jungen Philipp als Geisel gefangen setzen und bestellten einen Regentschaftsrat, »um das Anrecht unseres Herrn, Eures Sohnes, zu schützen, den wir für unseren Fürsten und rechtmäßigen Herrn erachten, und keinen anderen«.11 An der Spitze von Truppen aus seinen deutschen und österreichischen Herrschaftsgebieten schlug Maximilian diesen Ungehorsam nieder und befreite seinen Sohn, den er in die loyale Stadt Mecheln überstellen ließ; drei Jahre später jedoch sollte Maximilians selbstherrliches Verhalten zuerst seine Gefangennahme und Inhaftierung in Gent, gefolgt von seiner Ausweisung aus den Niederlanden provozieren.
Die Zeit von Philipps Minderjährigkeit, die an seinem 15. Geburtstag 1493 endete, war von Aufruhr, Fraktionshader und Krieg geprägt gewesen. Das ließ den jungen Herrscher einen Regierungsstil wählen, der von dem seines Vaters grundverschieden war. Denn, wie Philipp 1497 selbst erklärte: »Seitdem wir volljährig geworden sind und die Gefolgschaft unserer Länder erhalten haben, hat uns stets das ernste Verlangen, Bedürfnis und Streben bewegt, die große Unordnung zu beenden, die hierzulande aus alten Kriegen und Spaltungen erwachsen ist, sowohl innerhalb unseres eigenen Hauses als auch anderenorts in unseren besagten Landen, und stattdessen Ordnung herzustellen.«12 Ein Jahrzehnt später hielt der venezianische Gesandte am burgundischen Hof, Vincenzo Quirino, Philipps Politik für einen großen Erfolg. Philipp, schrieb er, sei »von Natur aus gut, großzügig, offen, liebenswürdig und freundlich, ja beinahe innig gegen jedermann« und habe »sich mit seiner ganzen Macht bemüht, dem Recht zur Geltung zu verhelfen. Er war gottesfürchtig, und was er versprochen hat, das hat er gehalten.«
Jedoch, fügte Quirino hinzu, »obgleich er schwierige Sachverhalte rasch begriff, erledigte er sie nur langsam und mit Zögern. Alles übergab er seinen Beratern.« Und weiter hielt er fest: »Nach meiner eigenen Erfahrung werden Entscheidungen an seinem Hof auf äußerst schwankende und wechselhafte Weise getroffen«, denn »oft wird im Rat die eine Sache beschlossen, aber etwas völlig anderes getan.« Gutierre Gómez de Fuensalida, der spanische Gesandte, pflichtete bei: Der Erzherzog, schrieb er, sei »überaus wankelmütig, und seine Meinung zu beeinflussen, ist für jedermann ein Kinderspiel«. Einmal tadelte Maximilian seinen Sohn, dieser habe »auf Verräter und treulose Ratgeber« gehört, »die Euch [verquere] Vorstellungen in den Kopf gesetzt haben, um einen Keil zwischen Euch und mich zu treiben«, und empfahl, dass »es besser für Euch wäre, wenn Ihr zunächst mir von Euren Plänen berichtest, und erst dann Euren Ministern, anstatt mich wie einen Fremden zu behandeln«. Aber Maximilians wiederholte Forderung, der Sohn solle seinem Beispiel folgen – und das hieß vor allem: Krieg gegen Frankreich führen –, führte am Ende nur dazu, dass Philipp sich (wie Quirino schreibt) »zwischen der väterlichen Zuneigung und dem innigen Vertrauen, das er in seine Minister setzte, hin- und hergerissen« fühlte. Kurz gesagt: »Er steckt in einem Labyrinth.«13
Olivier de la Marche, ein altgedienter Höfling der burgundischen Herzöge, der Philipps Lehrer wurde, scheint diesen ungünstigen Beurteilungen beigestimmt zu haben, denn am Schluss seiner Memoiren, die er unmittelbar vor seinem Tod im Jahr 1502 fertigstellte, nennt er den Erzherzog »Philipp Leichtgläubig« (»Philippe-croy-conseil«).14 Freilich hatte La Marche in seiner ein Jahrzehnt zuvor verfassten »Einleitung« den erlauchten Schüler noch davor gewarnt, dem Beispiel seines allzu eigenwilligen Vaters Maximilian zu folgen. »Lasst mich euch die Wahrheit sagen«, bittet er Philipp da mit Nachdruck: »Nie dürft ihr euren Untertanen Macht über euch einräumen, aber immer müsst ihr ihren Rat und ihre Hilfe einholen, damit sie eure großen Vorhaben umsetzen helfen und unterstützen.« La Marche pries den Erzherzog als einen, der – nach einem Vierteljahrhundert Krieg und Aufruhr – »das Land wieder auf die Füße gestellt hat, indem er gute Ratschläge beherzigte«: Er hatte seine verstreuten Besitzungen vereint und befriedet; er hatte die uneingeschränkte Geltung der habsburgischen Autorität gesichert; und er hatte ein Gremium von mehr als dreißig vertrauenswürdigen Ratgebern um sich geschart, von denen viele auch noch seinem Sohn hilfreich zur Seite standen. So schuf er ein wichtiges Element politischer Stabilität und Kontinuität, das einen Rückfall in die bürgerkriegsähnlichen Zustände, die dem Tod seiner Vorgänger jeweils gefolgt waren, zu vermeiden half.15
Der junge Herzog von Luxemburg ahnte von alldem nichts. Aus den Unterlagen der Hofhaltung geht hervor, dass schon wenige Wochen nach seiner Geburt »die Erzherzogin und ihre edlen Kinder« (Karl und seine um fünfzehn Monate ältere Schwester Eleonore) Gent verlassen und sich zuerst nach Brügge und dann nach Brüssel begeben hatten. Dort erkrankte Johanna ernstlich, und Liberal Trevisan, Philipps Leibarzt und Mitglied seines Rates, widmete sich »während neunundvierzig Tagen ohne Unterlass« gemeinsam mit »anderen Doktoren und Wundärzten unserer über alles geliebten Ehefrau, um sie von einer Krankheit zu heilen«.16 Karl wird davon nichts mitbekommen haben. Wie ein spanischer Diplomat berichtete, wurden der Herzog von Luxemburg und seine Schwester »gemeinsam in ihren Gemächern aufgezogen und ihrer Dienerschaft ist niemand hinzugefügt worden« – mit einer Ausnahme: Barbe Servels, die »über neun Monate hinweg meine hauptsächliche Amme war«, wie Karl vier Jahrzehnte später festhielt. Barbe, eine gebürtige Genterin, säugte ihren hochgeborenen Schützling von Anfang an, und Karl blieb ihr zeitlebens treu ergeben: Er war Taufpate ihres Sohnes, an dessen Werdegang er regen Anteil nahm, und als Barbe 1554 starb, ordnete er an, dass sie in der St.-Gudula-Kathedrale von Brüssel begraben werden sollte, und ließ ihr zu Ehren ein Epitaph anfertigen.17
Die Berichte des spanischen Gesandten Fuensalida an Ferdinand und Isabella liefern die frühesten Nachrichten von Karl und seiner Schwester. Nach seiner ersten Aufwartung im August 1500 schrieb Fuensalida, was wohl alle Großeltern gern hören: Im Alter von fünf Monaten sei »der Herzog von Luxemburg so groß und stark, dass man ihn für einen Knaben von einem Jahr halten könnte«, während seine Schwester Eleonore, nun beinahe zwei Jahre alt, »so lebhaft und anstellig, ja so weit entwickelt erscheint wie eine Fünfjährige«. Selbstredend waren die beiden »die hübschesten Kinder auf der ganzen Welt«. Um die Zeit seines ersten Geburtstages machte Karl »bereits die ersten Schritte in einem Laufgestell (carretonçillo)« und »geht mit einer Zuversicht und Kraft, die einem Dreijährigen anstehen würden«; bis zum August 1501 hatte er sich zum »stärksten Kind seines Alters [entwickelt], das ich je gesehen habe«.18
Das Interesse der Katholischen Könige spiegelte – zumindest in Teilen – auch eine akute Besorgnis über die Zukunft ihrer Dynastie wider. Im Jahr 1497 war ihr Erbe und einziger Sohn Johann gestorben und hatte seine schwangere Ehefrau Margarete allein zurückgelassen; auch das Kind war kurz nach der Geburt gestorben. Damit wurde Johannas ältere Schwester Isabella zur Erbin des gesamten von den Katholischen Königen regierten Herrschaftsgebietes; aber auch sie starb bereits 1498, kurz nachdem sie einen Sohn zur Welt gebracht hatte – der ihr wiederum zwei Jahre darauf ins Grab folgen sollte. Am 8. August 1500 erhielt Philipp ein Schreiben aus Spanien, das »den Tod des Kindes mitteilte, sodass mein Herr nun Thronfolger wurde«. Drei Tage später unterschrieb Philipp erstmals einen Brief mit »Yo el príncipe« (»Ich, der Fürst [von Asturien]«), dem traditionellen Titel des spanischen Thronfolgers.19
Diese Ereignisse hatten profunde Auswirkungen auf das Leben des kleinen Herzogs von Luxemburg. Auf lange Sicht würde er als Philipps und Johannas ältester Sohn seinem Vater wohl in Spanien wie auch in den Niederlanden und in Österreich nachfolgen. Auf kurze Sicht ließen ihn seine Eltern zurück, weil es in Spanien zwar keine Krönungszeremonie gab, jeder neue Thronfolger jedoch persönlich vor den Ständeversammlungen (Cortes) der verschiedenen spanischen Teilreiche erscheinen musste: Im Fall von Kastilien, León und Granada konnte Philipp dies »auf einen Streich« erledigen; in Aragón, Valencia und Katalonien musste er gesondert vorstellig werden, um sich huldigen zu lassen. Anfangs ließ er wenig Enthusiasmus erkennen, was sein unverhofftes Glück als neuer Thronerbe betraf. Seine Untertanen setzte er erst im Dezember 1500, unmittelbar vor seinem Aufbruch nach Spanien, von seinen Reiseplänen in Kenntnis – und zwar deshalb, weil er die Niederländer um Geld zur Finanzierung der Reise bitten musste. Und selbst dann ließ er es so aussehen, als werde er womöglich allein aufbrechen. Diese Unverbindlichkeit des Erzherzogs spiegelte vermutlich die Tatsache wider, dass Johanna inzwischen mit ihrem dritten Kind schwanger war (Isabella, die im Juli 1501 zur Welt kommen sollte und nach ihrer spanischen Großmutter, »Isabella der Katholischen«, getauft wurde); zugleich war Philipps Zaudern aber auch auf die ablehnende Haltung seiner Höflinge zurückzuführen, die – wie Fuensalida schrieb – »eher zur Hölle fahren würden als nach Spanien«. Erst im Oktober 1501 brach das frischgebackene Thronfolgerpaar schließlich zu seiner Reise auf; ihre Kinder ließen sie unter der Obhut Margaretes von York in Mecheln zurück, wo schon Philipp aufgewachsen war. Unterstützung erhielt Margarete freilich von einem Haushalt aus beinahe einhundert »unverzichtbaren Bediensteten«.20 Die Kinder sollten ihren Vater erst zwei Jahre später wiedersehen, und ihre Mutter blieb sogar noch länger in Spanien, um dort im März 1503 einen weiteren Sohn zur Welt zu bringen, den sie nach ihrem Vater Ferdinand nannte. Erst 1504 kehrte Johanna in die Niederlande zurück.
Den folgenden wichtigen Hinweis verdanken wir María José Rodríguez-Salgado:
»Es war in der damaligen Zeit keineswegs ungewöhnlich, dass kleine Prinzen von ihren Eltern getrennt wurden, mit denen sie durch persönliche wie politische Bande verbunden waren. Wir sollten deshalb nicht den Fehler machen, in den Adels- und Fürstendynastien von damals die Emotionsstrukturen einer bürgerlichen Familie von heute zu erwarten. Aber selbst nach den damaligen Maßstäben war Karl in eine außergewöhnliche – und in eine außergewöhnlich dysfunktionale – Familie hineingeboren worden.«21
Die Briefe des Gesandten Fuensalidas an die Katholischen Könige halten diese Dysfunktionalität fest. So berichtet Fuensalidas etwa, Philipp habe, während Johanna noch in Spanien weilte, mit seinen Kindern »jede Menge Spaß gehabt« und »viel Zeit mit ihnen verbracht«, während Johanna sie nach ihrer Rückkehr in die Niederlande ignoriert habe. Zudem führte Philipps eheliche Untreue zu derart schweren Spannungen zwischen den Ehegatten, dass Fuensalida sich im Juli 1504 (zum Leidwesen aller Historiker) nicht getraute, die Einzelheiten brieflich mitzuteilen, sondern stattdessen einen Sonderboten nach Spanien schickte, der seinen Majestäten den Streit persönlich schildern sollte. Im Monat darauf besuchte Philipp Holland ohne seine Frau, und der spanische Botschafter hielt mit Bedauern fest, dass »Ihre Hoheit [Johanna] ihrem Ehemann nicht schreibt, und er ihr auch nicht«. Nach seiner Rückkehr bemühte der Erzherzog sich um eine Aussöhnung und brachte Karl mit seinen Schwestern aus Mecheln nach Brüssel, um gemeinsam mit ihnen die Mutter zu besuchen, »weil er glaubte, wenn er [die Kinder] mitbrächte, würde sie mit ihnen reden«, aber Fuensalida zufolge schien sie »an deren Gesellschaft keinen großen Gefallen zu finden«. Also versuchte Philipp es mit einer anderen Taktik: »In jener Nacht schlief der Fürst in der Kammer seiner Ehegattin« (und vermutlich empfing Johanna in jener Nacht auch noch ein weiteres Kind, ihre Tochter Maria). Schon bald verschlechterte sich das Verhältnis der Eheleute jedoch erneut. Regelmäßig schrien sie einander an, und von Zeit zu Zeit zog Johanna sich in ihre Gemächer zurück und verweigerte jegliche Nahrung. Nachdem sie mit einer Eisenstange auf die Diener eingeprügelt hatte, die sich auf Philipps Geheiß um sie kümmerten, ließ ihr Mann sie unter ständiger Bewachung in einem abgetrennten Teil des Palasts einschließen. Die Kinder konnte man ihr offenbar nicht mehr überlassen.22
Im Oktober 1504 traf ein weiterer unerwarteter Brief aus Spanien ein. Ferdinand von Aragón teilte mit, dass seine Frau Isabella im Sterben liege. Daher ließ er Philipp wissen:
»Der Prinz, mein [Schwieger-]Sohn, muss unverzüglich und im Geheimen seine Angelegenheiten dort [in den Niederlanden] in Ordnung bringen, damit alles so ist, wie es sein soll (es darf aber keiner erfahren, warum dies geschieht). Er selbst und die Kronprinzessin, meine Tochter, müssen sich zudem heimlich vorbereiten, damit sie, sobald ich einen Boten schicke, sofort aufbrechen und über das Meer unverzüglich herkommen können.«
Wieder einmal zeigte Philipp deutlichen Widerwillen gegen eine Reise nach Kastilien. Gegenüber Fuensalida klagte er, die Nachricht von der Erkrankung der Königin sei »zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt eingetroffen«, da er gerade einen Krieg gegen den Herzog Karl von Geldern begonnen hatte, einen entschiedenen und listenreichen Feind der Herzöge von Burgund, »und dies ist ein erhebliches Hindernis, sollte ich wirklich nach Spanien müssen: Obwohl Spanien von großer Wichtigkeit ist, ist dies hier doch mein wirkliches Heimatland, und ich darf es nicht verlieren.« Selbst die Nachricht von Isabellas Tod, die im Dezember 1504 eintraf, vermochte Philipps Haltung nicht zu ändern: Obgleich er unverzüglich begann, den Titel »König von Kastilien« zu führen, setzte er seinen Krieg gegen Geldern fort, bis er den größten Teil des Herzogtums besetzt hatte – nur um dann alles wieder herzugeben, wofür er Herzog Karl das Versprechen abnahm, Frieden zu halten, solange er selbst in Spanien sein werde. Im Januar 1506 endlich stachen der neue König und die neue Königin von Kastilien von Zeeland aus in See.23