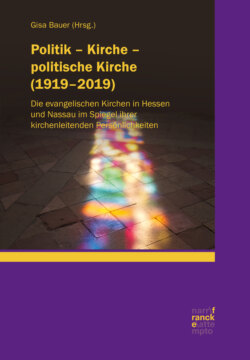Читать книгу Politik – Kirche – politische Kirche (1919–2019) - Группа авторов - Страница 25
1. Das Daodejing
ОглавлениеZu Beginn möchte ich die einleitend zitierten Sätze in den Kontext des gesamten Kapitels 1 des Daodejing stellen:
Der Weg, der gesagt werden kann, ist nicht der beständige Weg.
Der Name, der genannt werden kann, ist nicht der beständige Name.
Das Namenlose ist der Anfang von Himmel und Erde.
Das Namen-Habende ist die Mutter der tausenderlei Wesen.
Darum sei beständig ohne Begehren, um sein Subtilstes zu schauen.
Sei beständig mit Begehren, um seine Grenzen zu schauen.
Diese beiden sind desselben Ursprungs, aber haben verschiedene Namen.
Gemeinsam heißen sie das Dunkle,
des Dunklen noch Dunkleres.
Das ist das Tor zu allem Subtilen.1
Das Kapitel beginnt mit der Unterscheidung zwischen dem Benannten und dem nicht Benennbaren. Das Benannte, das in sprachliche Form Gebrachte wird dabei keineswegs abgetan. Vielmehr spielt der Text mit der Ambivalenz des Daos als des Unbenennbaren und des real je doch Benannten. Das Dao ist keineswegs das Transzendente, Abgekapselte, sondern es entfaltet sich selbst in der Wirklichkeit in Benennungen. Für die Erzeugung der Wirklichkeit kann das Dao nicht in der Unbestimmtheit bleiben, sondern es erzeugt sie, indem es sich bestimmt und Form annimmt. Beide Seiten des Dao als das Unbenennbare und als das immer schon Benannte ergeben gemeinsam das volle Bild. Es ist durchaus möglich, sich dem Dao sprachlich anzunähern, man wird es dabei jedoch in eine nicht-beständige Form bringen.
Gleichwohl ist die Unbestimmbarkeit dem Dao nichts Äußerliches. In Kapitel 14 wird es als „Gestalt ohne Gestalt“ bezeichnet:
Vage und subtil – es kann nicht benannt werden.
Es kehrt zurück ins Ding-lose.
Das nennt man die Gestalt ohne Gestalt,
die Form ohne Ding.
Man nennt es das Verschwommene und Vage.
Es sind nicht etwa unsere mangelnde Erkenntniskraft oder die Grenzen unserer Sprache, welche die sprachliche Bestimmung des Dao verhindern. Es ist in sich selbst ein nicht Festgelegtes, es widersetzt sich der Eingrenzung in eine eindeutige Gestalt.
Weshalb ist das so? Was motiviert den Autor, das erste Prinzip als ein Unbestimmbares anzusehen? An dieser Stelle möchte ich vom ersten Kapitel des ersten Teils in das erste Kapitel des zweiten Teils des Daodejing springen. Die beiden Teile sind überschrieben mit den Stichwörtern „Dao“ 道 und „De“ 德. De kann mit „Lebenskraft“ oder „Tugend“ übersetzt werden. De ist die reale Umsetzung des Dao im einzelnen Lebewesen. Da alle Dinge dem Dao entspringen, gestaltet sich ihr natürliches Sein ebenfalls gemäß dem Dao. Dies wird als De bezeichnet. Der Mensch hat nun das Vermögen, sein eigenes Verhalten zu bestimmen. Damit stellt sich ihm die Frage nach dem De noch in anderer Weise – nämlich als Frage nach dem idealen Verhalten. Das De ist das gelingende Verhalten – nicht nur in moralischer Hinsicht, sondern unter umfassender Einbeziehung praktischer Aspekte. Wie kann sich dieses nach der Auffassung des Daodejing gestalten?
Die Einleitungssätze des zweiten Teils geben auf diese Frage eine überraschende Antwort:
Das hohe De versucht sich nicht als De zu gebärden, deshalb besitzt es De.
Das niedrige De will das De nicht verlieren, deshalb besitzt es kein De. (c. 38)
Den ersten Halbsatz müssen wir im chinesischen Original betrachten, denn er spielt mit den Grenzen der Grammatik. Im Chinesischen können viele Wörter sowohl als Substantiv als auch als Verb auftreten. Dies gilt jedoch nicht für das Wort „De“, welches nicht als Verb benutzt werden kann. Genau das tut der Text jedoch beim zweiten Vorkommen von „De“ in diesem Vers:
上德不德
Shàng dé bù dé
Das Negativpartikel bù 不 kann nur vor Verben stehen, daher muss das zweite „De“ verbal interpretiert werden. Unter Missachtung der sprachlichen Usancen formt der Text das Substantiv zu einem Verb um. Man könnte im Deutschen seinerseits sprachlich gewalttätig übersetzen: „Hohe Tugend tugent nicht“. Die Erwägung der Frage, was damit gemeint sein kann, ist Aufgabe der Interpretation. Mein Vorschlag lautet: Das dem Dao gemäße Verhalten ist ein solches, welches sich nicht an einem Idealbild des De orientiert. Wer eine bestimmte Form des Verhaltens anstrebt, versteift sich auf einen Aspekt des Lebens und blendet andere aus. Das Dao als das Bewegungsprinzip aller Wesen wird so in der Selbstentfaltung behindert2. Das Daodejing vertritt die These, dass die Propagierung von Verhaltensnormen wie Güte, Rechtschaffenheit oder Liebe zu den Eltern3 nicht nützt, sondern vielmehr schadet. Der Mensch wird sich eher gütig verhalten, wenn ihm die Güte nicht als Idealbild und Pflicht vorgehalten wird4. Dahinter steht die Vision eines zwanglosen Idealverhaltens, das sich mühelos von selbst ergibt. In der Terminologie der modernen Psychologie kann dies als eine spezielle Art von Flow verstanden werden5.
Das Dao muss also gestaltlos sein, um die Praxis dazu zu bewegen, ihre Ausrichtung auf eine Zielgestalt aufzugeben. Aus der Unbestimmtheit des De, des praktischen idealen Verhaltens, ergibt sich die Unbestimmtheit des Dao als des metaphysischen6 Prinzips. Eine bestimmte Verhaltensweise – eine bestimmte Gestalt des Verhaltens – kann in einer Situation richtig und passend sein, in anderen Situationen wird sie jedoch nicht passen. Dem entspricht, dass nach Kapitel 1 ein sprachlicher Ausdruck des Dao oder des Weges durchaus als Weg bezeichnet werden darf, jedoch nicht als beständiger Weg. Ein sprachlich formulierter Weg könnte ein Stück weit erfolgreich leiten, er würde sich später jedoch als nicht weiterführend erweisen. „Beständig“ heißt hier: In allen Situationen des Lebens in dessen Vielgestaltigkeit passend. Jede explizite Theorie gelingenden Lebens bleibt hinter der Ganzheit des Lebens zurück und blendet gewisse Aspekte aus. Dementsprechend wird es an mehreren Stellen als Kennzeichen des gelingenden Verhaltens angesehen, dass es „lange“ (久 jiu) zu dauern vermag7.
Das Dao tritt im Daodejing in mindestens dreifacher Funktion auf: Erstens als Entstehungsprinzip aller Dinge, zweitens als natürliches Bewegungsprinzip der Dinge (und insbesondere der Lebewesen) in ihrem Sein – also gewissermaßen als „Lauf der Dinge“. Drittens ist das Dao der Weg des rechten Verhaltens, des De. Alle drei Funktionen stehen in enger Beziehung zueinander. So ist es entscheidend, dass das Dao nicht nur Richtschnur des gelingenden Verhaltens ist, sondern alle Wesen in deren Veränderung und Verhalten bereits bestimmt. Nur so ist es erklärbar, dass sich der Mensch an einem nicht aussprechbaren praktischen Prinzip orientieren kann.
Warum sieht das Daodejing das Dao – das erste Prinzip – als etwas nicht Sagbares an? Mit dem Dargelegten habe ich die These plausibel zu machen versucht, dass die Motivation hierfür im praktischen Bereich liegt. Die Negativität im Theoretischen – in einer metaphysischen Kosmogonie – gründet in einer negativen praktischen Philosophie. Die Unsagbarkeit des Dao als des Entstehungsprinzips aller Dinge korreliert mit der Unsagbarkeit des Wegs zum gelingenden Leben. Für den Primat des Praktischen gegenüber dem Theoretischen spricht auch, dass in den beiden ältesten einigermaßen vollständig erhaltenen Handschriften des Daodejing die beiden Teile – „Dao“ und „De“ – vertauscht sind8. Diese Fassungen beginnen nicht mit den metaphysischen Ausführungen von Kapitel 1 und dem eher theoretisch fokussierten ersten Teil, sondern mit dem vorwiegend praktische Fragen behandelnden Teil „De“ und den oben aus Kapitel 38 zitierten Sätzen. Wenn diese Interpretation zutrifft, so ist die Theorie des Dao als ersten Prinzips als Korrelat einer vermutlich zuerst existierenden praktischen negativen Philosophie zu deuten. Im Hintergrund steht die Erfahrung einer spontanen, ungebundenen und freien Existenzweise, welche gerade durch das Ablassen von Vorgaben erreicht wird.
Die chinesische Philosophie ist allgemein dadurch charakterisiert, dass ihr Hauptinteresse den praktischen Fragen, der Suche nach dem „Weg“, gilt9. Im Vergleich mit anderen Philosophien der klassischen Epoche (ca. 6.–3. Jh. v. Chr.), wie etwa mit denjenigen von Konfuzius, Menzius oder Xunzi, ist die metaphysisch-kosmologische Seite im Daodejing deutlich stärker ausgeprägt. Die gegebene Interpretation zeigt, dass sich dieses neue kosmologische Interesse in engem Bezug zu Fragen der Gestaltung der Praxis entfaltet. Für seine Formung sind praktische Motive entscheidend.
Die These von der Unsagbarkeit des beständigen Dao hat Laozi nicht daran gehindert, in affirmativer Weise über dieses zu reden. Jede negative Philosophie steht vor dem Dilemma, wie über ein nicht diskursiv Einholbares gesprochen werden kann. Als ein eindrucksvolles Beispiel für eine Möglichkeit, damit umzugehen, kann der erste Teil von Kapitel 25 dienen:
Es gibt da ein Ding, im Trüben vollbracht,
vor Himmel und Erde entstanden.
So still, so leer
steht es allein und ändert sich nicht.
Man kann es als die Mutter von Himmel und Erde ansehen.
Seinen Namen kenne ich nicht.
Soll ich es bezeichnen, so nenne ich es den Weg (Dao).
Gezwungen, ihm einen Namen zu geben, nenne ich es: Groß.
Groß bedeutet: Fortgehen.
Fortgehen bedeutet: Fern sein.
Fern sein bedeutet: Umkehren.10
In poetischer Sprache umschreibt der Text jenes Erste und zögert noch bei der Einführung eines Wortes dafür. Auch die Bezeichnung als „Dao“ ist nur eine äußerliche Hilfe, um überhaupt über es reden zu können. Will man ihm sprachlich näher kommen, so muss auf einen so nichtssagenden Begriff wie „groß“ bzw. „das Große“ zurückgegriffen werden. Alles Reden über das Dao steht unter der Maßgabe, dass es zwar Aspekte davon treffen kann, aber seine Größe und Umfassendheit reduziert.
Dennoch scheut sich das Daodejing nicht, jenen ungreifbaren Lauf der Dinge auch inhaltlich zu charakterisieren und dabei praktische Hinweise zu geben. Ein wichtiges Gesetz des Dao ist die Bezogenheit der Gegensätze und ihr Kreislauf, der das Starke in das Schwache überführt und umgekehrt. Daraus ergibt sich als praktische Konsequenz die Bevorzugung des gemeinhin als negativ Angesehenen: des Schwachen, des Weichen und auch des Weiblichen. Denn wer sich auf das Harte versteift, wird zerbrechen, während die Weichheit das Potential zum Harten hat.
Das Dao, das oberste Prinzip der Welt und insbesondere aller Wohlordnung, wird im Daodejing mehrfach als das Eine bezeichnet11. Es ist dasjenige, welches allen Strukturen Einheit verleiht, sofern diese es in ihnen wirken lassen. Dagegen legt Kapitel 42 ein Modell der Kosmogonie dar, in welchem das Dao das Eine erst erzeugt, welches anschließend in weitere Differenzierungen übergeht. Dies entspricht dem Gedanken, dass das Dao ein Unbestimmtes ist, welches alle Bestimmtheit aus sich heraussetzt. Da alle Rede vom Dao ohnehin cum grano salis zu lesen ist, mag dieser Widerspruch als Ausdruck der Vielgestaltigkeit und Unfassbarkeit des Dao zu lesen sein12.