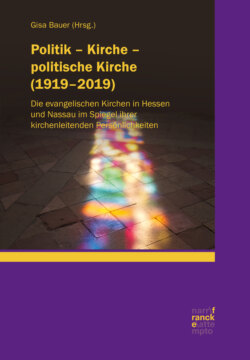Читать книгу Politik – Kirche – politische Kirche (1919–2019) - Группа авторов - Страница 41
1. Formen der Negativität 1.1 Theoretische und praktische Negativität
ОглавлениеDas Negative begegnet uns in zwei Grundformen: als das Nichtseiende und als das Nichtseinsollende1. Negativität ist als theoretische wie als praktische, als logisch-ontologische wie als lebensweltlich-volitive explizierbar, als Gegenstand eines theoretischen wie praktischen Negierens: des Feststellens, dass etwas nicht ist, bzw. Bestreitens, dass etwas ist, und des Neinsagens zu einer Forderung, einer Norm, einem Wunsch. Das Negative ist einerseits im Raum von Sein und Nicht-Sein, andererseits von Sollen und Nicht-Sollen angesiedelt. Beide Formen der Negativität sind Teil unseres kognitiven und handelnden Wirklichkeitsverhältnisses. Auf der einen Seite vollzieht sich unser Sprachverstehen und Erkennen im unhintergehbaren Spannungsverhältnis zwischen Anwesenheit und Abwesenheit, zwischen Sein und Nicht-Sein, zwischen Bejahen und Verneinen; nach Tugendhat ist die Fähigkeit zur Ja/Nein-Stellungnahme konstitutive Voraussetzung des Gebrauchs propositionaler Sprache2. Auf der anderen Seite ist unsere Existenz praktischen und emotionalen Widrigkeiten ausgesetzt, Gefahren, die uns bedrohen, Schmerzen und Schädigungen, die wir erleiden. Menschliches Leben vollzieht sich zwischen Glück und Unglück, Gelingen und Scheitern, und Hegel zögert nicht, die „Arbeit des Negativen“3, die beim Negativen verweilt und durch es hindurch geht, als Weg des Lebens zu sich selbst zu beschreiben.
Nun ist nicht von vornherein klar, wie sich theoretische und praktische Negativität zueinander verhalten, inwiefern sie ineinander verschränkt und Momente einer einheitlichen Problemkonstellation sind – oder unabhängig voneinander unser Selbst- und Weltverhältnis bestimmen. Nach einem naheliegenden Verständnis liegt die theoretische der praktischen Negation zugrunde: Dass ein Sachverhalt als negativer – als Mangel, als Fehler – gegeben ist bzw. erkannt wird, bildet in dieser Sicht die Voraussetzung dafür, dass wir uns praktisch-verneinend – in Kritik, Verurteilung, Zurückweisung – zu ihm verhalten können. An ihnen selbst sind Bestreitung und Verurteilung logisch distinkte Akte und voneinander unabhängig. Allerdings widersprechen profilierte Konzepte dieser Anordnung, sowohl hinsichtlich der Getrenntheit wie der Rangordnung beider Negativitäten. Bestimmend ist für sie die ebenso grundlegende Intuition, dass wir ursprünglich affektiv-erleidend dem Negativen ausgesetzt sind und uns abwehrend zu ihm verhalten, vor dem Bedrohlichen fliehen, gegen das Feindliche Widerstand leisten. Dass das praktisch-aversive Verhalten dem logisch-negierenden zugrunde liege, ist die Leitidee in Freuds klassischer Abhandlung über die Verneinung, die er als „intellektuellen Ersatz der Verdrängung“4 aufweisen will. Ähnlich macht Emmanuel Levinas in der Negativität, die im sinnlosen Leiden als der schlechthinnigen „Verwerfung und Verweigerung von Sinn“ erfahren wird, die „Quelle und den Kern jeder apophantischen Negation“5 aus. Die erlebte Konfrontation mit dem Nichtseinsollenden wird hier zur Tiefenschicht der logisch-prädikativen Praxis des Verneinens. Wie immer das Verhältnis zwischen theoretischer und praktischer Negation bestimmt sei – offenkundig ist, dass beide Weisen des Umgangs mit dem Negativen in unser Verstehen und Verhalten eingehen, dass ihre Dualität einen Wesenskern des menschlichen Selbst- und Weltverhältnisses bildet.