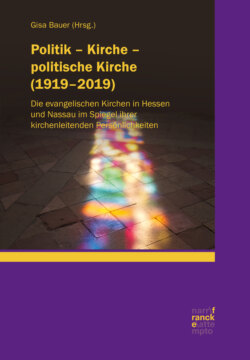Читать книгу Politik – Kirche – politische Kirche (1919–2019) - Группа авторов - Страница 26
2. Plotin
ОглавлениеGehen wir nun zur Philosophie Plotins über. Für diesen ist das oberste Prinzip das Eine, aus welchem sich stufenweise die gesamte Wirklichkeit entfaltet. Werner Beierwaltes beschreibt dieses Entfaltungsgeschehen folgendermaßen:
Plotin denkt die Wirklichkeit im ganzen als eine in sich gestufte, in der eine geistige Bewegung wirksam ist, die von einem Ersten ausgeht und aus dessen Selbstentfaltung wieder in dieses zurückgeht. Dieses Erste und (für den Rückbezug) zugleich Letzte ist das Eine selbst – mit dem Guten selbst ein und dasselbe: universal umfassende Ursache alles Einzelnen und Anderen als es selbst. Als eine in sich in-differente Fülle läßt sie Alles durch sich jeweils es selbst sein, wirkt in diesem als dessen Einheits-, Seins- und Lebens-Grund.1
Jegliches Seiendes ist eines, und diese Einheit kann es nur vom Einen selbst haben. Der Geist ist im pointierten Sinne Einer, insofern er sich dem Einen zuwendet und daraus Einheit empfängt. Damit ist alles nicht nur aus dem Einen entstanden, sondern richtet sich auch im Gegenzug auf dieses aus und kann nur so das sein, was es ist. Trotz seiner gedanklichen absoluten Transzendenz ist das Eine in jeglichem Seienden wirksam als dasjenige, was dieses eint und so überhaupt sein lässt.
Das Eine ist für Plotin das absolut Eine, welches keinerlei Teile hat. Da es ohne Teile keine Grenzen haben kann, treffen die üblichen Begriffe es nicht, denn jeder Begriff begrenzt und jede Prädikation führt bereits eine Differenz von Subjekt und Prädikat ein. Das Eine ist damit aus logischen Gründen im eigentlichen Sinne unsagbar. Im Hintergrund hierfür steht eine mystische Erfahrung absoluten Einsseins – nicht eines Einsseins mit dem Einen, denn hier wäre noch Differenz, sondern des Einsseins schlechthin, in welchem es kein unterscheidbares Selbst mehr gibt.
Sprachlich nähert sich Plotin dem Einen vorwiegend über Negationen, an einzelnen Stellen interessanterweise aber auch über positive Begriffe, welche Rede dann aber als uneigentlich gekennzeichnet werden muss. Hier ist insbesondere die Enneade VI 8 zu nennen, in welcher der Ausdruck οἷον „gleichsam“ zu dieser Qualifizierung dient2. Dort werden dem Einen Begriffe wie Wirksamkeit (ἐνέργεια), Wille oder Vermögen (δύναμις) zugesprochen – sie müssen jedoch ganz anders verstanden werden als wenn sie für Einzeldinge verwendet werden. So scheint ein Prädikat wie „Wirksamkeit“ ein Zweites vorauszusetzen, auf welches das Wirkende wirkt bzw. welches es hervorbringt. Plotin präzisiert:
Hiergegen ist nun zu erwidern, dass überhaupt Jener nicht dem Hervorgebrachten gleichzustellen ist, sondern dem Hervorbringenden; dabei haben wir sein Hervorbringen als absolut anzusprechen, nicht, damit ein anderes Ding aus seiner Hervorbringung verfertigt werde, denn seine Wirksamkeit ist nicht auf die Verfertigung eines Anderen gerichtet, sondern sie ist ganz Er; ist er doch nicht Zweiheit, sondern Eines.3
Alle dem Einen zugesprochenen Prädikate müssen erstens in paradoxer Weise umdefiniert werden und zweitens auch so noch als uneigentliche Rede verstanden werden – es gelingt dem Denken und Reden nicht, diese Umdefinition in konsistenter Weise zu erklären.
Die Zugangsweise zum Einen ist nicht das diskursive oder auch intuitive Denken, sondern es wird in einem mystischen Erlebnis des Einsseins erfahrbar. Das Denken kann jedoch indirekt das Eine behandeln, nämlich insofern es Grund von allem Seienden und von dessen Einheit ist. Dass jegliches Seiendes der Einheit bedarf, weist auf das schlechthin Eine hin, welchem diese Einheit entspringt. Diese Dialektik kann die Schau des Einen, auf welche alles zielt, vorbereiten.
Wie beim Daodejing stellt sich die Frage: Was motiviert Plotins Gedanken von der Negativität des obersten Prinzips? Hier fällt zunächst die zentrale Rolle der Einheitserfahrung auf. Auf diese strebt das Philosophieren und damit auch das Leben hin, und aus dieser heraus kann die Konzeption eines reinen Einen ohne jede Scheidung erklärt werden. Jens Halfwassen vertritt demgegenüber die These, dass die Mystik durch die Dialektik fundiert sei: Die Schau des Einen kann nur vorbereitet geschehen, und diese Vorbereitung liefern der dialektische Aufweis, dass alles Wirkliche im Einen gegründet sein muss, sowie die Analyse des Begriffs eines Einen ohne Vielheit4. Dieser Hinweis auf das dialektische Moment ist wichtig, weil es die Rolle der logisch-diskursiven Analyse für die Formung des Konzepts des Einen hervorhebt. An Halfwassens Auffassung, dass die Mystik in der Dialektik fundiert sei, stellt sich jedoch die Rückfrage: Würde sich die Dialektik des Einen nicht ganz anders gestalten, wenn im Hintergrund nicht die Erfahrung einer absoluten Einheit stünde? Nur das Zusammenspiel von Dialektik des Einen und seiner mystischen Erfahrung kann die Ausrichtung der plotinischen Philosophie erklären. Gegenüber einer einseitigen Fundierung der Mystik durch die Dialektik, wie sie von Halfwassen vorgeschlagen wird, sehe ich einen wechselseitigen Fundierungszusammenhang. Die Philosophie Plotins kann nicht einfach als Versprachlichung mystischer Erfahrung gesehen werden, sie ist durch und durch dialektisch geprägt. Ebenso wenig kann das Fundament dieser Dialektik, die Konzeption eines reinen Einen ohne jede Vielheit, nur aus der mystischen Erfahrung heraus verständlich werden. Andere Dialektiker haben das Eine ganz anders behandelt. Im Zentrum der plotinischen Philosophie steht die mystische Erfahrung, seine konkrete Gestalt findet sein Denken des Einen aber nur in deren dialektischer Entfaltung.
Das Motivierende für die plotinische negative Philosophie scheint demnach jene beglückende mystische Erfahrung unterschiedsloser Einheit zu sein, im Zusammenspiel mit einer logisch-dialektischen Entfaltung des Begriffs des Einen und seiner Rolle für die Wirklichkeit.
Während die Motivation für das negative Denken im Daodejing eine praktische ist, liegt sie bei Plotin in der theoria in ihrer höchsten Form – in jener von Platon bereits angesprochenen Schau des Ersten, zu welcher der Diskurs hinführt, an welcher er jedoch seine Grenze findet.