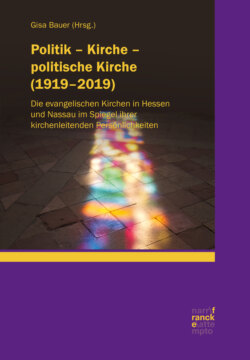Читать книгу Politik – Kirche – politische Kirche (1919–2019) - Группа авторов - Страница 42
1.2 Konstitutive und kontingente Negativität
ОглавлениеKomplementär zur theoretischen und praktischen Negation ist eine andere Grunddifferenz im menschlichen Umgang mit Negativität von Belang. Es gibt Negatives, das unabdingbar zur menschlichen Lebensform gehört, und es gibt Negatives, das uns kontingenterweise trifft, sei es, dass es von außen über uns kommt oder von uns selbst hervorgebracht wird.
Menschliches Dasein hat auf der einen Seite mit konstitutiven Einschränkungen, Mängeln und Leidenserfahrungen zu tun, die in der Endlichkeit der menschlichen Natur gründen. Die Existenzphilosophie hat solche Erfahrungen als Existenziale (Heidegger) oder Grenzsituationen (Jaspers) erkundet und exemplarisch in der Konfrontation mit Leid, Schuld, Schicksal und Tod beschrieben. Es ist ein Motiv, das seit der griechischen Tragödie die Besinnung auf das Sein und Wesen des Menschen leitet und das sowohl dessen äußere Schwäche und Verletzbarkeit, sein Ausgeliefertsein an Krankheit und Tod, wie seine innere Defizienz und Hinfälligkeit, seine Tendenz zur Uneigentlichkeit, sein Scheitern und seine moralische Desintegration betrifft. Es sind Momente des Fehlens und Verfallens, die, auch wenn sie beklagt, verurteilt und bekämpft werden, doch zuletzt unhintergehbar, nie zur Gänze eliminierbar sind und als solche in die menschliche Selbstverständigung integriert werden müssen. Mythen und Religionen führen sie zum Teil auf eine vererbte Schuld, eine Ursünde zurück. Zum Teil mag kontrovers sein, wieweit sie im strengen, zumal ethischen Sinn als Negativa zu gelten haben; wiederholt insistiert Heidegger darauf, dass die Uneigentlichkeit nicht als moralischer Makel, sondern als konstitutive Seinsform des Menschen im Zeichen der ‚zunächst und zumeist‘ gegebenen, ‚alltäglichen‘ Existenz zu verstehen sei. Gleichwohl ist unübersehbar, dass die Verfallensphänomene, die zwar das Dasein ‚entlasten‘, im Widerstreit zu einer anderen Strebenstendenz stehen, die der Natur des Menschen ebenso wesentlich, in gewisser Weise tiefer innewohnt und der gegenüber das Verfallen im Zeichen der ‚Versuchung‘ steht1. Mit Bezug auf das eigene Wollen verkörpern die Verfallsphänomene ein Negatives im Menschen, ein nicht wahrhaft Gewolltes und insofern ein Nichtseinsollendes, wenn auch in anderem Sinne als die Not, das Leiden und die Sterblichkeit, denen das endliche Lebewesen Mensch unausweichlich ausgeliefert ist. Allesamt gehören sie zur conditio humana, die dem Menschen unentrinnbar zugehört.
Solcher konstitutiver Negativität stehen kontingente Übel gegenüber, unter denen wir leiden und gegen die wir uns wehren, typischerweise menschengemachte Übel, von denen wir annehmen, dass sie im Prinzip vermeidbar, bekämpfbar, idealiter überwindbar sind: technische Katastrophen, Kriege, Gewalt, Unrecht. Die Qualität des Leidens muss keine andere sein als bei natürlichen Gebrechen und Krankheit, doch unterscheidet sich die praktisch-ethische Haltung in grundlegender Weise: Es sind Übel, die wir kritisieren, die wir aus moralischem Protest oder emotionaler Abscheu verurteilen, gegen die wir uns empören und gegebenenfalls Widerstand leisten. Solche Abwehr kann unter bestimmten Bedingungen auch naturbedingte Schädigungen und Ereignisse betreffen – das Schicksal Hiobs, das Erdbeben von Lissabon (Voltaire), das Leiden der Kinder unter der Pest (Camus), den Tod überhaupt (Canetti). Indessen bleibt die Intuition davon unberührt, dass wir die dem menschlichen Bösen entspringenden Katastrophen in anderer, abgründigerer Weise als ein Negatives, zu Verurteilendes, Nichtseinsollendes erfahren, zugleich als eines, das nicht notwendig sein muss, das kontingenterweise unser Leben und unsere Welt affiziert – auch wenn Zweifel an seiner Vermeidbarkeit, seiner Ausrottbarkeit bestehen bleiben.