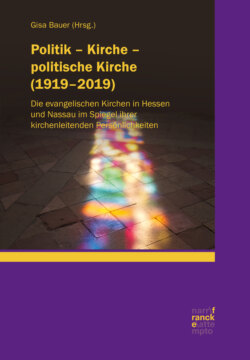Читать книгу Politik – Kirche – politische Kirche (1919–2019) - Группа авторов - Страница 27
3. Gemeinsamkeiten und Unterschiede
ОглавлениеHalten wir das Daodejing und das plotinische Denken nebeneinander, so lassen sich zunächst einige Gemeinsamkeiten feststellen. Das oberste Prinzip ist unsagbar; dennoch wird der Versuch unternommen, von ihm zu sprechen. Es ist nicht nur Entstehungsgrund aller Dinge, sondern erhält diese auch: Bei Plotin könnten die Dinge ohne die vom Bezug auf das Eine erhaltene Einheit nicht sein, und das gilt in besonderem Maße für den Geist, welcher sich denkend-strebend auf das Eine bezieht – denn alles Denken hat die Form der Einheit. Das Daodejing schreibt dem De als der konkreten Realisierung des Dao die Rolle zu, dass es alle Wesen aufzieht und nährt, gewissermaßen als deren Mutter1.
In beiden Philosophien findet sich das Motiv der Rückkehr zum Ursprung, aus dem alles entsprungen ist. Bei Plotin wendet sich das Denken zurück zum Einen, aus dem es stammt, und vollendet sich in ihm. Bei Laozi ist insbesondere Kapitel 16 zu nennen:
Die äußerste Leere erreichen –
völlige Ruhe bewahren.
Wenn alle Dinge gemeinsam tätig sind,
so betrachte ich darin, wie sie zurückkehren.
Die Dinge sind in üppigem Wachstum begriffen,
aber jedes kehrt zu seinem Ursprung zurück.
Zum Ursprung zurückkehren bedeutet: ruhig zu werden,
das bedeutet: zu seiner Bestimmung zurückzukehren.
Zu seiner Bestimmung zurückzukehren bedeutet Beständigkeit,
um das Beständige zu wissen bedeutet Klarheit.2
Die einleitenden beiden Verse weisen vermutlich auf eine Meditationserfahrung als den Hintergrund dieser Konzeption hin – auch hierin kann man einen Bezug zu Plotin sehen.
Wenn das erste Prinzip als unsagbar deklariert wird, so könnte man vermuten, dass es ein letztlich inhaltsleeres formales Prinzip ist. Das ist bei beiden Autoren nicht der Fall. Plotin umschreibt das Eine mit Begriffen wie Wirksamkeit oder Wille. Wie Werner Beierwaltes gezeigt hat, wird dem Einen unter dem Vorbehalt des hoion ein Selbstbezug zugeschrieben: Das Eine erzeugt sich selbst3. Das sind positive Begriffe, die von Seinsfülle zeugen. Demgegenüber wird das Dao auch inhaltlich vielfach als ein Negatives qualifiziert: Als „Gestalt ohne Gestalt“4, als leer und vage5, als dunkel und tief6, als „Nicht-Ding“7 oder gar als „Nichts“ schlechthin8. Das Nicht-festgelegt-sein ermöglicht die Wandelbarkeit und eben damit die Beständigkeit des Dao. Dass hiermit keine völlige Unbestimmtheit und Beliebigkeit gemeint ist, zeigen positive inhaltliche Aussagen über das Dao, die oft mit Bildern arbeiten: Das Dao als Tal, als Wasser, als Wurzel, als Blasebalg, etc.9 Negative Aussagen spielen auch bei Plotin eine zentrale Rolle für ein Reden über das Unsagbare. Sie implizieren aber keine inhaltliche Negativität des Einen, sondern haben die Funktion, die Kategorien des in der Vielheit begriffenen Denkens als unzutreffend für das Eine zurückzuweisen. Einige dieser Kategorien wie Wirksamkeit bezeichnen sehr wohl das Eine – aber nur, wenn sie entsprechend umgedacht wurden. Das Eine ist bei Plotin ein Bestimmtes, jedoch durch das diskursive Denken nicht Bestimmbares. Das Dao als gestaltlose Gestalt ist demgegenüber in sich durch negative Züge charakterisiert. Gerade weil es keine Gestalt besitzt, hat es das Potential, jedwede Gestalt aus sich herauszusetzen10. Diese Negativität hat praktische Bedeutung: Das Ziel der Praxis ist, das Dao frei in sich wirken zu lassen. Richtet das Handeln sich auf eine abgegrenzte Zielgestalt, so wird es einseitig, steif und damit brüchig.
Schließlich liegt ein wesentlicher Unterschied darin, dass bei Plotin ein Primat des Theoretisch-Metaphysischen, beim Daodejing ein Primat des Praktischen festzustellen ist. Bei Plotin ist es die theoria in der Form der mystischen Einheitserfahrung, welche das Motiv eines reinen Einen ohne Vielheit anregt. Eine logisch-sprachtheoretische Entfaltung dieses Gedankens führt zur These der Unsagbarkeit des Einen. Das in der mystischen Schau erfahrene Eine ist der Grund und das Ziel der plotinischen Philosophie; die Praxis, soweit sie von Plotin thematisiert wird, kulminiert im Streben nach dieser scheidungslosen Erfahrung des Einen selbst. Die alltägliche Lebenspraxis findet hier keine genuine Beachtung. Dagegen steht hinter dem Gedanken des unsagbaren Wegs eine genuin praktische Erfahrung: diejenige einer Verhaltensweise, welche gerade dadurch gelingt, dass sie sich nicht auf einen festgelegten Plan oder ein Ziel ausrichtet. Das Daodejing setzt großes Vertrauen in die Ordnungskraft unserer spontanen Impulse, sofern diese nicht durch starke Emotionen in Schieflage geraten. Das Dao als metaphysisches Prinzip kann als Grund dieser Impulse interpretiert werden. Die theoretische Philosophie des unnennbaren und gestaltlosen ersten Prinzips erweist sich damit als strenges Korrelat einer praktischen negativen Philosophie.