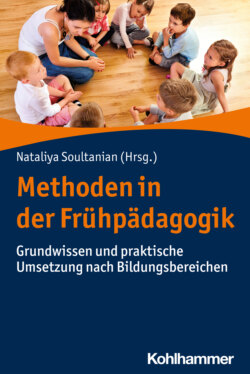Читать книгу Methoden in der Frühpädagogik - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Das Verständnis von Bildungsprozessen im frühkindlichen Bereich
ОглавлениеFrühkindliche Bildungsprozesse haben einen offenen Prozesscharakter, deren genauer Ablauf nicht immer planbar ist und die auf intuitivem, entdeckendem Lernen beruhen. Das entdeckende Lernen sollte dabei als eine pädagogisch-didaktische Methode der Wissensaneignung und zur Entwicklung eines immer umfangreicheren Weltverständnisses begriffen werden. Für Kinder im Kindergartenalter ist Lernen mit eigener Tätigkeit und aktiver Beteiligung verbunden. Tun und Lernen wird in dieser Alterspanne als Einheit gesehen, es geht um Lernen durch eigenes Tun, vielseitige Wahrnehmung und Selbsterfahrung. Die Kinder begeben sich auf Entdeckungsreise, beginnend in der unmittelbaren Umgebung, immer weiter bis zur Herstellung von kausalen Zusammenhängen und abstrakten Vorstellungen von Abläufen und Gegenständen außerhalb ihres unmittelbaren Wahrnehmungsfeldes. Der Wissensaufbau beruht folglich auf einer eigenständigen Auseinandersetzung mit der unmittelbaren, gegenständlichen Umwelt, die in konkretem Bezug zur Lebenswelt des Kindes und seinen aktuellen Bildungsthemen steht. Einer der wichtigsten Grundsätze bei der professionellen Begleitung der Kinder ist deshalb die beobachtende Haltung der pädagogischen Fachkraft. Die Kinder kommen zu neuen Erfahrungen induktiv, indem sie analysieren, Hypothesen formulieren und sie dann unmittelbar überprüfen, eingebettet in konkrete Handlungszusammenhänge. Dabei sind bestimmte Interaktionsformate wie Gespräch, Dialog, Begründung und Erklärung, Diskussion etc. förderlich, um die gemachten Erfahrungen zu verinnerlichen und die entsprechenden typischen Handlungsmuster aufzubauen. Eine stabile, auf Vertrauen aufgebaute, sozial-emotionale Beziehung zum Kind, systematischer Einsatz von nonverbaler Kommunikation, wie Lächeln, Blickkontakt, körperliche Zuwendung und eine motivierende Haltung seitens der Erwachsenen bei Lösungsfindungen im Rahmen eines Dialogs (Fthenakis, 2009, Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2007, Schäfer, 2011) bilden hier eine gute Grundlage. Die Rolle der Fachkräfte besteht dabei darin, die Kinder zu begleiten, mit ihnen über das Erlebte nachzudenken und Hilfestellung zu geben, das Gelernte in das bestehende Wissenssystem einzuordnen. Wichtig dabei ist auch, die Zusammenhänge zwischen dem zu vermittelten Wissen erkennbar zu machen und die Lernprozesse im Kindergarten mit anderen Lebenswelten der Kinder in Verbindung zu bringen, im Sinne eines Transfers des Gelernten.
Die eigenen emotionalen Erlebnisse tragen dazu bei, dass die Kinder das Erlebte und Ausprobierte verarbeiten, behalten und sich eine Meinung über die Welt und sich selbst bilden. Durch Malen, Tanzen, Töpfern und viele andere kreative Mittel sammeln die Kinder Eindrücke und Gefühle, die sie dann wiederum durch eigene Tätigkeit zum Ausdruck bringen (Dreier, 2017, Schäfer, 2011). Durch kreatives Tun bringen sie ihre Ideen, ihre Sichtweisen, ihre Gefühle und Gemütszustände zum Ausdruck. Wichtig ist dabei, die Kinder in ihrem Handeln nicht zu beeinflussen und keine Restriktionen und stereotype Erfolgsstandards oder ästhetische Ideale einzubringen. Erwachsene neigen dazu, sehr schnell ergebnis- und endproduktorientiert zu kommunizieren und eigene, häufig stereotype Meinungen in Kategorien »schön« und »nicht schön« an die Kinder weiterzugeben. Kreatives Handeln sollte hingegen frei sein, die Kinder sollten die Möglichkeit bekommen, etwas Neues, Schönes, Ungewöhnliches, Nicht-Normiertes zu gestalten. Die Aufgabe der Erwachsenden ist es dabei, den Kindern diese Handlungsfreiheit zu ermöglichen.
1 Die Fachausbildung von Erzieherinnen und Erzieher wurde großen inhaltlichen und strukturellen Veränderungen unterzogen, indem das Curriculum in Form von Lernfeldern ausformuliert wurde, wobei Auszubildende durch Lernfeldkonzepte drei berufliche Kompetenzbereiche abdecken, nämlich das Fachwissen, intellektuelles und praktisches Können (Methodenkompetenz) sowie Werteorientierungen und pädagogische Einstellungen (Bamler, Schönberger & Wustmann, 2010, S. 208).
2 Unter methodischer Handlungskompetenz versteht man die Fähigkeit, geplant, zielorientiert und reflektiert zu handeln und die eigene Arbeit zu organisieren. Im Bildungskontext ist damit gemeint, dass pädagogische Fachkräfte über didaktisches Fachwissen und Können verfügen, um Kinder individuell und ganzheitlich in ihrer Entwicklung zu unterstützen.