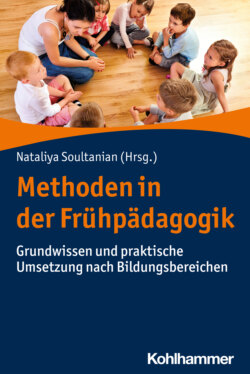Читать книгу Methoden in der Frühpädagogik - Группа авторов - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.4 Vor oder am Anfang aller Kompetenzbildung
ОглавлениеDie anhand des Beispiels des tropfenden Wasserhahns skizzierten Ausdifferenzierungsmöglichkeiten des Phänomenfelds zeigen konkrete Ansätze, sowohl in Hinblick auf eine umfassende bildungsbereichsübergreifende als auch erste spezifisch fachlich-kompetenzorientierte Frühförderung. Die Verbindung beider Aspekte ist ein wichtiger Orientierungsfaden zeitgemäßer und wirklich zukunftsorientierter Bildung gegenüber unserer gegenwärtigen Situation in einer Welt, in der mehr und mehr deutlich wird, dass nur im Zusammenspiel verschiedener Perspektiven Antworten auf die drängenden Fragen und Probleme unserer Zeit gefunden werden können. Daher macht es Sinn, eine Perspektive der Verschränkung, der gegenseitigen Wechselwirkung und Zusammenhänge der verschiedenen Erfahrungszugänge, Handlungsweisen und Wissensperspektiven, wie es zum Beispiel das Konzept der Ästhetischen Forschung in Bezug auf ein Phänomenfeld ermöglicht, schon früh in der Kita anzulegen (Kämpf-Jansen, 2001). Umso mehr, da gerade die Schule diese Verschränkung wieder trennt beziehungsweise in ein Neben- und Hintereinander auflöst, ohne sie in der Regel wieder systematisch oder gar systemisch in Beziehung zu setzen.
Gerade aber vor dem Hintergrund der sinnvollen und wichtigen Verbindung von bildungsbereichsübergreifenden als auch bildungsbereichsspezifischen Frühförderung ist es an dieser Stelle nochmals wichtig, den Moment einer ästhetischen Perspektive auf Bildung vor oder am Anfang aller Kompetenzbildung hervorzuheben. Kompetenzen, und so auch ein bildungsbereichsübergreifendes, systemisches Verständnis, sind ja immer schon bestimmte gesellschaftlich gewünschte oder gewollte, als richtig und wichtig befundene Wahrnehmungs- und Ausdrucksweisen.
Demgegenüber ist der ästhetische Moment von Bildung anormativ oder vornormativ, er entspringt der unmittelbaren Freude oder Lust am sinnlichen Berührtsein und der Lust und Freude, auf diesen Eindruck mit einem eigensinnigen Ausdruck zu antworten. Es geht um die gestalterische Entdeckung der Mannigfaltigkeit der Welt und der dabei gleichzeitigen Bildung der Vielfalt des eigenen Selbst. Das ist natürlich Kreation und Kreativität pur, aber eben nicht im Sinne eines funktionalen Einsatzes von Kreativität zur oder als Problemlösung. Oder anders gesagt: Eine ästhetisch orientierte Bildung wird später im Transfer umso mehr Wirkung entfalten, desto freier sie ist, wenn sie (zunächst) nichts in einem funktionalen Sinne leisten soll oder muss. Das heißt, wenn es (zunächst) »nur« um den Eigensinn, die Lust an der sinnlichen Entdeckung des Selbst in der wahrnehmend-handelnden Entdeckung der Welt und Freude der Entdeckung der Welt durch das wahrnehmend-handelnde Selbst geht. In dieser können sich dann drei ganz grundlegend-elementare Momente einer ästhetisch orientierten Bildung entfalten:
1. Die Entwicklung einer großen Differenziertheit von Berührungs-, Wahrnehmungs- und Ausdrucksmöglichkeiten und darin und dabei ein Selbstverständnis für den Umgang mit offenen komplexen Situationen.
2. Eine basale ethische Grundierung in der Selbst- und Weltbeziehung, indem über das sinnliche Wahrnehmen und Handeln als spielerisch-suchende Deutung der Dinge eine Ahnung des Zusammenhangs von der Deutung der Welt, meiner Relation zu ihr und meines Selbstverständnisses in ihr entstehen kann. Dabei geht es auch um die Erfahrung in der Fülle und Differenziertheit der Welt, die implizite Bedingung der Möglichkeit zur Fülle und Differenziertheit der Erfahrung des eigenen Selbst zu begreifen.
3. In Verbindung mit der basalen ethischen Orientierung die Ausbildung eines tiefen sozialen Vertrauens: Ich werde in meinem Zur-Welt-Sein wahrgenommen, ernst genommen und in meinem Interesse sogar unterstützt. Gleichzeitig kann ich Andere anregen und unterstützen. Der aktuell hochrelevante und vielgeführte Diskurs um Salutogenese und Resilienz verdeutlicht diese Relevanz dieser basalen Bildungserfahrungen, gerade auch im Hinblick auf die Frage, welche Erwartungshaltungen an die Welt sich in der Ausbildung der eigenen Identität bilden (Antonovsky, 1997/1997, Fathi, 2019, Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009).
Zusammenfassen lassen sich diese drei Aspekte als genussvolle Freude an der gestalterischen Entdeckung der Diversität der Welt, von sich selbst und der Neugier, wer und was ich noch in der Bewegung zur Welt sowie in der vielfältigen Bewegung und im Berührtsein durch und von Welt sein könnte. Es geht dabei nicht um Festlegung und Exklusion, sondern um die Freude an der gegenseitigen Vielfalt, dem Sowohl-als-Auch. Diese grundlegend diversitätsbejahende Haltung einer elementar-ästhetischen Bildungsperspektive wird nochmals ganz konkret und praktisch deutlich, wenn daran gedacht wird, dass ein vermeintlicher Defekt, ein Mangelding wie ein tropfender Wasserhahn Herzstück eines reichen Bildungsgeschehen, mannigfaltiger Selbst- und Welterfahrung werden kann.