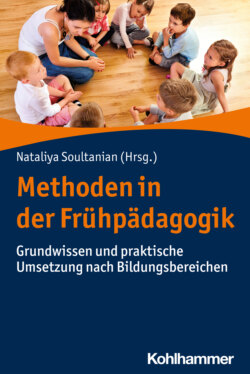Читать книгу Methoden in der Frühpädagogik - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Kommunikation und Interaktion: Soziale Entwicklungsaufgaben
ОглавлениеMenschliche Bewegungsfähigkeiten unterliegen auch der Entwicklung sozialer Kompetenzen und dem Hineinwachsen in familiale Lebensgemeinschaften. Der aufrechte menschliche Körper und dessen unbegrenztes Bewegungsrepertoire bilden nicht nur die Voraussetzung für den vielfältigen praktischen oder spielerischen Gebrauch von Dingen, sondern sind auch Grundlage menschlichen Ausdrucks-, Interaktions- und Kommunikationsverhaltens. Bei näherer Betrachtung scheinen der menschliche Körper und seine motorischen Fähigkeiten geradezu als »Kommunikationsmedium« evolviert zu sein (Reddy, 2008). Die freien und fein beweglichen Hände dienen ebenso zur Kommunikation wie zum Tragen, Halten, Werfen oder Arbeiten, verschiedene Körperhaltungen und gestische Bewegungen und ein unbehaart-offenes, sehr bewegliches Gesicht (es gibt mehr als 50 verschiedene Gesichtsmuskeln, Ekman, 2016) begründen körperlich die einzigartige Fähigkeit menschlicher Intersubjektivität. Diese bildet auch die Voraussetzung für den Erwerb der Sprachfähigkeit (Tomasello, 2019).
Der menschliche Organismus ist körperliches Emotions- und Kommunikationsdisplay. Das Gesicht und der gesamte Körper sind höchst berührungssensitiv. Berührung durch Andere ist Ursprung und Ausgangspunkt aller non-verbaler Interaktion und unterliegt aller frühkindlichen Etablierung primärer Intersubjektivität. Zur Rolle der Gesichts- und Körperbewegungen in der ursprünglichen Interaktion zwischen Mutter und Kind ist auf die berühmten »still-face-Experimente« zu verweisen. Die Experimente veranschaulichen sehr gut, was die neuere Forschung »primäre Intersubjektivität« (Trevarthen, 2007) nennt. Hier findet man alles, was die Einzigartigkeit menschlicher Interaktion und die Fähigkeit zu einer »gemeinsam geteilten Psyche« ausmacht: Gesicht, Körpersprache, Zeigegesten, gemeinsame Aufmerksamkeit, gemeinsam geteilte Intentionalität, Einschwingen und Synchronie von Bewegungen und dadurch von inneren Zuständen. Auf dieser Basis entstehen die frühkindlichen Interaktionsrituale und das Einschwingen psychischer Zustände, die Dynamik positiver emotionaler Energie und ein tiefes Vergnügen der Beteiligten, oder umgekehrt, tiefe Verunsicherung, Entsetzen und Panik, bei ausbleibendem Interaktionsfeedback (vgl. auch Collins, 2005).4
Es gibt keine natürliche spontane sprachliche Äußerung, die nicht von Körperhaltungen, Gesichtsausdrücken und vor allem von Arm- und Handgestik begleitet wäre. Das Gesicht mit vielen Gesichtsmuskeln sorgt für eine hochdifferenzierte mimische Ausdrucksfähigkeit. Die Augen sind groß, offen und ermöglichen, wie sonst nirgends in der Natur, mit Blicken zu kommunizieren, die Blicke der Anderen wahrzunehmen, die Blickrichtung zu erkennen und ihr gegebenenfalls mit dem eigenen Blick zu folgen. Es ermöglicht den Blick »in die Seele« des Anderen, in seine Stimmungslagen, ja sogar in seine Aufrichtigkeit oder seine Täuschungsabsichten. Nicht zufällig sind soziale Emotionen wie Scham an bestimmte Kopfhaltung mit dem Senken des Blickes verbunden.
Blicken folgen zu können ist wesentlicher Bestandteil einer weiteren Besonderheit menschlicher Sozialkompetenzen, nämlich der Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu teilen bzw. sie gemeinsam auf einen Gegenstand zu richten (Tomasello, 2019). Die gesamte Körperhaltung, die Blickrichtung und die Art des Blickes (ob beispielsweise Neugier, Interesse, Langeweile, Freude oder Panik im Blick transportiert werden) und Zeigegesten sind allesamt Mittel der gemeinsamen Aufmerksamkeitserzeugung und -steuerung. Zugleich vermitteln besonders der Blick und der Gesichtsausdruck elementare affektive Bewertungen dessen, worauf die Aufmerksamkeit sich richten soll.
Menschliche Emotionen sind eben nicht primär gefühlte Bestandteile einer subjektiven »Innenwelt«, sondern bilden vor allem die Basis menschlicher Kommunikation. Gefühle im eigenen Gesicht ganz automatisch auszudrücken und in den Gesichtern Anderer »lesen« zu können, meist nicht ausdrücklich und bewusst, trägt die gesamte menschliche Intersubjektivität in der frühkindlichen Entwicklung, genauso wie alle späteren Formen menschlicher Vergemeinschaftung. Lachen ist ansteckend und hebt die Stimmung aller Beteiligten, neugierige Blicke zum Himmel verleiten die Umstehenden, ebenfalls nach oben zu schauen und eine neugierige Erwartungshaltung einzunehmen, der Ausdruck von Kummer und Leid verursacht tiefes Mitgefühl, Tränen bei den Anderen motivieren schon sehr kleine Kinder, tröstend beizustehen (Ekman, 2016).
Die sozialen Entwicklungsaufgaben bestehen also vor allem darin, auf der Grundlage angeborener Verhaltensdispositionen diese intersubjektiven Fähigkeiten weiter zu entwickeln und auf ihrer Grundlage immer kompetenter am Prozess alltäglicher Interaktion teilzunehmen. Kinder im Vorschulalter müssen in diesem Sinne immer kompetentere »Alltagspsychologen« und immer differenziertere »intersubjektive Subjekte« werden, erst das ermöglicht ihnen, sich als Personen, als reflektierte »Selbste« zu entwickeln, die den normativen Verhältnissen ihrer Lebenswelt nicht nur ausgesetzt sind, sondern diese auch aktiv mitgestalten können.
Kinder wachsen innerhalb einer dynamischen Interaktionsordnung auf, die Personen, andere Lebewesen, Dinge, Materialien, räumliche und zeitliche Strukturen usw. umfasst. Die oben beschriebene »Sprache« der Dinge ist nicht an den Gegenständen selbst ablesbar, die beschriebenen »Aufforderungsstrukturen« der Umwelt müssen auf der Grundlage der genannten Interaktionskompetenzen erst vermittelt werden. Die Umwelt wird notwendig gemeinsam erschlossen, die Verinnerlichung der sensomotorischen Infrastruktur des Alltagslebens läuft notwendigerweise über Bezugspersonen (Gibson & Pick, 2003).
Kinder müssen sich von Geburt an aktiv in diese komplexe Interaktionsordnung einfügen. Die hierbei zu erbringenden Entwicklungsleistungen sind immens. Neben dem oben beschriebenen Erlernen der Körperbeherrschung, der Körperkontrolle und des Entwickelns der grenzenlosen Bewegungsvielfalt muss die Umwelt mit Hilfe der Anderen aktiv erschlossen und emotional bewertet werden. Darauf gründet das den Menschen auszeichnende Weltverstehen, und die einzigartige, später völlig habitualisierte Interpretationsleistung der menschlichen Wahrnehmung. Erst dadurch wird die Welt zu dem vertrauten Ort, an dem sich ein gemeinsames Alltagsleben und kompetentes Handeln entfalten können.
Einige Beispiele: Wir leben in hochdifferenzierten Geräusch-, Klang- und Lautlandschaften, unsere alltäglichen Aktivitäten finden vor dem Hintergrund der verschiedensten Geräusch- und Klangkulissen statt. In der Mehrzahl werden diese akustischen Sinnesreize gar nicht bewusst verarbeitet, sondern liefern einen auditiven Hintergrund, von dem sich dann besondere akustische Phänomene abheben und bewusst wahrgenommen werden können. Ein Kind hört das Brummen eines Flugzeuges. Bevor es nicht die Zuordnung zwischen Geräusch und Gegenstand erlernt hat, verbleibt dies nur eine sinnliche Stimulation. Der Aufbau der Verbindung von Sinnesreiz und Gegenstand verläuft durch einen Prozess des Zeigens und Erläuterns durch Bezugspersonen, interaktiv werden die Verbindungen zwischen Sinnesreizen und den diese verursachenden Gegenstände hergestellt. Nachdem die Verbindung erlernt wurde, wird diese habitualisiert, d. h. sie wird zum festen Bestandteil eines immer breiter werdenden Repertoires an komplexen Wahrnehmungsfähigkeiten, die aus sinnlicher Stimulation, diesen zugeordneten Gegenständen und aus komplexen sensomotorischen Koppelungen besteht. Von nun an folgt auf den Reiz die automatische Erkennung des Gegenstandes, eine begriffliche Zuordnung, eine Körperbewegung und Verhaltensreaktionen: das Kind hört kein Brummen, sondern ein Flugzeug, es schaut selbstverständlich nach oben, zeigt anderen Kindern das Flugzeug mit einer Zeigegeste, kommentiert verbal »das ist ein Jumbo«, ahmt in seiner Bewegung ein fliegendes Flugzeug nach und ähnliches. Auf die gleiche Weise werden die Zuordnungen zwischen anderen Sinnesreizen und deren verursachenden Gegenständen erlernt. Beispielsweise bei den uns umgebenden Geruchslandschaften: Gerüche werden zugeordnet, dann, wenn es sich um Essbares handelt, mit Geschmackserlebnissen verbunden, mit Namen assoziiert und mit möglichen Verhaltens- und Handlungsmustern verknüpft. Auf diese Weise kann ein Sinnesreiz den jeweils ganzen Komplex aktivieren (der Name des Gegenstandes löst die Antizipation eines Geruchserlebnisses aus, ein wahrgenommener Geruch wird benannt und löst eine Verhaltensbereitschaft aus usw.). Diese Sinnesreiz-Gegenstands-Wort-Handlungskomplexe werden auch zu konkreten sinnlichen Ankern, an denen sich die weitere Begriffsentwicklung festmacht. Das obige Flugzeug mag anfänglich eben gerade nur dies sein, nämlich ein Ding da oben, das brummt und sich bewegt, aber im Laufe der Zeit wird der Komplex mit Kenntnissen, Wissen und weiteren sinnlichen Assoziationen angereichert, bis sich ein vielschichtiger Begriff des »Flugzeuges« etabliert hat. Entscheidend hierbei ist, dass solche Komplexe gemeinsam erlernt und zusammen mit den Anderen aufgebaut werden müssen. Kein Kleinkind hört primär ein »Flugzeug«, sondern vernimmt ein Geräusch (Brown, 2014). Die Zuordnung wird erst durch das Lenken von gemeinsamer Aufmerksamkeit, Zeigegesten, Gesichtsausdrücken, stimmlicher oder sprachlicher Lautbegleitung und Kommentaren von Bezugspersonen ermöglicht. Ohne die Einbettung in soziale Lebenswelten mit anderen, ohne die oben erwähnte Interaktionsordnung, wäre ein solches Erlernen der Welt nicht denkbar (Seemann & Racine, 2012).
Dieses so skizzierte Erlernen der Welt beginnt lange vor dem Sprechen und begleitet und fundiert den gesamten Spracherwerb. Sprachliche Lautäußerungen der Erwachsenen gehören ganz selbstverständlich zur akustischen Umwelt, zu den Klangwelten, genau wie andere Geräusche, Laute, Töne. Allerdings besitzen Menschen ein besonderes, spezialisiertes Zentrum (ein über das Gehirn verteiltes Netzwerk) zur Aufnahme und weiteren Verarbeitung von sprachlichen Lautäußerungen. Die auditive Wahrnehmung von Sprachlauten wird ganz früh im Verarbeitungsprozess selektiert und von diesem System weiterverarbeitet. Sprachliche Äußerungen sind immer in interaktive Kontexte eingebettet und werden von Beginn an in Bezug zum Kommunikationsverhalten der Bezugspersonen (Blicke, Mimik, Zeigegesten etc.) gedeutet. Die Sprachwahrnehmung ist insofern ähnlich den anderen Sinneseindrücken, beide müssen durch Bezugspersonen mit den ihnen entsprechenden Gegenständen assoziiert werden. Beispielsweise stimuliert das Hören des Wortes »Hammer« den gleichen Assoziationskomplex aus Verhaltensbereitschaften, Sinneswahrnehmungen und praktischen Gegenstandsanforderungen wie das Sehen eines Hammers. Auch auf neurophysiologischer Ebene lässt sich dies nachweisen. Das Hören des Wortes »Hammer« aktiviert die gleichen neuronalen Netzwerkpartien wie die sinnliche Wahrnehmung eines Hammers, zugleich werden auch die motorischen Zentren in Bereitschaft versetzt, die beim sachkundigen Umgang mit einem Hammer die Gebrauchsbewegungen steuern (Martin, 2007).
Vom Säugling oder Kleinkind selbst werden im Rahmen aller Interaktionen und der Lenkung gemeinsamer Aufmerksamkeit ebenfalls ständig Laute produziert. Aus der Vielzahl der hervorgebrachten Babbellaute werden von den Interaktionspartnern besonders diejenigen mit Aufmerksamkeit bedacht, wiederholt und mit Lächeln versehen, die in der Sprache der Umgebung tatsächlich vorkommen, so dass hier ein dauernder Selektionsprozess stattfindet. Schließlich bleiben die Sequenzen übrig, die am meisten durch positive Aufmerksamkeit belohnt werden und die beim Versuch der Manipulation des Anderen am erfolgversprechendsten sind. Auf der aktiven Seite der Lernenden sind die so erworbenen Sprachlaute ideales Mittel, um die Aufmerksamkeit der Beteiligten zu lenken und um den eigenen Willen und eigene Absichten kundzutun und durchzusetzen. Das Kind baut so aktiv mit den anderen Interaktionspartnern eine soziale Umwelt auf, in der sprachliches Handeln eine immer zentralere Rolle zu spielen beginnt (Lee et al., 2009).