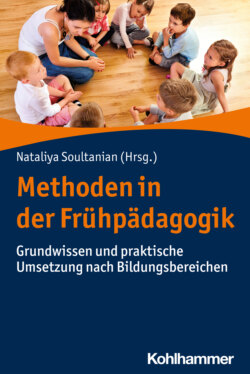Читать книгу Methoden in der Frühpädagogik - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Gesellschaftlicher Wandel und Herausforderungen für die Kitas Nataliya Soultanian
ОглавлениеDie heutige Gesellschaft ist unter anderem durch steigende Anforderungen im Beruf, durch die größer werdenden Herausforderungen einer gelingenden Work-Life-Balance und durch veränderte Beziehungen innerhalb der Familie, zwischen Eltern und Kindern gekennzeichnet. Kindheit wird dabei viel stärker als früher als eine Phase gezielter Förderung und der Grundlegung späterer Bildungserfolge verstanden und entsprechend organisiert. Deshalb unterliegt auch »Kindheit« insgesamt einem Wandel, der neue Anforderungen nicht nur an Eltern, sondern besonders auch an pädagogische Fachkräfte stellt. Es ist mittlerweile fast selbstverständlich, dass Kinder eine Kindertageseinrichtung besuchen; laut Fachkräftebarometer besuchten 2018 3.577.595 Kinder eine Tageseinrichtung (www.fachkräftebarometer.de; Zahl des Monats: Februar 2019). Das heißt, dass wir mit mehr Kindern, mit längeren und immer früher beginnenden Betreuungszeiten zu tun haben werden. Die Kinder verbringen immer weniger Zeit in den Familien und immer mehr Zeit im institutionellen Umfeld. Wir sprechen hier deshalb von einer »Institutionalisierung der Kindheit« (Bründel & Hurrelmann, 2017, S. 13 ff). Dies, zusammen mit steigender kultureller Heterogenität und der Zunahme sozialer Komplexität, macht den Bildungsauftrag der Kitas, die die Kinder bei der Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes und der Entwicklung breiter Lerngrundlagen unterstützen, zukünftig noch wichtiger.
Kinder werden hinsichtlich der wachsenden Anforderungen lebenslangen Lernens und eines umfassenden internationalisierten und immer mehr digitalisierten Berufslebens möglichst früh vorbereitet. Globalisierte Bildungs- und Arbeitsmärkte setzen mittlerweile nationale Bildungssysteme einem immer stärkeren Wettbewerbsdruck aus. Vor diesem Hintergrund soll auf drei gesellschaftliche Herausforderungen näher eingegangen: auf das Problem des Bildungsniveaus, auf Migration- und Integrationsprobleme und auf das Problem zunehmender sozialer Ungleichheit, die sich besonders im Familienhintergrund von Kindern manifestiert.
Mit der ersten PISA-Studie 2000 wurde eine öffentliche Debatte um die Schulleistungen deutscher Schüler und Schülerinnen im internationalen Vergleich ausgelöst. Als Folge dieser Debatte geriet auch der Bereich der frühen Kindheit und dessen Qualitätsdimensionen ins Zentrum der Aufmerksamkeit. So haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten die Kindertageseinrichtungen als Bildungsorte etabliert und die professionellen Anforderungen an pädagogische Fachkräfte in der Elementarpädagogik sind entsprechend gestiegen. Welche Rolle hier eine professionalisierte und alle relevanten Wissenschaftsentwicklungen integrierende frühkindliche Förderung haben kann, liegt auf der Hand. Sie legt den Grundstein für alle wesentlichen sozialen und kognitiven Kompetenzen, die für alle weiteren Bildungsprozesse, vor allem auch für Bildungsoffenheit und Bildungsmotivation, notwendig sind (Viernickel, 2017). Laut einer internationalen Studie »Providing Quality Early Childhood Education and Care« (OECD, 2018), in der die Einstellungen und Perspektiven von pädagogischen Fachkräften in neun Ländern erhoben wurden, sind deutsche Kita-Kräfte gut für den pädagogischen Alltag ausgebildet. Die Qualität der pädagogischen Arbeit ist für ein erfolgreiches Aufwachsen der Kinder entscheidend. Laut der Studie verfügen die Fachkräfte, die für die Arbeit mit Kindern eine entsprechende Ausbildung und ein hohes Bildungsniveau besitzen, über ein breites Spektrum an Methoden, die die kindliche Entwicklung fördern. Es besteht aber weiterhin ein hoher Bedarf an Weiterbildung, besonders für die Arbeit mit Kindern mit unterschiedlichem kulturellem und sprachlichem Hintergrund und mit Kindern, die Entwicklungsauffälligkeiten zeigen.
Auch der sich aktuell vollziehende demographische Wandel erfordert eine schon lange überfällige Realisierung einer kinderfreundlichen, strukturell-rücksichtsvollen Gesellschaft. Die Arbeitsmärkte der Zukunft brauchen u. a. viel mehr gut ausgebildete Frauen. Eine Gesellschaft, die immer noch einen wesentlichen Anteil ihrer Bevölkerung schwerpunktmäßig auf die familiäre Kindererziehung festlegt, kann es zukünftig noch viel weniger geben als heute. Die produktive und erfüllende Vereinbarkeit von Familienleben und Berufstätigkeit ist also, jenseits aktueller medienwirksamer Diskussionen, ein umfassendes gesellschaftliches Zukunftsprojekt. Dies erfordert aber auch eine Neukonzeption von Familienförderung und einer vielschichtigen und intensivierten Zusammenarbeit von Kitas und Familie.
Auch hier ist klar, welche zentrale Rolle einer professionalisierten frühkindlichen Betreuung, die nicht mehr als zweitrangiges Substitut familiärer Erziehungsarbeit, sondern als wesentlicher Bestandteil eines umfassenden familiären Bildungsprojektes angesehen wird, zukommen kann.
Die Abmilderung der sozialen Ungleichheit unserer Gesellschaft auf der Grundlage von zumindest anvisierter Chancengleichheit im Bildungsbereich sowie die Integration sog. bildungsferner Gesellschaftsschichten ist eine der ältesten und ergeizigsten Projekte der Bundesrepublik und westlicher Industriegesellschaften überhaupt. Es ist daher eine geradezu ironische Entwicklung, wenn zu Beginn der sich etablierenden »Wissensgesellschaft« das Bildungsniveau insgesamt sinkt, die Schere zwischen unten und oben größer wird und die Integration der bildungsfernen Schichten ein größeres Problem darstellt als je zuvor. Hier spielen die Kindertageseinrichtungen als erste Sozialisationsinstanz für Kinder mit Migrationshintergrund eine wichtige Rolle, um die herkunftsbedingte Benachteiligung zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Die Ergebnisse mehrerer Studien liefern Belege dafür, dass der Kindergartenbesuch mit dem späteren Erfolg in der Schule positiv korreliert ist (Becker & Lauterbach, 2008, Becker & Tremel, 2007).
Die Realisierung einer qualitativ hochwertigen frühkindlichen Bildung fällt mit der Qualität der Betreuung und Förderung, mit der Qualität der Ausbildung, des Studiums und der praktischen Erfahrung derjenigen, die die Erziehungsaufgabe zu leisten haben, zusammen. So beeinflussen gute Kindertageseinrichtungen positiv die Kinder in benachteiligten Lebenslagen. Ein positiver, förderlicher Faktor unter anderen ist es, dass diese Kinder einen regelmäßigen Zugang zur deutschen Sprache erhalten, soziale Kontakte und Freundschaften pflegen lernen und somit Gruppenzugehörigkeit in der institutionellen Betreuung erleben. Dies sind wichtige soziale Prädiktoren für grundlegende soziale und kommunikative Kompetenzen. Hierbei ist aber die Dauer und die Qualität des Kindergartenbesuches ausschlaggebend. Auch ist Vorsicht geboten, überzogene Erwartungen und Anforderungen an die Kindertageseinrichtungen zu richten, wenn es um die Vorbereitung auf die Schule geht, da zahlreiche Studien zum Einfluss der Familie zeigen, dass immer noch die Sozialisation in der Familie den stärksten Einfluss auf den Bildungsweg der Kinder hat (Tietze, Roßbach & Grenner, 2005). Bildungspolitisch müsste deshalb dringend mehr unternommen werden, um unterstützende Maßnahmen für bildungsschwache Familien und deren Kinder anbieten zu können. Gemeint sind hier etwa Kurse und Programme, die den Eltern pädagogisches Wissen vermitteln und ihnen in Erziehungsfragen Unterstützung bieten. Die Bildungspolitik sollte sich in Zukunft in diesem Bereich verstärkt auf die Bildung von Familien konzentrieren. Hierbei geht es besonders um die Förderung einer qualitativ guten Kommunikation und Interaktion zwischen Eltern und Kindern, um die Unterstützung des (Klein-)Kindes bei der Erkundung der Welt und bei der Aufnahme sozialer Beziehungen sowie um bildende Aktivitäten in der Familie (Jares, 2015). Eine erfolgreiche Familienbildung setzt auch die Vernetzung von Familienbildungseinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Jugendämtern, psychosozialen Diensten und anderen Institutionen voraus.
Für die Kinder bedeutet Bildung allgemein, einen differenzierten Zugang zur Welt zu entwickeln, dabei vielfältige soziale und sachliche Beziehungen einzugehen und eine immer differenziertere, der modernen Lebenswelt angemessene Erfahrung und Selbsterfahrung aufzubauen (Schäfer, 2011).