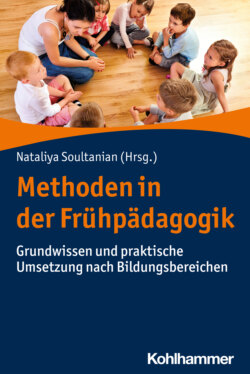Читать книгу Methoden in der Frühpädagogik - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 Die Anderen im Kopf: Selbstentwicklungsaufgaben
ОглавлениеWie erläutert, entwickeln Kinder lange vor Ausbildung einer differenzierten Sprachkompetenz immer komplexere Bewegungs-, Handlungs- und Interaktionsfähigkeiten. Hierbei entsteht und entwickelt sich ein erstes, individuelles »Bewegungs- und Handlungsselbst« (Stern, 1985). Der menschliche Organismus individualisiert und entwickelt sich im Umgang mit Gegenständen, der räumlichen Umwelt und den Bezugspersonen. Der permanente Einfluss der Letzteren ist für die Weiterentwicklung des frühkindlichen Handlungsselbstes und die Herausbildung eines personalen, reflektierten Selbstes von konstitutiver Bedeutung. Von Geburt an wird nämlich jede Körperbewegung, jedes Verhalten und jede Lebensäußerung in einem normativen Raum der Mitmenschen verortet: Es gibt keine Bewegung, keinen Laut, keine Geste, kein Kriechen oder Krabbeln, kein Weinen oder Schreien, kein Zappeln oder Zögern, kein Tun und kein Erleiden, welches nicht normativ kommentiert, also von anderen bewertet, beurteilt, bejaht, gelobt, getadelt und kontrolliert würde. Die unendliche Vielfalt der Bewegungen und des umgebungsbezogenen Verhaltens, ebenso wie die Vielfalt der Lautäußerungen, durchläuft so einen fortwährenden Selektions-, Formungs- und Feinabstimmungsprozess. Dieses mit normativem Nachdruck versehene Dauerfeedback der Anderen setzt das Kind einem ebenso andauernden Selbstbewertungs- und damit Selbstwerdungsdruck aus (Bogdan, 2012). Was hier geschieht lässt sich am besten so beschreiben: Eine unendliche Vielfalt von Bewegungen, Verhalten und Handlungen, Äußerungen, inneren Zuständen und äußeren Ausdrücken wird normativ selektiert und durch die Einteilung in richtig und falsch, erwünscht und unerwünscht, gut und schlecht, angenehm und unangenehm, erlaubt und verboten, hässlich und schön, lieb und böse, klug und dumm etc. auf Linie gebracht. Nichts entgeht den Dauerbewertungen durch die soziale Umwelt, auch Gefühle und Empfindungen werden so selektiert und geformt.
Gefühlsausdrücke werden auf besondere Weise kommentiert, ob verbal oder im Fürsorge- oder Ablehnungsverhalten. Auf Hunger, Durst, Wärmebedürfnis, Schutzbedürfnis wird auf je besondere Weise eingegangen, auch die gesamte Palette der Bedürfnisse und deren Ausdruck werden mit oben beschriebenem Raster beurteilt. Manche Bedürfnisse sind zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten unangemessen, ihre Äußerungen unerwünscht oder sogar verboten. Ebenso werden Verhaltensweisen und Handlungen insgesamt zum Gegenstand der Beobachtung, Kommentierung und Bewertung durch Andere gemacht. Welche Gegenstände darf man anfassen, welche nicht, in welchen Räumen muss man sich wie benehmen (in der Kirche leise sein beispielsweise), welche Dinge muss man wie behandeln (mit Vorsicht oder mit Kraft), welche Handlungen werden wie mit welchen Gegenständen ausgeführt (in der Wohnung wird nicht Ball gespielt, der Tennisschläger ist keine Bratpfanne, das Bett ist kein Trampolin usw.). Der Mensch ist die einzige Spezies, welche die Biologie und Psychologie ihrer Nachkommen in einem normativen sozialen Raum vergegenständlicht und auf diese Weise normativ skulpturiert (Scruton, 2017). Eine der größten Entwicklungsherausforderungen für das Kind besteht also darin, sich in dieser normativen Lebenswelt aus Lob und Tadel, aus Anerkennung und Ablehnung, aus Zuspruch und Schelte zurechtzufinden und sich dauerhaft in einer solchen Bewertungsdynamik zu behaupten. Dabei muss das Kind lernen, auf die Dinge der Umgebung auf die richtige Weise zu reagieren und zugleich auch mit sich selbst auf die richtige Weise umzugehen. Das heißt aber, was es tut und was es bleiben lässt, und wie es sich zur Umgebung und zu sich selbst verhält, ist im Laufe der Entwicklungsbewältigung immer weniger unmittelbar impuls- und bedürfnisgetrieben, sondern vermittelt durch die Bewertung der Anderen. Das Kind entwickelt so einen inneren Abstand zu seinen Bedürfnissen, Regungen und Impulsen und lernt, sie mit den normativen Kriterien der Anderen einzuschätzen, sich zu kontrollieren und sich so in die bestehende Interaktionsordnung einzufügen.
Die »Anderen« übernehmen in diesem andauernden Prozess die Kontrolle »im Inneren« des Kindes. Dies ist eines der Fundamente für die Entwicklung eines personalen Selbst. Auf dieser Grundlage entsteht auch ein immer komplexer werdendes Selbstkonzept, in dem die verschiedenen Dimensionen der Selbstbeziehung, wie Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Selbstwertgefühle, Selbstachtung und Selbstkontrollansprüche, integriert werden müssen. Ab einem bestimmten Alter wird auch die vorab bestehende Unmittelbarkeit der Selbstbeziehung, ein auf Bedürfnisbefriedigung und Spielvergnügen angelegtes, unmittelbares Selbstverhältnis durch den »Blick« der Anderen vermittelt. Nun ist jeder Blick in den Spiegel auch ein Blick der Anderen, wie sie mich sehen und beurteilen. Ich gefalle mir nur, sofern ich anderen gefalle, ich sehe und beurteile mich nach den Wahrnehmungs-, Konventions- und Moralkriterien der Anderen. Dabei entfaltet sich auch eine Grundmotivation menschlichen Lebens, nämlich das permanente Streben nach Anerkennung (Joas & Hübner, 2016). Ein Wesen, dessen Innerstes und scheinbar Eigenstes in sozialer Interaktion aufgebaut wird und dessen überlebenswichtige Selbstachtung von der Zuwendung Anderer abhängt, lebt notwendig ein soziales Leben, und stirbt einen sozialen Tod, wenn ihm die lebenswichtige Achtung und Anerkennung versagt bleibt. Auch wenn diese Entwicklungen weit über das Vorschulalter hinausgehen, werden doch in den ersten sechs Lebensjahren entscheidende Grundlagen gelegt.