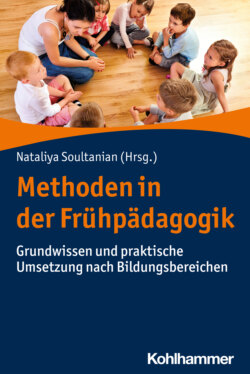Читать книгу Methoden in der Frühpädagogik - Группа авторов - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Elementar-ästhetische Perspektive auf Bildung Christian Widdascheck 3.1 Theoretisch-konzeptuelle Grundlagen und einführende Einordnung des Beitrags
ОглавлениеDer Begriff der ästhetischen Bildung ist spätestens seit den 1990er Jahren zum festen Bestandteil des erziehungswissenschaftlichen Diskurses (Mollenhauer, 1983, Duncker, Maurer & Schäfer, 1993) geworden. Neben theoretischen und empirischen Publikationen zur ästhetischen Erfahrung in der Kindheit (Mattenklott & Rora 2004, Duncker & Lieber u. a, 2010, Schäfer, 2011, Liebau, 2013) sind in den letzten 10 Jahren zunehmend Publikationen erschienen, die sich speziell mit der Bedeutung der ästhetischen Erfahrung für Bildungsprozesse in der Kindheit auseinandersetzen (Dietrich, Krinninger & Schubert, 2013, Staege, 2016). Einige Beiträge und Publikationen im Diskurs um die ästhetische Dimension in Bildungs-, und Lernprozessen verfolgen dabei im Sinne einer pädagogischen Anthropologie eine explizit phänomenologische Perspektive (Duncker, 2010, Lippitz, 1999, 2009, Stenger, 2007, Waldenfels, 1997, 2010). Die Relevanz dieser phänomenologischen Perspektive für Bildungsprozesse von Kindern wurde unter anderem in Publikationen und Beiträgen von Stieve (2008), Wolf (2016) und Kussmaul (2017) unter einer leibphänomenologischen Akzentuierung herausgearbeitet, der dieser Beitrag folgt. Diese Perspektive auf Bildung betont die Relevanz sinnlicher Erfahrungsräume, mit denen sich das Wechselspiel von Selbst- und Welterfahrung als Bildungshandeln entwickeln kann.
Für eine Annäherung an das Verständnis einer elementar-ästhetischen Bildungsperspektive ist zunächst die etymologische Bedeutung des Begriffs Ästhetik hilfreich. Die aisthesis, der altgriechische Wortursprung unseres heutigen Begriffs Ästhetik, hat nichts mit dem Aspekt der Schönheit oder Gefälligkeit zu tun, mit dem er gegenwärtig im alltäglichen Sprachgebrauch meistens verbunden wird, sondern verweist vielmehr auf die Relevanz der Sinnlichkeit in und für unsere Wahrnehmung und Erkenntnis.
Eng verbunden mit dieser sinnlichen Perspektive (aisthesis) auf Bildung ist das Konzept der Leiblichkeit in der Tradition des französischen Philosophen, Psychiaters und Kinderarztes Maurice Merleau-Ponty (Merleau-Ponty, 1974). Unter Leib versteht Merleau-Ponty den gelebten und erlebten Körper, der in der sinnlichen Begegnung mit Welt diese für uns erfahrbar werden lässt. Dabei ist der Leib in und durch seine Sinne jedoch nicht nur die Möglichkeit, Welt wahrzunehmen, gleichzeitig bildet sich der Leib auch selbst in dieser Begegnung mit Welt. Dadurch ist der Mensch in einem sinnlich-leiblichen Zur-Welt-Sein verortet (Fuchs, 2000, 2008). Damit ist gemeint, dass der Mensch keine in sich abgeschlossene Einheit in der Welt ist, sondern auf einer existenziellen Ebene als leibliches Wesen kontinuierlich in sinnlicher Resonanz und Beantwortung steht und auf diese angewiesen ist. Dies hängt mit der Ambiguität, den zwei Seiten des Wahrnehmungsprozesses zusammen. Aus einer leiblichen Perspektive sind Selbst- und Weltwahrnehmung verschränkt und aufeinander bezogen. Da diese leibliche Kommunikation, die Begegnung von Selbst und Welt, Ich und dem Anderen für uns im praktisch-alltäglichen Lebensvollzug als leibliche Wesen existentiell ist, ist sie meistens nicht wahrnehmbar: Sie liegt im Schatten unseres Bewusstseins, da sie die Bedingung der Möglichkeit unserer Existenz ist.
Im Alltagsmodus der sinnlichen Wahrnehmung ist dadurch entweder die Erfahrung von Welt/dem Anderen im Fokus oder die Selbsterfahrung/das Ich. Das bedeutet, wir nehmen dadurch nicht den Bildungsort oder den wechselseitigen Zusammenhang von Selbst- und Welterfahrung wahr, sondern eine der beiden Seiten. Anhand der Haptik lässt sich dies gut nachvollziehen. Wenn wir nach einem Einkauf eine schwere Einkaufstasche aus Stoff hochheben, dann nehmen wir entweder den Stoff und das Gewicht der Tasche wahr, oder aber wie der Henkel der Tasche die Hand einschnürt.
Damit jedoch der Quellort, die Ambiguität, die Zweiseitigkeit, das Wechselspiel von Selbst- und Weltwahrnehmung erfahrbar wird, braucht es eine besondere Form der sinnlichen Wahrnehmung, eine ästhetische Erfahrung. Ästhetische Erfahrungen machen wir immer, wenn uns eine sinnliche Wahrnehmung in besonderer Art und Weise berührt, wir von einem Eindruck ergriffen sind. Durch diese besondere Berührung in der Wahrnehmung, das unmittelbare Berührtsein finden wir uns im Wahrnehmungsereignis selbst wieder, wir befinden uns dann in der Wahrnehmung eines Phänomens. Das bedeutet, dass wir in diesem Moment den alltäglichen Modus sinnlicher Wahrnehmung verlassen und verlassen haben. Wenn wir zum Beispiel auf ein Fahrrad steigen und es ist windig, dann nehmen wir den Wind, wenn er von vorne kommt, in der Regel als Hindernis der Fortbewegung wahr, kommt er von hinten als Hilfe. Wir befinden uns also in einer alltäglichen sinnlichen geklärten Mittel-Zweck-Wahrnehmung von Selbst und Welt. Wenn wir aber, aus welchem Grund auch immer, auf das Phänomen der bewegten Luft selbst aufmerksam werden, wir ergriffen sind von diesem sinnlichen Ereignis, ohne funktional geklärte Trennung von Ich und Welt, dann befinden wir uns in einer ästhetischen Erfahrung. Das Wort Interesse, verdeutlicht dies sehr schön. Im Wort Interesse stecken die beiden lateinischen Wortstämme inter (dazwischen) und esse (sein). Wenn wir also wirklich im Interesse sind, uns etwas interessiert, dann sind wir in einem Zwischenbereich, einem Zwischenfeld, aus dem sich Welt und Selbst erst bildet. Und hier setzt dann genau der Aspekt des Ästhetischen für Bildungsprozesse ein. Es geht um den Gestaltungsprozess, der sich auf Grundlage der ästhetischen Erfahrung im sinnlichen Berührt- und Ergriffensein entfalten kann. Dieser Gestaltungprozess, der ein Phänomenfeld in seiner Diversität und Differenziertheit erst erfahrbar werden lässt, ist abhängig von der Frage, welche Wahrnehmungs- und Ausdrucksweisen möglich sind und zur Verfügung stehen, um das Phänomen, das durch und in der ästhetischen Erfahrung berührt, wahrzunehmen. Und je vielfältiger das Phänomenfeld erfahren werden kann, desto vielfältiger sind die Selbst- und Welterfahrungsprozesse, die damit und dadurch möglich werden. Denn das Phänomenfeld ist das Zwischen, aus dem sich Selbst und Welt in ihrer Abgegrenztheit temporär erst bilden. Insofern ist das ästhetische Wechselspiel von und aus Wahrnehmungs- und Ausdrucksweisen der gestalterische Akt der Symbolisierung, mit denen wir uns ein Bild von der Welt und uns selbst bilden, durch die wir uns Selbst und die Welt deuten und bestimmen, was diese Deutungen bedeuten.
Zusammenfassend werden die theoretisch fundierten und ausgeführten Begriffe nochmals ganz kurz in ihren Zusammenhängen dargestellt, um zu begründen, warum es sich bei dem Ganzen insgesamt um eine elementar-ästhetische Perspektive auf Bildung handelt.
Elementar meint im Zusammenhang dieser Perspektive einerseits die grundlegende Bedeutung der Ebene der Sinnlichkeit (aisthesis) für Bildungsprozesse. Andererseit wird damit auch auf die grundlegende leibliche Struktur des zur-Welt-Seins verwiesen. Zur-Welt-Sein bedeutet in diesem Kontext das Wechselspiel aus dem sinnlichen Antworten auf Welt, in der sich einlassenden Berührung der Wahrnehmung, und dem Antworten auf diesen Eindruck, in einer gestalterischen Handlung, als Ausdruck hin zur Welt, der wiederum beantwortet werden möchte.
Ästhetisch greift die strukturelle Ebene des leiblichen Zur-Welt-Seins auf, die im leiblichen Wechselspiel von Eindruck und Ausdruck als ästhetisch-gestalterische Ebene von Bildung schon angelegt ist. Sie kommt jedoch erst im Ereignis der ästhetischen Erfahrung voll zum Tragen. Denn die ästhetische Erfahrung ist eine besondere Art und Weise des Berührtseins. Dieses besonders intensive Eindrucksgeschehen, das darüber die funktional-alltägliche Ebene sinnlicher Wahrnehmung verlässt, ist ein Impuls, auf vielfältigste Arten und Weisen im Interesse, im Dazwischensein ein Phänomenfeld im gestalterischen Handeln ausdifferenzierend wahrzunehmen, was in Folge zur Bildung eines reichen Selbst- und Weltverständnisses führt. Beim Aspekt des Ästhetischen im Kontext dieser Bildungsperspektive geht es also um die Bedeutung gestalterischen Handelns als Symbolisierungsgeschehen und in Verbindung damit um die Frage, welche Phänomene überhaupt thematisch werden können und welche Handlungs- und Wahrnehmungsweisen zur Verfügung stehen.
Die Dimension des Ästhetischen ist dabei insbesondere bei Kindern von so großer Relevanz, da sie noch ganz leicht in eine staunend-ästhetische Wahrnehmung von sinnlichen Gegebenheiten kommen, da sie ja noch viel stärker dabei sind, die Welt und sich selbst kennenzulernen (Dunker, 2010). Dadurch ist die sinnliche Wahrnehmung bei Kindern noch weniger durch Vorstellungen, geklärte Wahrnehmungsgestalten und eine funktionale Perspektive überformt und sie geraten leichter in einen Modus ästhetischer Erfahrung.