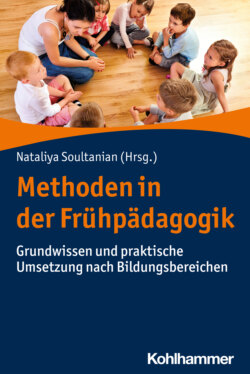Читать книгу Methoden in der Frühpädagogik - Группа авторов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1 Bewegung: körperliche und motorische Entwicklungsaufgaben
ОглавлениеDer menschliche Organismus entwickelt im Vergleich zu allen anderen Lebewesen einzigartige Bewegungsfähigkeiten und ein unerschöpfliches Bewegungsrepertoire. Der besondere Körperbau, der ein stabiles Stehen auf zwei Beinen und den aufrechten Gang ermöglicht, macht den Oberkörper mit den von den Funktionen der Fortbewegung befreiten Schultern, Armen und Händen zu einem weltzugewandten, auf den aktiven Umgang mit Gegenständen ausgerichteten System.
Die menschliche Hand ist nicht nur Extremität, sondern ein besonderes Wahrnehmungs-, Handlungs- und Kognitionsorgan. Hände sind vom Laufen befreit, besitzen eine Feingliedrigkeit und immense Enervierungsdichte (man denke an die Feinfühligkeit der sehr gut durchbluteten Fingerspitzen, die ein dichtes motorisches Feedback zwischen Hirn, berührtem Gegenstand und der Steuerung der Finger- und Handbewegung ermöglichen). Der frei bewegliche und gegenübergestellte Daumen, der ein echtes Greifen in verschiedenen Griffsvarianten erst ermöglicht, macht die Entwicklung dieses psychosomatischen »Organs« perfekt. Ein weiterer Aspekt der immensen Leistung, die hier von jedem Kind erbracht werden muss, selbst bei so scheinbar banalen Alltagstätigkeiten wie dem Drücken einer Türklinke oder dem Öffnen einer Keksdose, ist die Koordination von Auge und Hand und die jeweils zielführende Integration der Sensomotorik insgesamt (Wilson, 1998).
Zugleich ermöglicht der menschliche Körperbau ein geradezu unendliches Bewegungskönnen: Menschen können sich rhythmisch bewegen, tanzen, sich im Kreise drehen, springen, schwimmen, tauchen, auf einem Bein stehen, klettern, dauerlaufen, sprinten, auf dem Kopf stehen, auf den Händen laufen, Fahrradfahren, Skateboard fahren, Inline skaten, Purzelbäume schlagen, Saltos springen, Rad schlagen usw. Und Menschen können gezielt und mit hohem Momentum werfen, ein entscheidender Faktor der Humanevolution (Gintis et al., 2014).
Mit Blick auf die einflussreichen anthropologischen Analysen Arnold Gehlens kann man sagen, dass Menschen entspezialisierte Alleskönner im Bereich der Körperbewegung und Körperbeherrschung sind, im Gegensatz zu Tieren, die auf einen Bewegungsbereich spezialisiert und darin wahre Meister sind, aber ansonsten eher ein klägliches Bild abgeben (Gehlen, 1950). Selbst den mit Menschen aufgewachsenen Schimpansen oder anderen Primaten ist es nicht möglich, tanzen oder rhythmische Bewegungen zu erlernen, selbst bei intensivem Training erreichen sie keinen feinmotorischen Umgang mit Dingen, können kaum tragen, differenziert greifen usw. Menschen können nicht so schnell sprinten wie Geparde, aber mit Übung bringen sie auch darin Beachtliches zustande. Außerdem können sie über lange Zeit und Distanzen laufen, was evolutionär sicherlich als Adaptionskomplex in Wechselwirkung mit dem Verlust des Fells und der Ausbildung von Schweißdrüsen einherging, was der Fähigkeit zum Dauerlaufen eine physiologische Grundlage gab (Lieberman, 2013). Die alle weiteren menschlichen Entwicklungsaufgaben fundierende Kompetenzentwicklung besteht also in dem, was man näherungsweise das »motorische Erlernen der Welt und die Kontrolle eines Körperselbstes« nennen könnte (Stern, 1985).
Die Fähigkeit zum stabilen aufrechten Stehen und zum aufrechten Gang ist genetisch vorbestimmt, sie bedürfen keiner besonderen externen Motivation oder externer Instruktionen, sie initiieren und entwickeln sich unter normalen Bedingungen von selbst. Aber die gegenstandsbezogenen Umweltbewegungen müssen erlernt werden. Diese Entwicklungsaufgabe besteht in einer sehr weit gefächerten motorischen Aneignung der materiellen Umwelt, der menschliche Organismus verinnerlicht aktiv die Umweltgegebenheiten. Man muss sich nur einmal vergegenwärtigen, welcher Entwicklungs- und Lernaufwand hinter der Fähigkeit steht, eine Tasse oder einen gefüllten Becher zu ergreifen, zum Mund zu führen und wieder auf einen Tisch zu stellen (ohne dass das Behältnis zerbricht), oder einen Ball zu werfen und zu fangen oder einen Stift richtig zu fassen und kontinuierlich über ein Blatt Papier zu führen (Gehlen, 1950). Wenn man nun in Betracht zieht, wie komplex unsere artifiziellen Lebensumwelten sind, wird umso deutlicher, welche Leistungen hier von Kindern in ihrer vorschulischen Entwicklung erbracht werden müssen. Allgemein lässt sich diese Aufgabe wie folgt beschreiben: Kinder müssen die vielfältige »Aufforderungsstruktur« der Dinge körperlich-motorisch verinnerlichen (Gibson, 1950).3 Dinge sprechen und Kinder müssen verstehen lernen. Gebrauchsdinge und Naturdinge gleichermaßen fordern zu einem jeweils motorisch differenzierten Umgang mit ihnen auf. Ein Stuhl sagt: »Ich bin ein Stuhl, komm, sitz auf mir!« Ein Becher fordert, »Wenn du Durst hast, fülle mich und trink aus mir! Wenn du Spiellust hast, fülle mich mit Matsch«. Das Messer sagt (nach einigen expliziten Erziehungsprozessen): »Nimm mich in die rechte Hand, schneide mit mir, aber wehe, du steckst mich in den Mund!« Der Teppich fordert auf zum Wälzen, Kuscheln, Sitzen, Liegen. Wasser, Sand, Matsch, Zäune, Blumen fordern die ihnen je eigene attraktive Handlung, die Gartenmauer fordert vehement: »Klettere auf mich, balanciere auf mir, spring von mir.« Der Ball sagt: »Kicke mich, nimm und wirf mich«, die Buntstifte sagen: »Nimm mich und kritzele alles voll«. Die Pfützen fordern nachdrücklich: »Spring rein in mich und patsche in mir rum!« Dem Aufforderungscharakter der Dinge, den sozial strukturierten Räumen und der ebenso strukturierten Situationen entsprechen Typen von eingeübten Bewegungen und motorischen Fertigkeiten. Die erschlossenen, teils hergestellten, teils natürlichen, aber immer strukturierten und geordneten Lebensumgebungen, in denen Kinder heranwachsen, sind selbst konstitutive Bestandteile der geistigen Entwicklung, sie stellen ein komplexes Scaffolding menschlicher Wahrnehmung und Kognition dar (Gibson, 1950).