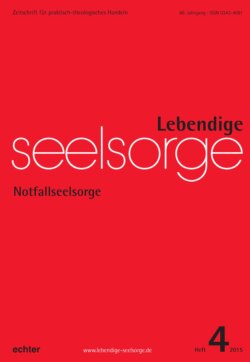Читать книгу Lebendige Seelsorge 4/2015 - Группа авторов - Страница 21
ОглавлениеGegen eine Theologievergessenheit der Seelsorge
Die Replik von Gerhard Dittscheidt auf Hanjo von Wietersheim
Mir ist vor allem die Kritik an einem bewusst pastoraltheologischen Durchdenken der – doch offensichtlichen – Aufgabe der Notfallseelsorge bekannt und auf den Kongressen und in den Kollegenkreisen begegnet. Es scheint eine (weitere) überflüssige Theologisierung und eine Abwendung vom Allzu-Offensichtlichen. Eine wegen ihrer Nachhaltigkeit für mich als Kritik zweiter Ordnung aufgenommene Argumentation, die ich sehr gewichte. Und doch…
Die ekklesiopraktischen und seelsorgetheologischen Überlegungen im Artikel Von Wietersheims treffen aus meiner Sicht den Punkt. Sie zitieren kirchlich-seelsorgliche Motive, jenseits der eher gewohnten Schwerpunkte kirchlicher Vollzüge: es gibt die theologisch begründete unberührte Liturgie in einer Scheinalternative „oberhalb“ des diakonischen Vollzuges und es gibt die seelsorgliche Fixierung auf die amtliche Rolle. Beides sind Engführungen, die sich nicht dogmatisch beweisen lassen, wohl aber durch das Praxisfeld der Notfallseelsorge als unangemessen herauskristallisieren. Sie lösen für die aktuelle Seelsorge und ihre Möglichkeiten derzeit zumindest eine nachhaltige, inhaltlich ersichtliche Verlegenheit aus.
Das scheint mir auch in der Spannung, die zwischen den beiden Konstitutionen des II. Vatikanischen Konzils, zwischen der dogmatischen Konstitution „Lumen gentium“ und der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ schon abgebildet und eben auch noch nicht abgearbeitet ist, enthalten zu sein.
Die Perspektive einer diakonischen Pastoral ist als eine Möglichkeit des neuen (alten/ursprünglichen) Ansatzes von Von Wietersheim kritisch eingeführt und grundlegender sodann die christologische Herausforderung in ihrer Sprengkraft innerhalb des notfallseelsorglichen Tuns geschildert. Dieses christologisch begründete Kirche-Welt-Verhältnis nehme ich als den eigentlichen Fokus und die eigentliche Herausforderung wahr und glaube, dass dies ein Anliegen von Papst Franziskus ist.
EFFEKTIVE UNTERSTÜTZUNG
Hier setzt dann auch meine gegenüber der Beschreibung Von Wietersheims deutlich skeptischere Perspektive an. Ich nehme bei ihm eine hohe positive Erwartung an die (evangelische) Kirche wahr, dass die praktischen Belange, die sich aus der Notfallseelsorge für die gegenwärtige und zukünftige kirchliche Praxis ergeben, eine positive Resonanz haben werden. Demgegenüber sehe ich mich veranlasst, die pastoraltheologische Spurensuche und Debatte einzufordern. Sei es der Professionalitätsdiskurs (eher protestantisch) oder der Amtsdiskurs (eher katholisch), sei es die Euphorie im Anschluss an Praxisberichte und sinnvolle Erfahrungen im Rahmen von Kooperationen der Notfallseelsorge und anderer Notfallinstitutionen.
Ob sie dazu angetan sind, die personellen und finanziellen Debatten so zu prägen, dass die Frage kirchlichen Grundlagenhandelns in der Welt Gottes neu buchstabiert wird, das scheint mir zunehmend offen. Von Wietersheims eindeutiger Hinweis auf die durch die Vielfalt überlasteten SeelsorgerInnen geht in diese Richtung. Allerdings verschärft sich bei genauer Betrachtung die Frage, wann denn an pfarrliche oder seelsorgliche Pflichten im Rahmen des Amtes angeknüpft werden sollte. Ich sehe die Entlastung im Votum und in der effektiven Unterstützung der institutionellen Kirche, nicht in der Motivlage der einzelnen Seelsorgenden oder Seelsorgekreise.
Da ist das Thema der Pastoral angesiedelt und hat einen eigenen Kontext, der sich nicht erschöpfend arbeitspsychologisch oder als Frage nach der Work-Life-Balance besprechen lässt. Ein häufiges – reflexartiges – Argument, das Von Wietersheim beschreibt, aber nicht problematisiert, ist, dass Notfallbegleitung zum pfarrlichen / priesterlichen Dienst gehört. Darin versteckt meine ich zu erkennen, dass es immer wieder schnell so kommen kann, dass seitens kirchlicher Institutionen auf Bewährtes zurückgegriffen wird. Das halte ich für den eigentlichen kirchensoziologischen und kultursoziologischen Kurzschluss, der auf kurze Sicht die Notfallseelsorge in ihrer Durchführung bedroht. Hier ist dann auch meine Antwort darauf, dass Papst Franziskus als kirchenleitender Seelsorger Impulse setzen muss. Ob sie sofort pragmatisch umgesetzt und so schnell hierarchisch missbraucht werden können, ist die Frage.
DIE PRAXIS ALS STACHEL IM FLEISCH
Pastorale Prioritäten sind weniger klar als seelsorgliche Plausibilitäten, Grundlinien gegenüber Einzelbeispielen noch zu wenig offensichtlich. Hier bedarf es keiner weiteren Praxishandbücher. Sie liegen aktualisiert und nachhaltig informativ vor. Ich sehe die Aufgabe, das pastoraltheologische Gewicht aufzuschließen und jenseits bzw. unterhalb kirchlich-gemeindlicher Praxis und seelsorglich-amtlicher sowie charismatischer Chancen zur Grundlagenerhebung – analog notfallpsychologischer oder traumatherapeutischer Gespräche und Entwicklungen auf dem Hintergrund von in den vergangenen Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen – zu führen. Von Wietersheim hat auch dies nach meinem Eindruck angedeutet, wenn er schreibt, dass seelsorgetheologisch und -konzeptionell zu wenig transparent gearbeitet wurde. Ich halte dieses Defizit auch für die derzeit größte Gefahr der „Praktiker“, insofern bei vielen Kolleginnen und Kollegen diesbezüglich eine Distanz, ja eine Skepsis gegenüber der theologischen Grundlagenarbeit besteht, die die Plausibilität des eigenen Tuns überschätzt und nicht wirklich kommunikabel macht.
Zugespitzt: mich irritiert die Theologievergessenheit in Teilen der Seelsorge und der Institution Kirche. So können wir unser Proprium im Konzert der Frage nach verantwortlicher Arbeit mit notleidenden Menschen und mit anderen Professionen verlieren. Das erweckt sicher zunächst den Eindruck eines weiteren Fachdiskurses. Jedoch sehe ich die größere Gefahr in einer pastoralpsychologisch und damit seelsorgetheologisch bedenklichen – weil nicht bedachten – Selbstidentifikation mit dem Helfermotiv, obwohl es für das christlich-kirchliche Handeln in Notfallsituationen in unseren Kirchen seelsorgetheologisch und pastoraltheologisch noch keinen Ankerpunkt gibt, entlang dem sich nach innen und nach außen dieses Tun – im Übrigen im Konzert mit anderem kirchlichen Tun – nachhaltig darstellt. Die Kritik aus der Praxis muss und soll diesbezüglich immer ein Stachel im Fleisch der Pastoraltheologie bleiben!