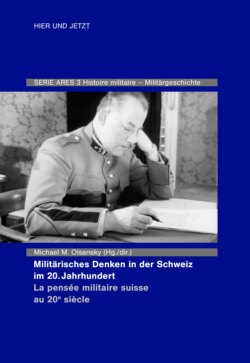Читать книгу Militärisches Denken in der Schweiz im 20. Jahrhundert La pensée militaire suisse au 20e siècle - Группа авторов - Страница 10
Kriegsfähigkeit als dominante Legitimation der schweizerischen Staatsexistenz
ОглавлениеFür die Entwicklung des schweizerischen Militär-, Kriegs- und Staatsverständnisses bedeutete die Rezeption von Elementen der idealistischen Staats- und Geschichtsphilosophie, wie sie in den Schriften von Rüstow und Rothpletz zum Ausdruck kamen, einen markanten Umbruch. Hans Wieland, der renommierte Adjunkt des Militärdepartements, schloss seine politisch-militärischen Studien zur schweizerischen Neutralität 1861 noch sehr zurückhaltend mit idealistischen Konstruktionen: «Niederlage ist Sieg […] und sichert unsere Existenz als Volk, als Staat.»27 Damit hat das Volk bewiesen, dass es schlagen kann und auch siegen könnte. Aymon de Gingins-La Sarraz verzichtete 1860 in seinen Gedanken zur Guerre défensive en Suisse auf jegliche staats- und geschichtsphilosophischen Überlegungen und ging ausschliesslich von einer wahrscheinlichen Bedrohung durch Frankreich aus.28 Nach 1870 fliesst die idealistische Kriegsdeutung zunehmend in die Militärdebatte ein und wird nach 1890 zum festen Bestandteil des Militärdiskurses. Als herausragende Beispiele können Texte von Ferdinand Affolter, Theophil von Sprecher und Felix Lüssy herbeigezogen werden, um die Umorientierung in den Köpfen der führenden Offiziere (Affolter und Sprecher) und des «unbekannten» Subalternoffiziers (Felix Lüssy) zu dokumentieren. Ferdinand Affolter dozierte von 1884 bis 1925 Militärwissenschaften an der ETH, Theophil von Sprecher war von 1905 bis 1919 Generalstabschef der Schweizer Armee, Felix Lüssy war ein akademisch gebildeter Leutnant, der 1909 brevetiert wurde.
Militärtheoretiker und Radikaler Exponent der «Neuen Richtung» im Fin de Siècle: Ferdinand Affolter (Bild: BiG).
Am engsten an das von Rüstow und Rothpletz verbreitete Verständnis von Krieg, Staat und Geschichte schloss Ferdinand Affolter an. Wie Rothpletz fasste er seine Vorstellungen über die Entwicklung der Milizarmee und des Kriegs in radikalisierten, absoluten Begriffen. Neben der totalen Mobilisierung aller gesellschaftlichen Ressourcen für den Krieg forderte Affolter eine wesentliche Dynamisierung des Führungsverhaltens der Offiziere. Affolter ging sogar unter Strapazierung der Staatsindividualitätslehre und des Existenztheorems so weit, die Steigerung der schweizerischen «Wehrkraft bis zum Äussersten» zu verlangen, um auf den Neutralitätsstatus verzichten zu können: «[D]ann wird unser Staat seine volle Individualität wieder erlangen und sich nach allen Seiten mit seiner vollen Thatkraft und That geltend machen, dann wird aus unserm politischen Wörterschatz das Wort ‹neutral› verschwinden.»29 Affolter war als Einziger bereit, die absoluten Begriffe von Individualität, Kampf, Existenz und Negation einzulösen und konsequenterweise auf die Neutralität zu verzichten und zu einer tief gehenden Restrukturierung der Milizarmee zu schreiten, wie sie Emil Rothpletz skizziert hatte: «Der Krieg einer entwickelten Nation kann nur ein Volkskrieg sein, ein Krieg, wo alle Kräfte eines Staates eingesetzt werden und eingesetzt werden müssen. Die Wehrkraft eines Volkes umfasst daher alle materiellen und geistigen Kräfte eines Staates, die immer nur für den hohen Zweck nutzbar gemacht werden können, und erscheint so als ein Produkt der Grösse der materiellen Mittel und der geistigen Willenskraft.»30 Neben der Instrumentalisierung der Schule aller Stufen für die Militärausbildung – hier deckt er sich mit den Vorstellungen der «radikalen» Armeereform um Bundesrat Welti – fordert Affolter eine grundlegende Umwandlung der militärischen Kaderausbildung in eine «Führer»-Erziehung – hier mit den Vorstellungen der «Neuen Richtung» um Ulrich Wille. Um die dynamisierten und verabsolutierten Vorstellungen des allgemeinen Volkskriegs, den agonalen Kampf um die Staatsexistenz zu operationalisieren, hält Affolter vor allem eine grundlegende Neugestaltung des Führerverhaltens und dessen Voraussetzungen, die Selektion, Ausbildung, Entwicklung und Formung des Offizierskorps für notwendig. Seine Vorstellungsbilder zur Reform des Offizierskorps entwickelt er an zwei Begriffen, die später zu Schlüsselbegriffen der Offiziersbildung werden: Männlich(keit) und Führer(tum). «Der Offizier in der Eigenschaft als Führer im Felde wie als Lehrer auf dem Exerzierplatz muss dem Soldaten als Inbegriff der Männlichkeit in allen Lagen des Lebens überhaupt und in denen des militärischen ganz besonders erscheinen. Es darf daher kein Mann zum Führer bestimmt oder als Führer gelassen werden, dem der leiseste Makel des Unmännlichen anhaftet.»31 Mit den Leitbildern «Männlichkeit» und «Führertum» lassen sich idealistisch und darwinistisch eingefärbte Machtstaatsvorstellungen individualisieren und in ein Erziehungsprogramm umsetzen.32 Eine zentralisierte, mit der militärischen Ausbildung aufs Engste verbundene «Staatsschule» soll die Wehrkraft bis aufs Äusserste steigern, und eine gestraffte, einheitliche Offiziersselektion und -ausbildung soll ermöglichen, eine militärische «Führerschaft» zu schaffen, die keinerlei politischen, regionalen, föderalistischen oder sozialen Einflüssen unterliegt. Die Vision der Bildung eines sozial und politisch autonomen, rein militärischen Führerkorps ohne staatsbürgerliche Bindung leitete Affolter. Die «Staatsform» soll bei der Schaffung von «Führern, die alle Attribute als solche besitzen», keinen Einfluss haben, sondern «nur der feste unabänderliche Wille, sich wehrhaft zu machen […], um im Momente der Gefahr auch wirklich wehrhaft zu sein».33 Der Krieg als Todeskampf um die staatliche Existenz des Volkes wird zum höchsten Orientierungspunkt aller staatlichen Institutionen und Massnahmen erhoben. Affolter verband damit ein ebenso militaristisches wie virilistisches Denken, das in den 1890er-Jahren Raum gewinnen und zu den zentralen Elementen des Neuen Geistes gehören wird.
Wie uneinheitlich und wie angelesen das Denken der führenden Offiziere der Schweizer Armee war, zeigt ein Vortrag von Theophil Sprecher von Bernegg, den er für eine Studentenkonferenz schrieb. Sprecher publizierte ausserhalb der militärischen Tagespolitik kaum. So war er gezwungen, «sich selbst einmal genau Rechenschaft zu geben über die Frage der Rechtmässigkeit von Waffendienst und Krieg vom Standpunkt der christlichen Gebote aus», als er 1911 die Einladung der Christlichen Studentenkonferenz annahm, um über «Militärwesen, Christentum und Demokratie» zu sprechen.34 Christlich und sozialistisch orientierte Studentenzirkel zweifelten in dieser Zeit den Sinn von Militär und Krieg grundlegend an. Entsprechend intensiv versuchte deshalb Sprecher, Militär und Krieg ethisch zu fundieren, und verstrickte sich dabei in weitläufige bellizistische Argumentationen. Seine Ausführungen stützte Sprecher auf Jähns (Krieg, Friede, Kultur), Kant, Ruskin, Treitschke, Moltke, Hamilton, de Maistre und Fichte. Sprecher glaubte, dass «Krieg sein wird und sein muss», machte aber geltend, dass «je seltener die Kriege werden», umso ernsthafter müssten sie vorbereitet werden, «damit Volk und Staat auch im Frieden Nutzen daran haben» und der Militärdienst nicht in eine kostspielige, trügerische Spielerei ausarte: «Immer mehr aber erkennt man der militärischen Ausbildung und Erziehung noch einen andern Zweck und Nutzen zu, den nämlich, die Mannschaft körperlich abzuhärten und zu kräftigen, namentlich aber in ihr den Sinn zu wecken und zu stärken für Disziplin, Gehorsam, Unterordnung unter die gesetzmässige Autorität, Aufopferung für die staatliche Gemeinschaft usw.»35 Die bellizistische Legitimation des Kriegs und die militaristische Legitimation des Militärs liessen sich zudem mit christlichen Vorstellungen untermauern. Die «höchsten christlichen Tugenden» können «im Kriege zur Entfaltung und Geltung» kommen: «Gehorsam und Treue bis zum Tode, Selbstverleugnung und Aufopferung, die vollständige Hingabe für das Vaterland und die Mitmenschen […]. Der Krieg ist dieser Welt so nötig, wie der Tod der sündigen Menschheit.»36 Diese äusserst stark bellizistisch orientierte Argumentation verstärkte Sprecher mit sehr zurückgenommenen machtstaatlichen Vorstellungen. Er schätzt zwar den Krieg als «Staatengründer» und «Staatenzerstörer» und gibt zu bedenken, «dass manch ein schönes, sein Volk beglückendes Staatswesen seine Regeneration oder gar seine Existenz» dem Krieg zu verdanken hat. Auch hier versucht Sprecher, christliche Gesichtspunkte einzubringen. «Fragen wir uns nur das eine, was aus der Reformation geworden wäre, wenn nicht edle Fürsten für die Gewissens- und Glaubensfreiheit gekämpft hätten?» Und weshalb «die christlichen Nationen guten Grund» haben, heute den Krieg vorzubereiten? «Einmal deshalb, weil das Erwachen der asiatischen Völker die christlichen Nationen vor die grössten kriegerischen Aufgaben stellen kann, wenn es nicht gelingt, diese Völker für das Christentum zu gewinnen.»37 Diese Argumentationen mussten jedoch selbst in den Ohren der Jungakademiker etwas weit hergeholt tönen. Im Zentrum des Denkens Theophil von Sprechers stehen klar bellizistische und militaristische Vorstellungen. Das immer wieder verwendete Moltke-Zitat «Ohne den Krieg würde die Welt im Materialismus versumpfen» durfte auch bei von Sprecher nicht fehlen.38
Auch Leutnant Felix Lüssy stellte diesen Gedanken an den Anfang seines Referates «Militärdienst in der Schweiz», das er im Rahmen der «Centraldiskussion» des Zofingervereins von 1912 hielt. Wie Sprecher sieht sich Lüssy herausgefordert, zur sozialistischen Kritik des Militärs und des Kriegs Stellung zu nehmen.39 Lüssy leitet dabei sein positives Bekenntnis zur «Notwendigkeit des Krieges» aus der Hegelianischen Staatsund Geschichtsphilosophie ab: Der Sinn des menschlichen Lebens sei die «Menschheitsentwicklung» zur Freiheit. Bewegendes Element dieser Entwicklung sei der physisch-geistige Machtkampf zwischen den zu staatlicher Souveränität und damit Individualität gelangten Völker. Jedem Volk komme eine ganz bestimmte Eigenart zu, welche die Nation in der Weltgeschichte zu verwirklichen, d. h. zu erkämpfen und durchzusetzen habe.
Vor dieser Gedankenfolie versucht Lüssy, die sozialistischen und bürgerlichen Friedenstheorien zu widerlegen. Der sozialistischen Idee des Klassenkampfs und der klassenlosen Gesellschaft hält Lüssy die reine inhaltslose Entwicklung der Individualität der Menschen und des Staates entgegen: «Nicht irgend eine Frage, nicht irgend eine Lösung, die Bewegung als solche ist Endaufgabe und Endziel zugleich.» Und diese «ewige Evolution und Revolution bedarf notwendig der grossen Krisen, die wir Kriege […] nennen». Denn jede «Bewegung, verdanke sie politischen, sozialen oder Rassenströmungen ihr Dasein, geht auf ihren Höhe- und Brennpunkten in Kampf um ihre Existenz, um Sein oder Nichtsein über» und dieser Todeskampf könne nur als Krieg ausgetragen werden.40 Daran änderten auch die Weltwirtschaft und die weltweiten Kommunikationsmöglichkeiten nichts. Die Internationalisierung der Wirtschaft sei lediglich «äusserlich übereinstimmende Betätigungsgestaltung innerlich verschiedener Individuen», und die «All-Einheit der Kulturgemeinschaft» und ihre völkerverbindenden Tendenzen hält Lüssy für ein «Hemmnis der Menschheitsbewegung»: «Die Erhaltung der Eigentümlichkeit seiner nationalen Kraft und Bildung ist für jedes Volk erste Pflicht: im Zusammentreffen der Völker ist das Ausleben und sich Durchsetzen nationaler Eigenkräfte stärkster Faktor der Weltentwicklung.»41 Getreu dem hegelschen Denkschema erkennt Lüssy die «Träger dieser gewollten Bewegung» in den «Staaten und Nationalitäten», um dann den Meister selbst zu paraphrasieren: «Die Weltgeschichte, die sich bestimmt nach dem Erfolg dieser Kämpfe von Tendenzen und Ideen, von Revolution gegen Tradition, von Expansionskraft gegen Senilität, ist das Weltgericht.»42 Vor diesem Hintergrund fällt es Lüssy leicht, das Konfliktlösungspotenzial des Völkerrechts und der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit zu erledigen: «Das Völkerrecht aber in die Kriege, in denen sich die Fortbildung der Weltgeschichte vollzieht, hineintragen zu wollen, wäre lächerlicher Traum.» Eine Nation, die zum Schiedsrichter läuft, wenn «Lebensfragen auf dem Spiele stehen», sei «entschieden dekadent», wie derjenige, der Kriege für ein «Übel» halte: «Nur diejenige (Nation), die in solchen Momenten fähig ist, alle Greuel und Schrecken eines Krieges entschlossen, ja in freudiger Bejahung, in einem aufjauchzenden Kraftgefühle auf sich zu nehmen, ist wert, weiter zu bestehen. Solche Kriege bedeuten […] eine Bereicherung des Menschenlebens und in der Auslösung seiner stärksten Potenzen eine Befreiung des Individuallebens.»43 Hier gelingt es Lüssy, die beiden Aspekte der hegelschen Kriegsphilosophie auf den Punkt zu bringen: den Todeskampf um die Individualität des (männlichen) «Bürgers», die im Todeskampf um die Individualität des staatlich verfassten Volkes aufgeht.
Seine tief hegelianisch eingefärbte Apologie des Kriegs bezieht Lüssy primär bei den zeitgenössischen deutschen Militärtheoretikern (Moltke, von der Goltz, Bernhardi, Freytag-Loringhofen und Jähns), aber auch bei Nietzsche, Stammler und Jellinek. Selbst Clausewitz’ Theorie der Kriegführung wird für eine vereinfachende geschichtsphilosophische Rechtfertigung des Kriegs vereinnahmt. Die einzig mögliche Textpassage in Vom Kriege – «Nur wenn Volkscharakter und Kriegsgewohnheit in beständiger Wechselwirkung sich gegenseitig tragen, darf ein Volk hoffen, einen festen Stand in der politischen Welt zu haben» – wird isoliert und als geschichtsphilosophische Fundamentalaussage verwendet.44 Clausewitz hat diese Aussage im Kapitel über die «Kühnheit» des Feldherren formuliert und zum Ausdruck bringen wollen, dass unter den modernen Verhältnissen der Wirtschaftsgesellschaft «die kühne Führung» des Kriegs notwendig sei, um den Geist des von Wohlstand und der «Weichlichkeit des Gemütes» geprägten Volkes zu beeinflussen und um ein Gleichgewicht von «Volkscharakter und Kriegsgewohnheit» herzustellen.45 Clausewitz postuliert die kühne Führung des Kriegs, um die von steigendem Wohlstand geprägten Wehrpflichtigen ohne «Kühnheit» mitzureissen. Einen Zusammenhang zwischen der militärischen Schulung der Völker und deren Bestand «in der politischen Welt» leitet Clausewitz weder an dieser noch anderen Stellen ab, entscheidend ist die kühne Kriegführung.46 Ähnlich wurden die Moltke-Worte «Der ewige Friede ist ein Traum und nicht einmal ein schöner» und «Wir können die Armee schon im Innern nicht entbehren für die Erziehung der Nation» beliebig als grosse Worte grosser Autoritäten eingesetzt. Neben diesen Konstruktionen, welche den Wert und die Existenzberechtigung des Individuums, des Volks und des Staates von der Probe eines möglichen Kriegs abhängig machten, mussten staatsrechtliche Normen und Kommentare zur Neutralität blass wirken und wurden als gut gemeinte akademische Konstrukte, «um die sich aber gegebenenfalls kein Mensch kümmern wird», beiseitegestellt.47
Die Darlegungen von Leutnant Lüssy zeigen, dass militaristische und bellizistische Ideenkomplexe nicht nur von Schlüsselpersonen der schweizerischen Armee vertreten wurden, sondern von der jungen Offiziersgeneration aufgenommen und weitertransportiert wurden. Als Folie des staats- und geschichtsphilosophischen Synkretismus in der Militärliteratur erscheint seit den 1860er-Jahren vermehrt der Ausdruck «Kampf um die Existenz». Eine Figur, die sozialdarwinistische und rassistische Konstruktionen vorwegnahm und sich dazu eignete, die Vorstellung des Vernichtungskampfs der Streitkräfte auf den Staat und auf das Volk auszudehnen.48
Die hier vorgelegten Beispiele und die Lektüre der Militärpresse des 19. Jahrhunderts lassen einige vorläufige Schlüsse zu. Bis zur Mitte des Jahrhunderts werden der schweizerische Nationalstaat und die schweizerische Milizarmee nur selten mit der idealistischen Nations-, Staats- und Kriegsdeutung in Bezug gesetzt. Johannes und Hans Wieland versuchen, die Legitimität schweizerischer Streitkräfte durch eine Theorie der bewaffneten Neutralität zu begründen. Die romantischen Vertreter der Volksbewaffnung äussern sich zu Staat, Geschichte und Streitkraft nur andeutungsweise, setzen jedoch Volk und Streitkraft gleich und orientieren sich an regenerierbaren Nationaleigentümlichkeiten der ethnisch-national definierten Völker.
Nach der Jahrhundertmitte fliesst bei den Vertretern der nationalen Milizarmee (Rüstow, Rothpletz, Welti) ein Staatsverständnis ein, welches an die idealistische Machtstaatstheorie anschliesst. Vieles spricht dafür, dass sie sich dabei von der Staatstheorie Lorenz von Steins beeinflussen liessen.
Auch in der schweizerischen Historiografie ist die Beobachtung zu machen, dass nach 1870 in der Alten Eidgenossenschaft des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts eine Grossmacht im Sinne Rankes gesehen wird und die Schweiz des späten 19. Jahrhunderts in Abhebung zur ehemaligen Grossmacht nun als Machtstaat von kleinem Format im europäischen Mächtekonzert definiert wird: als «trotz allem […] ernst zu nehmende Macht» soll die Schweiz erscheinen, die sich dem Existenzkampf um «Heil» oder «Untergang» zu stellen vermag.49
Unverkennbar ist seit den 1860er-Jahren auch in der Schweiz eine intensivierte Deutung militärischer Stärke und Kriegstauglichkeit zur Legitimation des staatlichen Souveränitätsanspruchs und eine Deutung des Krieges als Prüfung dieses Anspruchs zu beobachten. In den 1890er-Jahren ist jedoch eine Akzentverschiebung zu einer primär militaristischen Interpretation des Militärs und zu einer bellizistischen Sichtweise des Kriegs zu verzeichnen. Selbst Carl Hilty, Staatsrechtsprofessor und Oberauditor der Armee von 1892 bis 1909, der im Offizierskorps einen «Felsen» erblickte, an dem alle parteipolitischen Konflikte zerbrechen sollten, und im Militär «ein[en] ganz unentbehrliche[n] Theil der öffentlichen Erziehung unseres Volkes» sah, hatte bereits 1890 vor der Tendenz, dem «Krieg» einen «Selbstzweck» und ein «Eigenrecht» zuzuschreiben, gewarnt und feinfühlig den Vormarsch des «Kommandorechtes», der «militärisch nachgeahmten Disziplin» und «militärische(r) Auffassungen und Einrichtungen» im zivilen Leben konstatiert: «Ja selbst in den gewöhnlichen Sprachformen haben sich Ausdrücke eingebürgert, die aus dem Kasernenhofe stammen; ‹stramm› ist ein Wort geworden, das auf alle möglichen Verhältnisse angewendet wird, und ‹Schneidigkeit› ist längst nicht mehr das Privilegium des Kavallerieoffiziers. Ist dies im eigenen Lande schon so, so verkehren vollends die Völker eigentlich miteinander in den Formen des Kriegszustandes.»50 Die zunehmende Deutung des Kriegs als Bewährungsinstanz des einzelnen Milizsoldaten, der nationalen Streitkraft und des Staatsvolks erlaubte militärische Ausbildung und Erziehung losgelöst vom Status des Staatsbürgers zu denken und sich an einer imaginierten «Kriegstauglichkeit» zu orientieren, der, zunehmend abgehoben von der Entwicklung der Kampfführung und dem schweizerischen sozialen und politischen Kontext, eine gesellschafts- und geschichtsphilosophische Dimension beigemessen wurde. Mit dem Aufstieg der Richtung des «Neuen Geistes» um Ulrich Wille seit den 1890er-Jahren sollte dieses Denken in der Schweizer Armee kurz vor dem Ersten Weltkrieg dominant, wenn auch nicht hegemonial werden.