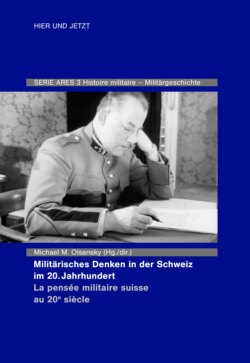Читать книгу Militärisches Denken in der Schweiz im 20. Jahrhundert La pensée militaire suisse au 20e siècle - Группа авторов - Страница 18
Enfant terrible
ОглавлениеFritz Gertsch als Oberstdivisionär, 1918 (Bild: Graphische Sammlung, Schweizerische Nationalbibliothek).
Fritz Gertsch (1862-1938) gehörte um die Jahrhundertwende zu den umstrittensten Offizieren der Schweizer Milizarmee. Als menschenverachtender Soldatenschinder verschrien, als streitlustiger Militärpublizist über die Landesgrenzen hinaus bekannt, sorgte der umtriebige Instruktionsoffizier zeitlebens für Aufsehen und Unruhe im schweizerischen Offizierskorps. Er exponierte sich schon früh als harscher Kritiker der etablierten Ausbildungs- und Gefechtskonzepte und forderte eine Anpassung des für die Schweizer Milizarmee typischen republikanisch-egalitären Führungsund Erziehungsstils an denjenigen der damaligen Modellstreitkraft in Europa: die preussisch-deutsche Armee.
Gertsch stammte aus einfachen Verhältnissen, als gelernter Hutmacher ohne nennenswerten Bildungsabschluss stellte er sich den Rekrutierungsbehörden in Bern. Seine Talente liessen ihn aber rasch die militärische Karriereleiter emporsteigen. Bereits mit 24 Jahren wurde er als junger Hauptmann für die Generalstabsschule I aufgeboten. In der intellektuell anspruchsvollen und herausfordernden Generalstabsausbildung geriet Gertsch allerdings erstmals an die Grenzen seiner intellektuellen Fähigkeiten. Er musste sich schmerzlich eingestehen, dass er für generalstäbliche Arbeiten nicht besonders begabt war. Stabsarbeiten, die für gewöhnlich stark theorielastig waren und ein grosses Mass an analytischem Denken voraussetzten, gehörten nicht zu seinen Stärken – auch später nicht, weshalb er bis zum Ende seiner Karriere eine tiefe Abneigung gegen die «Theoretiker» und das «Professorentum» im Generalstabsbüro hegte. Die Schlussqualifikation des Kurskommandanten der Generalstabsschule I und späteren Generalstabschefs, Arnold Keller, fiel entsprechend zwiespältig aus: «Schwach, eignet sich sehr gut zum Truppenoffizier».2 Gertschs militärische Fähigkeiten hätte man kaum pointierter umschreiben können, als es Keller tat. Gertsch konnte zwar in der Generalstabsarbeit nicht überzeugen, seinen Vorgesetzten gefiel er aber als willensstarker und schneidiger Offizier, der sich bei der Truppe durchsetzen konnte und dessen Eignung zum Truppenführer ausser Diskussion stand.
In Anbetracht seiner kurz aufeinanderfolgenden Karriereschritte kann angenommen werden, dass Gertsch dem soldatischen Handwerk sehr zugetan war und in ihm schon früh der Wunsch reifte, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen und sich ganz dem Dienst in Uniform zu verschreiben. So überrascht es nicht, dass er noch im selben Jahr nach der Absolvierung der Generalstabsschule ins Instruktionskorps übertrat.
Im Instruktionsdienst eckte Gertsch allerdings schon früh an. Behutsames Vorgehen lag ihm nicht. Eine Affäre jagte die andere, eine Kampfschrift folgte der anderen. Launisch, ungehobelt und enorm stur – so das nicht gerade schmeichelhafte Bild, welches Zeitgenossen von ihm zeichneten. Mit seiner unversöhnlichen Art verstrickte er sich in zahllose Streitigkeiten mit Vorgesetzten, Unterstellten und Freunden. In Offizierskreisen und in der Öffentlichkeit wurde deshalb regelmässig seine Entlassung aus der Instruktion gefordert. Stets konnte er aber seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, nicht zuletzt dank der starken Rückendeckung seines Mentors und Förderers Ulrich Wille. Mitte der 1890er-Jahre lernte er den charismatischen Waffenchef der Kavallerie und späteren Oberbefehlshaber der Schweizer Armee im Ersten Weltkrieg kennen – eine schicksalhafte Begegnung. Fortan fand Wille in Gertsch einen von tiefer Loyalität beseelten Jünger, der im Gleichschritt mit ihm einer strengen soldatischen Erziehung das Wort redete.
Gertschs unbedachter Opfermut und seine von der Presse als «Gertschiaden» etikettierten schikanösen Instruktionspraktiken trieben ihn letzten Endes aber in den Abgrund. Der Abstieg des hitzköpfigen Wille-Protegés nahm in den Jahren 1910/11 seinen Anfang. Zuerst musste er wegen einer Pressepolemik als Brigadekommandant zurücktreten, kurz darauf wurde er infolge einer erbitterten Auseinandersetzung mit dem Chef der Generalstabsabteilung, Theophil Sprecher von Bernegg, als Instruktionsoffizier entlassen.3 Im abschliessenden Urteil hiess es: «Er hat bei seinem masslosen, krankhaft gesteigerten Selbstgefühl den Begriff der Unterordnung verloren.»4 Auf ausdrücklichen Wunsch Willes wurde Gertsch zu Beginn des Ersten Weltkriegs zwar wieder als Brigadekommandant reaktiviert und mit der 1917 erfolgten Beförderung zum Oberstdivisionär sogar in den erlauchten Kreis der allerhöchsten Truppenführer, der Heereseinheitskommandanten, aufgenommen; doch der neuerliche Karriereschub war nur von begrenzter Dauer. Von Neuem wurden Klagen über seinen übertriebenen Exerzierdrill laut, die im Herbst 1918 in einer parlamentarischen Interpellation mündeten.5 Durch einen Bundesratsbeschluss wurde Gertsch im Januar 1919 schliesslich von seinem Kommando enthoben und bis zu seiner endgültigen Entlassung aus der Wehrpflicht im Juni 1926 zur Disposition gestellt.6 Als Privatmann betätigte er sich danach unermüdlich als Militärpublizist, manövrierte sich aber mit seiner Auffassung, die Schweizer Armee sei in eine «Maschinengewehrarmee» umzuwandeln, im dominanten Militärdiskurs zusehends ins Abseits. Dem nicht genug, musste er sich bis zu seinem Lebensende mit ernsthaften Geldsorgen herumschlagen, obschon er in zweiter Ehe ein vermögender Mann geworden war.7
Es ist jedoch nicht primär diese von Affären, Enthebungen und Comebacks gekennzeichnete militärische Laufbahn Gertschs, die eine historische Auseinandersetzung mit ihm rechtfertigen würde. Sein persönliches Leben ist zu ereignisarm, und überdies auch quellenmässig zu wenig dokumentiert. Was ihn hingegen interessant macht, ist die Position, die er als umtriebiger Offizier im schweizerischen Militärwesen in der Zeit vor und während des Ersten Weltkriegs einnahm. Er gehörte im Kontext des Richtungsstreits im Offizierskorps zu den wichtigsten Akteuren und den profiliertesten Militärpublizisten. Keiner benannte die Adaptionsprobleme der schweizerischen Milizarmee an die rasante Gefechtsfeldentwicklung schonungs- und taktloser als er. Der besagte Richtungsstreit um die Neuorientierung der Milizarmee war zudem begleitet von medienwirksamen Affären, zahlreichen persönlichen Auseinandersetzungen und einer Reihe von öffentlich diskutierten Disziplinarverfahren, von denen ein nicht geringer Teil auf Gertsch entfiel.