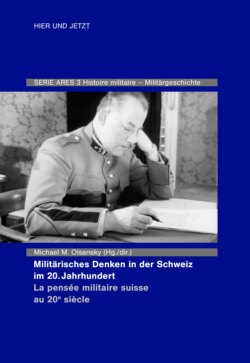Читать книгу Militärisches Denken in der Schweiz im 20. Jahrhundert La pensée militaire suisse au 20e siècle - Группа авторов - Страница 8
ОглавлениеDie Art, wie Militär und Krieg von einzelnen herausragenden Schweizer Offizieren gedeutet wurden, veränderte sich im Lauf des 19. Jahrhunderts grundlegend. Das Denken über Militär und Krieg nahm zunehmend eine geschichts-, staats- und gesellschaftsphilosophische Orientierung an, welche in den beiden letzten Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg zunehmend auf die Ausbildung der Milizsoldaten und -offiziere einwirkte. Im Folgenden wird das schweizerische militärische Denken anhand der wichtigsten Publizisten diachronisch erörtert.
Die Deutung von Militär und Krieg stellte sich für die Träger der schweizerischen Staatlichkeit seit dem Beginn der frühneuzeitlichen Staatsbildung anders dar als für die Mehrzahl der Träger der europäischen Herrschaftsverbände, welche dem monarchischen Absolutismus unterworfen waren. An der absolutistischen Kriegführung hatte sich die Eidgenossenschaft lediglich als «neutrale» frühneuzeitlich-staatliche Vermittlungs- und Approbationsstelle privat finanzierter und organisierter Solddienstunternehmen beteiligt. Die primär für die Lokalverteidigung vorgesehenen und für die Aufrechterhaltung der Herrschaft über die eigenen Territorien verwendeten Milizorganisationen der einzelnen eidgenössischen Orte wurden von der Militärkritik der Aufklärung zwar immer wieder als alternatives Streitkräftekonzept zu den stehenden, monarchisch-absolutistischen Soldheeren und ihrer Kriegführung dargestellt. Der Schweiz fehlte aber am Ende des Ancien Régime nicht nur die Einheit der Staatspersönlichkeit und der ethnisch-kulturellen Nation, sondern auch die Einheit des Heeres, obwohl die aufklärerischen Visionen auch die Bildung einer nationalen Streitkraft einschlossen.2
Im Gegensatz zur Mehrzahl der europäischen Nationalstaaten war die moderne Schweiz auch nicht eine Kriegsgeburt: weder als gewaltvoller revolutionärer Aufbruch gegen die eigenen und fremden monarchischen Herrschaftsträger wie in Frankreich noch als Befreiungsakt gegen die imperiale Herrschaft Napoleons wie in Preussen-Deutschland, Spanien oder England. Die Schweiz verdankte ihre Existenz nach 1814 den europäischen Grossmächten, welche an der Weiterexistenz der Eidgenossenschaft ein Interesse hatten. Die militärisch-nationale Selbstdarstellung und die Kriegsdeutung konnten im 19. Jahrhundert in der Schweiz nicht direkt an Befreiungs- oder nationale Einigungskriege anschliessen, sondern musste in die Vergangenheit und Zukunft und damit auf die Ebene der Historiografie und der Geschichtsphilosophie ausweichen. Einesteils wurde auf die erfolgreichen Schlachten der Gründungs- und Wachstumsphase der Eidgenossenschaft zurückgegriffen, andernteils die idealistische Staats- und Geschichtsphilosophie und ihre Kriegstheorie benutzt, um die nationalstaatliche Entwicklung der Schweiz zu fundieren. Dieses geschichtsphilosophische Konzept hatte den Vorteil, Höhepunkt (1515), Niedergang (Ancien Régime) und Wiederaufstieg (1830/1848) des schweizerischen «Volkes» mit der vernunft- und fortschrittsorientierten Volksund Weltgeisttheorie zu verbinden. Während sich die Vertreter der Volksbewaffnung statisch-rückwärtsgerichtet am Vorbild der alten Eidgenossen orientierten, beriefen sich die Vertreter der nach dem europäischen Standard der Kampfführung ausgerichteten Milizarmee mehr und mehr auf das Fortschrittskonzept der idealistischen Staats- und Geschichtsphilosophie. Nach 1830 waren es deutsche liberale Emigranten wie der an der Berner Hochschule und an der Zentralschule Thun als Professor für Militärwissenschaften lehrende Rudolf Lohbauer, welche dem nationalen Militär der Schweiz eine idealistische Theorie vermittelten. Die Schweiz solle sich nicht dem «Naturalismus der Landesverteidigung durch die local zerstreute Menge» anvertrauen, sondern «dem eigenen Geiste seiner Nationalität, mit dem ganzen Beruf seiner Geschichte und der Bedeutung seines Volks in der Weltgeschichte» folgen, damit «der Geist das Schwert ergreifen und zum Streit und Siege lenken» könne.3 Demgegenüber hatten die Romantiker Zschokke und von Tavel in ihren Schriften auf eine explizite Deutung des Krieges verzichtet: Krieg erscheint implizit als natürlicher Vorgang unter den Völkern, deren Mitglieder auch über natürliche kriegerische Anlagen verfügten.4 Die Aktivierung der populären und gelehrten Überlieferung des Kriegertums der Alten Eidgenossen erlaubte, Orientierung für eine Wiedergeburt schweizerischer kriegerischer Tugenden zu gewinnen. Die Romantiker befassten sich vornehmlich mit der zugeschriebenen natürlichen kriegerischen Begabung der Schweizer und ihrer möglichen Anwendung in der Kriegführung. Auch ihr Widersacher, Johannes Wieland, ein Vertreter regulärer Kampfführung, konzentrierte sich vollständig auf die Mittel der Kriegführung. Als deren Zweck erscheint bei ihm neben der Bewahrung der Unabhängigkeit, Integrität und Ehre des schweizerischen Staates in prononcierter Weise die bewaffnete Verteidigung der schweizerischen Neutralität. Die militärische Verteidigung des von den Grossmächten garantierten neutralen Territoriums der Schweiz wird von Wieland in paradigmatischer Weise ausgeführt.5 An einer einzigen Stelle schlägt Wieland einen beinahe geschichtsphilosophischen Ton an, wenn er zur «Widerlegung des Wahnes, dass eine kraftvolle Einrichtung des Wehrstandes in der Schweiz nutzlos sey», ansetzt. Den «schwache(n) Theil unserer Nationalstellung» erblickt er im politischen Unwillen, die Unabhängigkeit der Schweiz zu verteidigen, und warnt davor, sich erneut auf die Gnade der Grossmächte zu verlassen: «Zweimal ist die Schweiz gefallen und durch fremden Machtspruch gerettet worden […]. Entweder wir bestehen die Probe, und wir sind ehrenvoll auf lange Zeit gerettet; oder wir wiederholen das traurige Schauspiel schweizerischer Zwietracht vom Jahr 1798 […], so wie das vom Jahr 1813 […] und dann ist die Eidgenossenschaft aufgelöst.» Die Schlussfolgerungen aus den Niederlagen von 1798 und 1813 sind angesichts der historischen Tatsachen keineswegs zwingend. Wieland übergeht den historischen Kontext der Existenz der Schweiz und unterwirft sich der Deutung des Krieges als Prüfungsinstanz nationalstaatlicher Existenzberechtigung: «Nachdem sie dreimal der Welt ihr Unvermögen vor Augen gelegt haben wird, mit eigenem Schwerdt die Unabhängigkeit zu behaupten, muss sie, und mit Recht, Schuld und Schmach des Untergangs an sich selbst tragen.»6 Diese Aussage steht bei Wieland singulär da. Es gibt keine weiteren Formulierungen in seinem Werk, die auf die Rezeption eines geschichtsphilosophischen Konzeptes schliessen lassen.