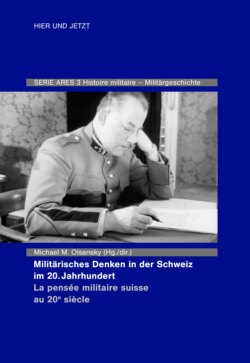Читать книгу Militärisches Denken in der Schweiz im 20. Jahrhundert La pensée militaire suisse au 20e siècle - Группа авторов - Страница 19
Disziplin und Appell
ОглавлениеDer junge Gertsch trat 1886 just in einer Zeit in den Instruktionsdienst ein, als sich infolge einer gespannten geopolitischen Lage und angesichts einer gewandelten Kriegführung auf einem stetig anspruchsvoller werdenden Gefechtsfeld die Anforderungen an die Armee und ihre Führung dramatisch veränderten. Der mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit fortschreitende Innovationsschub in der Waffentechnologie, der wiederum tief greifende Auswirkungen auf die gebräuchlichen Kampfformen und die Truppenausbildung hatte, stürzte die Armee in eine tiefe konzeptionelle Krise. In der Folge bildete sich im Offizierskorps eine Reformbewegung heraus, die in Anbetracht der gestiegenen Komplexität und Brutalität des Gefechtsfelds die betont zivilistische, dem «soldat citoyen» angemessene Ausbildung als völlig untauglich beurteilte. In Anlehnung an die preussisch-deutsche Modellstreitkraft und nachhaltig beeinflusst durch das Schriftgut des Kavallerie-Waffenchefs Ulrich Wille erblickten diese Offiziere insbesondere in der Stärkung der Offiziersautorität und der bedingungslosen Subordination des Soldaten den Schlüssel zum Erfolg. Sie beabsichtigten daher, das republikanisch-egalitäre Verhältnis von Mannschaft und Führung neu zu definieren. Doch die implizite Vorbildfunktion der deutsch-kaiserlichen Armee mit ihren strengen Exerzierformen trug dieser sogenannten «Neuen Richtung»8 wiederholt den Vorwurf einer «Verpreussung» der Schweizer Armee ein.9 Ferner wurden die Anhänger des von Wille initialisierten «Neuen Geistes» infolge ihres überaus selbstbewussten Auftretens und ihrer kleidsam geschneiderten Uniformen wiederholt als «Gigerln» oder «Gockel» etikettiert und gleichzeitig beschuldigt, einen fremdländischen Geist in die Armee eingeschleppt zu haben.
Dass Gertsch schon früh vom «Neuen Geist» im Offizierskorps erfasst wurde, zeigt sich in seiner 1889 von der Offiziersgesellschaft preisgekrönten Schrift Die Ausbildung des Schweizerischen Infanterieoffiziers und die Forderung der Gegenwart.10 Darin propagierte er das Konzept des strengen und eindrucksvollen Offiziers, der seine Unterstellten sicher und energiegeladen zu Soldaten erzieht und von ihnen jederzeit – sei die Lage auch noch so prekär – bedingungslosen Gehorsam abfordern kann. In solchen imponierenden Offizieren erblickte er das probate Rezept, um die im Vergleich zu den stehenden Heeren Europas kurzen Ausbildungszeiten hinreichend zu kompensieren. Denn «eine richtige soldatische Schule muss also auch der Schweizer durchmachen, soll er ein brauchbarer Wehrmann werden. […] Ohne Disziplin keine Armee.»11 Sein Aufsatz war keineswegs nur das zufällige Erzeugnis eines mit einem ausgeprägten Disziplinverständnis veranlagten Instruktionsoffiziers. Die Schrift war ein unverkennbares Produkt der seit den 1880er-Jahren herrschenden Malaise in der schweizerischen Gefechts- und Truppenführung.
Dass Gertsch seine alternativen Ausbildungsmodelle auch konsequent umzusetzen gedachte, wurde schon kurz nach Veröffentlichung seiner Preisschrift evident. Seine geltungssüchtigen, despotischen Marotten und seine schikanösen Exerzier- und Disziplinierungspraktiken, die auf die Integrität der kantonalen Milizen keine Rücksicht nahmen, führten zu diversen Anklagen durch die Presse und zu anschliessenden Protesten in der Öffentlichkeit gegen einen angeblich grassierenden Militarismus im Offizierskorps. Aber anstatt sich ruhig zu verhalten und zuzuwarten, bis wieder Ruhe in den Blätterwald und der Bevölkerung eingekehrt wäre, entschied sich Gertsch, eine Abhandlung mit dem Titel Disciplin! oder Abrüsten!12 zu verfassen. In dieser äusserst polemischen Streitschrift sprach er der Armee ihre Kriegsbereitschaft ab und bezeichnete sie als «nicht feldtüchtig». Seines Erachtens fehlte dem Schweizer Milizheer zur «Feldtüchtigkeit» aber nicht etwa modernste Bewaffnung oder eine noch grössere Truppenstärke, sondern primär Soldatendisziplin («Appell») und Offiziersautorität («Adresse»). Diese beiden Prämissen identifizierte er als die zentralen Faktoren zur Überwindung der personellen und materiellen Inferiorität der Schweizer Armee im Vergleich zu den grossen stehenden Heeren der Nachbarländer.13
Ätzende Kritik an Gertschs Erziehungsmethoden: «Schweizerische Militärdressur nach idealem Muster» (Bild: Der neue Postillon, Dezember 1898, S. 1).
Die Resonanz auf sein Pamphlet war beeindruckend, wenngleich das Medienecho mehrheitlich aus Häme und Kritik bestand. Spätestens jetzt war Gertsch der bekannteste Soldatenschinder des Landes und der Inbegriff für das im Offizierskorps angeblich grassierende «Preussentum». Seine Forderungen nach einem neuen Offiziersstandesbewusstsein und einer strengen soldatischen Erziehung stiessen inner- wie ausserhalb des Offizierskorps auf grossen Widerstand. Namhafte Persönlichkeiten aus Politik und Armee veröffentlichten scharfe Repliken und wiesen die Unterstellung, die Schweizer Armee sei kriegsuntauglich, entschieden zurück. Die von Gertsch nach preussisch-deutschem Leitbild gedrillten Soldaten würden nicht der allgemeinen Anschauung des uniformierten Schweizer Bürgers, der – obschon im Wehrkleid – primär Staatsbürger bleibt, entsprechen, sondern vielmehr an mechanische Puppen, das Spottbild preussischer Soldaten, erinnern. Selbst der Vorsteher des Militärdepartements, Bundesrat Emil Frey, sah sich nach einer Interpellation der nationalrätlichen Geschäftsprüfungskommission genötigt, zur «Broschüre Gertsch» Stellung zu nehmen. Vor dem Plenum gestand er vorderhand ein, dass es Mängel im schweizerischen Heerwesen gäbe, doch er war nicht bereit, sich für die inhumanen Disziplinierungs- und Erziehungspraktiken Gertschs einnehmen zu lassen, und betonte, auch weiterhin auf die traditionelle, freiwillige Disziplin der Milizen zu vertrauen.14
Unterstützung erfuhr Gertsch für seine Anschauungen in nur sehr geringem Ausmass. Freilich verfügte die Neue Richtung bereits über einige Parteigänger im Offizierskorps, vorab unter den jungen Instruktionsoffizieren, doch keiner von ihnen wollte sich in der diffizilen Disziplinfrage allzu stark exponieren und damit seine Militärkarriere nachhaltig gefährden. Eine prominente Ausnahme blieb der Kavallerie-Waffenchef Ulrich Wille, der in Gertsch seinen publikumswirksamen Reformator gefunden zu haben schien und sich öffentlich für den viel gescholtenen Infanterieinstruktor einsetzte. Die Begegnung mit dem charismatischen Wille sollte sich für Gertsch als der entscheidende Wendepunkt in seinem Leben herausstellen. Fortan fand Wille in Gertsch einen treuen Anhänger, um nicht zu sagen einen ergebenen Jünger, der ihn in seinen Bemühungen hinsichtlich einer soldatischen Erziehung der Schweizer Milizen tatkräftig und bedingungslos sekundieren sollte.