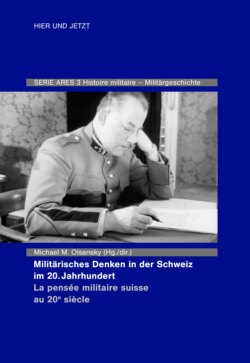Читать книгу Militärisches Denken in der Schweiz im 20. Jahrhundert La pensée militaire suisse au 20e siècle - Группа авторов - Страница 21
Maschinengewehrarmee
ОглавлениеMit der Wahl Ulrich Willes zum Oberbefehlshaber der Armee am Vorabend des Ersten Weltkriegs befand sich die Neue Richtung auf dem Höhepunkt ihrer jahrelangen Bemühungen um Einfluss und Gewicht in der Schweizer Armee. Als General – ausgestattet mit weitreichenden Befugnissen – scharte Wille seine engsten Gefährten um sich und beorderte zu diesem Zweck auch seinen langjährigen Protegé, den unlängst in Ungnade gefallenen Gertsch, zurück an die Spitze einer Brigade. In den ersten beiden Jahren nach Gertschs Reaktivierung blieb es sehr still um das einstige Sorgenkind des Militärdepartements – für aufsehenerregende Affären waren vorerst noch andere besorgt. Doch mit seiner Ernennung zum Kommandanten der 3. Division erregte er umgehend wieder die Aufmerksamkeit der Presse. Er sollte die Geister, die er einst rief, nicht mehr loswerden. Das Medienphänomen des «Sching Hung» Gertsch hatte sich über die Jahre hinweg sukzessive verselbständigt und ihm damit jede Handlungsfreiheit und Glaubwürdigkeit genommen. Er, das landesweite Sinnbild für das «Preussentum» im Offizierskorps, hatte überhaupt keinen Einfluss mehr darauf, wie ihn die Presse sah und darstellte. Rasch wurden Parlamentarier aus Kantonen, aus denen die 3. Division ihre Truppen alimentierte, hellhörig für Klagen über den Führungs- und Erziehungsstil des neuen Kommandanten.
Nach dem landesweiten Generalstreik und der anschliessenden Demission Willes kam Gertschs erneute Kommandoenthebung somit keineswegs überraschend. Der Bundesrat enthob ihn Anfang 1919 von seinem Kommando der 3. Division und versetzte ihn gemäss Artikel 51 der Militärorganisation zu den zur Verfügung des Bundesrats stehenden Offizieren, wo er bis zu seiner endgültigen Entlassung aus der Wehrpflicht im Juni 1926 eingeteilt blieb.24 Gertsch zog sich daraufhin mit seiner gut situierten Frau auf ein kürzlich erstandenes Schloss mitsamt Rebberg bei Neftenbach im Zürcher Weinland zurück, um als Gutsherr seinen Lebensabend zu verbringen. Wenn der Bundesrat und die Öffentlichkeit aber dachten, sie hätten das letzte Mal von ihm gehört, dann hatten sie sich getäuscht.
Schon bald trat Gertsch mit einer radikalen Theorie der Umwandlung der Armee in ein mit Tausenden von Maschinengewehren ausgerüstetes Infanterieheer in Erscheinung. Die Feuergeschwindigkeit und die hohe Präzision des Maschinengewehrs hatten ihm schon auf dem südmandschurischen Kriegsschauplatz imponiert, doch erst mit dem Stellungskrieg an der Westfront des Ersten Weltkriegs sollte ihn die beeindruckende Kampfkraft dieser Schnellfeuerwaffe nicht mehr loslassen. Er war der festen Überzeugung, dass das Maschinengewehr zur wichtigsten Waffe des Weltkriegs geworden war und erkannte in ihm die einzige Möglichkeit, die im Vergleich zu den Millionenheeren und den gewaltigen Rüstungsanstrengungen der Grossmächte bescheidenen finanziellen und personellen Ressourcen des Kleinstaats Schweiz kompensieren zu können. Daher konnte er nicht verstehen, weshalb das Maschinengewehr in der Schweizer Armee nur als eine Unterstützungswaffe zum Einsatz kam. Anstatt der Infanterie noch weitere Maschinengewehre in Form von Spezialtruppen anzugliedern, forderte Gertsch, dass die gesamte Infanterie zu einer eigentlichen Maschinengewehrtruppe umgewandelt werden müsse. Die Divisionen seiner Maschinengewehrarmee sollten anschliessend an der Landesgrenze in einer imposanten Breitengliederung von Dutzenden von Kilometern die gegnerischen Kräfte am Eindringen hindern.25
Nebst seinen Maschinengewehrtruppen sah Gertsch in der von ihm konzipierten zukünftigen Armee nur ganz wenige andere Waffengattungen vor. So hatten einzig die Luftwaffe und eine stark begrenzte Anzahl an Kavalleristen, Telegrafisten, Sanitäter, Rad- und Motorlastwagenfahrer sowie – kurioserweise – das Militärspiel (Militärmusik) noch eine Daseinsberechtigung.26 Die restlichen Truppengattungen wie Artillerie, Genie oder leichte mechanisierte Verbände wollte Gertsch ersatzlos streichen. Überdies liess er insbesondere an den Unterstützungstruppen wie dem Trainwesen («diese unversiegbare sprudelnde Quelle von Ärger und Unruhe und Störung des Diensts») oder den Büroordonanzen («die Zahl dieser gewohnheitsmässig zu Bureaudienern entwürdigten Schweizer Krieger geht in die vielen Hunderten») kein gutes Haar. Diese Funktionen würden der Armee, so Gertsch unmissverständlich, nur die waffenfähigen Wehrmänner entziehen und sollten – wenn überhaupt – ausschliesslich durch Landsturm- und Hilfsdienstpflichtige wahrgenommen werden.27
Gertschs Aussagen mögen auf den ersten Blick die Vermutung nahelegen, dass ihm die zahlreichen waffentechnologischen Entwicklungen des Ersten Weltkriegs völlig entgangen wären. Dies war allerdings nur zum Teil der Fall. Er gestand dem Kampfpanzer (Tank) und der schweren Artillerie durchaus deren herausragende Bedeutung in einer mechanisierten Kriegführung zu, doch waren sie für ihn gleichzeitig auch Sinnbild eines langjährigen verheerenden Stellungskriegs,28 den die Schweiz niemals führen dürfe.
Die zugegebenermassen etwas skurrile Theorie der Umwandlung des Schweizer Milizheers in eine nahezu reine Maschinengewehrarmee erregte zu Beginn noch für Aufsehen und sorgte für entsprechende Kritik in den einschlägigen Fachblättern.29 Mit der Zeit wurde Gertsch aber nicht mehr für voll genommen, zumal seine Konzepte auch nicht bis ins letzte Detail durchdacht waren. So tauchen wiederholt Widersprüche und Lücken in seiner Argumentation auf. Gertsch hatte beispielsweise in keiner seiner Schriften zur Maschinengewehrarmee den Fall erörtert, wie er weit ins Land eingedrungene mechanisierte Verbände ohne eigene Kampfpanzer zurückzuwerfen gedenke. Er wollte der Schweiz zwar einen erstarrten Grabenkrieg nach dem Muster der Westfront des Ersten Weltkriegs ersparen, doch was er mit seinen Maschinengewehrtruppen plante, war im Grunde genommen nichts weiter als ein verkappter Stellungskrieg: Die gesamten Verteidigungskräfte der Schweizer Armee wären an der Grenze konzentriert und höchstwahrscheinlich aufgrund des gegnerischen Artilleriefeuers ebenfalls in Schützengräben eingegraben gewesen. Ein durchgebrochener Gegner hätte demzufolge die Niederlage der gesamten Armee bedeutet.
Als er wiederholt kein Gehör für seine unkonventionelle Theorie einer Maschinengewehrarmee fand und man ihn stattdessen ignorierte, verstieg sich Gertsch in seiner wachsenden Verbitterung in immer extremere Aussagen. Von Schrift zu Schrift forderte er mehr Maschinengewehre. Am Ende waren es 12 000 Stück, die nach seinen Berechnungen eine «Kampfkraft von zwölftausend Kompanien, dreitausend Bataillonen, tausend Regimentern»30 entfalten und die Schweiz auf einen Schlag zur «stärksten Militärmacht»31 erheben würden.
Letzten Endes manövrierte er sich aber mit seinen immer extremeren Konzepten zur Umwandlung der Schweizer Armee in eine reine Maschinengewehrarmee zusehends ins soziale Abseits. Am Ende überwarf sich Gertsch auch mit jenen, die noch zu ihm hielten. Er entschlief schliesslich verlassen und verarmt in seinem 77. Altersjahr in Bern.