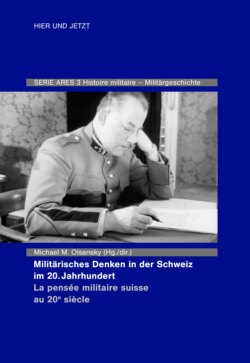Читать книгу Militärisches Denken in der Schweiz im 20. Jahrhundert La pensée militaire suisse au 20e siècle - Группа авторов - Страница 6
Einleitung
ОглавлениеDer friedlichen Geschichte der modernen Schweiz ist es zu verdanken, dass sich Militärhistoriker hierzulande eher mit militärischem Denken auseinandersetzen als mit militärischem Handeln. Dabei bezog und bezieht sich das Denken über Militär bei Weitem nicht nur auf die Innenmechanismen und Organisationseigenheiten des sozialen Subsystems Militär und seines Instruments, der Schweizer Armee. Vielmehr widmete es sich gerade den Abhängigkeiten und Wechselwirkungen von Militär und Krieg, Militär und Bedrohung sowie von Militär und Gesellschaft. Was Militär sein soll, wie Militär sein soll, welche Rolle der Krieg als politisch-gesellschaftlicher Ausnahmezustand dem Militärischen zukommen lässt und welche Bedeutung die Schweizer Gesellschaft dem Militär zugestehen will, sind integrale Fragen der Pensée militaire. Glücklicherweise denken dabei nicht nur Militärs über Militär nach. Aber es gab sie, die Militärs, die über Militär nachdachten, oftmals Milizoffiziere, aber auch stets jener Teil des hierzulande kleinen militärischen Berufsstands, der seinen Expertenstatus denkend und schreibend zur Geltung zu bringen vermochte. Wobei zu hoffen ist, dass er das auch künftig noch kann.
Der vorliegende Band 3 der SERIE ARES widmet sich dem militärischen Denken in der Schweiz des 20. Jahrhunderts. Ursprünglich als Tagungsband zum wissenschaftlichen Symposium «La pensée militaire suisse de 1800 à nos jours» in Pully (VD) im Jahr 2012 gedacht, entschied sich die Schweizerische Vereinigung für Militärgeschichte und Militärwissenschaften (SVMM/ASHSM) nachträglich dazu, auf eine breite, teilweise aber etwas dünn bohrende Tour d’Horizon über die letzten 217 Jahre zu verzichten und die Herausgabe einer aufs 20. Jahrhundert beschränkten Beitragssammlung ins Auge zu fassen. Der Entscheid hierzu war, angesichts der Forschungslücken, die auch dieser Band nicht schliessen wird, rückblickend sicher richtig. Zugleich ermöglichte es diese Fokussierung des Untersuchungszeitrahmens, der themenspezifischen Forschung der letzten zwei Dekaden Raum zu geben bzw. Teile ihrer Resultate zu präsentieren. Diese Forschung wurde, wenn natürlich nicht ausschliesslich, so aber doch wesentlich von Rudolf Jaun – mittlerweile emeritierter Titularprofessor für Geschichte der Neuzeit und Militärgeschichte an der Universität Zürich – und seinem «akademischen Harst» von ca. 50 Doktoranden und Lizentianden vorangetrieben. Einige Autoren der hier abgedruckten Beiträge sind denn auch aus dieser «Jaun-Schule» hervorgegangen, inspiriert von dessen für die Erforschung des Schweizer Militärs im 20. Jahrhunderts wegweisenden Arbeit über den Richtungsstreit in der schweizerischen Militärelite am Ende des Fin de Siècle. Jauns Habilitationsschrift Preussen vor Augen steckte mit der Untersuchung der Auseinandersetzung über die staats- und gesellschaftspolitische Positionierung des Militärs in der Schweiz den Rahmen ab, wie Anfang des 20. Jahrhunderts über Militär gedacht und gesprochen wurde. Die beiden Lager des Richtungsstreits – die «Neue Richtung» um den Soldatenerzieher und späteren Weltkriegsgeneral Ulrich Wille und die «Nationale Richtung» um eine Offiziersgruppe mit national-republikanischem Militärideal – dachten unterschiedlich über das Verhältnis von Nation und Armee sowie von Volk und Armee, dachten anders über den Offizier, über den Soldaten, hatten unterschiedliche Ansichten über die Organisation des Militärapparates, die militärische Kräfteverwendung im Kriegsfall sowie über die Ausbildung und zu beschaffende Rüstungsgüter. Ein grosser militärischer Themenkatalog also, der zu bedenken war, und bezeichnenderweise sollte sich das im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts nicht grundsätzlich ändern. Es stellt sich diesbezüglich auch die wichtige Frage nach Kontinuitäten und Brüchen. Etliche Schweizer Militärhistoriker teilen heute die Auffassung, dass sich der Richtungsstreit im Sinne einer longue durée durch das 20. Jahrhundert zieht. Andere sind zurückhaltender und verweisen auf Ungereimtheiten und Bruchstellen. Von zentraler Bedeutung scheint es hier, die Inhalte der sich gegenüberliegenden Denkschulen idealtypisch und dergestalt mit einer sensoriellen Akzeptanz von Abweichungen und Alternativpositionen zu verstehen. Ausserdem scheint es angezeigt, Denkschulen und Personengruppen nicht per se gleich-, sondern in Beziehung zueinander zu setzen. So ist die «Nationale Richtung» als agierende Personengruppe nach dem Ende des Ersten Weltkriegs quasi verschollen, jedoch sind ihre Diskursstränge noch da. Die «Neue Richtung» wiederum, die den Richtungsstreit gewann, pflanzte sich mit Wille-Schülern der zweiten, dritten etc. Generation personell noch Jahrzehnte fort, was jedoch nicht bedeutet, dass sich ihre Denkinhalte nicht teilweise verändert bzw. ihre Aussagemuster nicht verschoben haben. Ein entscheidender Einflussfaktor hat aber durch das 20. Jahrhundert hindurch Kontinuität: Es gibt ausserhalb bzw. um das hiesige Schweizer Militär herum eine Entwicklung des Kriegs und minimal eine Idealentwicklung modernen Militärs. So wie sich das Gesundheitswesen entwickelt, so wie sich die Wissenschaft entwickelt, entwickelt sich im europäisch-westlichen Kontext auch staatlich organisiertes Militär, und dieser Idealentwicklung kann sich das schweizerische Militär selten verschliessen. Die internationale Militärentwicklung, in den Beiträgen dieses Bands häufig als Mainstream bezeichnet, wird in der Neuzeit von unterschiedlichen pacemaker-Nationen vorangetrieben. War es in der napoleonischen Zeit das französische Militär, das die Mainstreamentwicklung vorangetrieben hatte, waren es später das preussische und das deutsche Militär, das selbst nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg seinen Nimbus als Experte nicht abgeben musste. Erst mit der totalen Niederlage im Zweiten Weltkrieg verlor das deutsche Militär seine Position, Militär und militärische Kräfteverwendung idealtypisch weiterzuentwickeln; abgelöst wurde es im europäisch-westlichen Kulturkreis von den US-amerikanischen Streitkräften. Diese grossen Organisationen hatte das schweizerische Militär stets im Auge zu behalten, wenn es darum ging, sich selbst weiterzuentwickeln. Natürlich veränderte und verändert sich Militär hierzulande auch entlang konkreter schweizerischer Parameter, jedoch verstanden es in der Vergangenheit genug kluge Köpfe – wie die Beiträge in diesem Band zeigen –, die internationale Militärentwicklung zu verfolgen. Diese Idealentwicklung aus politischen Motiven zu ignorieren, führte dagegen meistens zu militärischem Rückstand und einem langfristigen Adaptionsstau.
Rudolf Jaun eröffnet diesen Band mit einem Beitrag über die unterschiedlichen Kriegs- und Militärdeutungen in der Schweiz des 19. Jahrhunderts und den daraus hervorgehenden, bereits erwähnten Richtungsstreit im Schweizer Offizierskorps. Sein zweiter Beitrag befasst sich mit dem militärischen Denken Ulrich Willes, des bis heute wichtigsten Impulsgebers für die Entwicklung der Schweizer Armee. David Rieder beschreibt auf der Basis seiner Dissertation das militärische Denken Fritz Gertschs, ein Radikaler unter den Wille-Gefährten mit einem guten Auge für die Evolution des modernen Kriegs, jedoch etwas eigenen Vorstellungen zum Idealumgang mit militärisch Unterstellten. Es folgt ein Beitrag des Herausgebers zu Ulrich Wille d. J., dem Sohn des Weltkriegsgenerals, einem voll in der Tradition seines Vaters stehenden Soldatenerzieher und hervorragenden Taktiker, der mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nicht nur wegen seiner Affinität für das deutsche Militär politisch sukzessive ins Abseits glitt. Andreas Rüdisüli fragt sodann nach einer «Pensée militaire romande», die er auf der Basis seines Dissertationsprojekts auf ihren staatspolitischen Kerngedanken hin untersucht. Peter Braun liefert im Weiteren mit einem Beitrag zur Herkunftsgeschichte der am Konzeptionsstreit hauptsächlich beteiligten Offiziere eine Skizze der erneuten Lagerbildung im Schweizer Offizierskorps nach 1945, um dann in einem anderen Beitrag sich explizit mit Alfred Ernst, dem Kopf des reformorientierten Lagers zu befassen. Der Herausgeber befasst sich darauf mit dem operativen und taktischen Denken von Hans Senn und Frank Seethaler, zwei äusserst beeindruckenden Exponenten einer neuen Schweizer Offiziersgeneration, deren militärisches Denken ganz wesentlich an ausländischen Führungsakademien geprägt wurde. Dominique Juilland beschäftigt sich mit Roger Mabillard, dem ihm persönlich sehr gut bekannten ehemaligen Ausbildungschef der Schweizer Armee in den 1980er-Jahren, der sich mit seinem Ruf nach mehr Kriegshärte in der Ausbildung der Schweizer Armee öffentlich nicht nur Freunde machte. Nach einem Beitrag Rudolf Jauns zum operativen Querdenker Alfred Stutz analysiert Jens Amrhein das Denkens des Militärintellektuellen, Offiziers und Publizisten Gustav Däniker d. J. Die Reise dieses Buches durch das hiesige militärische Denken im 20. Jahrhundert schliesst ein Beitrag Christian Bühlmanns zur jüngsten Militärentwicklung ab. Er konstatiert am Ende des 20. Jahrhunderts eine Stagnation des militärischen Denkens in der Schweiz, das aufgrund der Dominanz rein innenpolitischer Parameter geistig zu veröden droht und, von der internationalen Militärentwicklung abgekapselt, sich zusehends um sich selbst dreht.
Der vorliegende Band der SERIE ARES sucht den Zugang zum militärischen Denken in der Schweiz des 20. Jahrhunderts vor allem über militärische Denker. Forschungsstand und überliefertes Schriftgut führten wesentlich zu den hier vorgelegten Beiträgen. Selbstverständlich hätten es andere Köpfe ebenfalls verdient gehabt, in diese Darstellung aufgenommen zu werden. Das militärische Denken von Offizieren wie Julien Combe, Hans Frick, Samuel Gonard, Georg Züblin, Robert Frick, Jörg Zumstein oder Josef Feldmann harren ihrer Untersuchung. Es bleibt angesichts des aktuell deplorablen Zustands der Militärgeschichte an den Schweizer Universitäten zu hoffen, dass sich junge Historikerinnen und Historiker diesen Herausforderungen künftig noch stellen. Auch der SVMM steht diesbezüglich durchaus in der Verantwortung.
Michael M. Olsansky