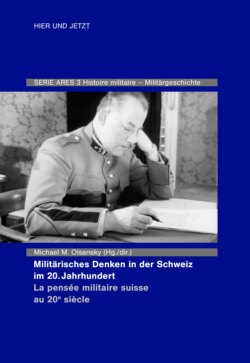Читать книгу Militärisches Denken in der Schweiz im 20. Jahrhundert La pensée militaire suisse au 20e siècle - Группа авторов - Страница 20
Kriegsberichterstatter und die Lehren aus dem Russisch-Japanischen Krieg
ОглавлениеAls am 9. Februar 1904 die Welt vom Überfall der Japaner auf Port Arthur vernahm, ersuchte Gertsch noch am selben Tag um Abkommandierung als Militärbeobachter auf den ostasiatischen Kriegsschauplatz. Die Kriegsteilnahme war für ihn eine einmalige Chance, die es zu ergreifen galt. Der eskalierende Konflikt zwischen zwei modern ausgerüsteten und gut ausgebildeten Armeen bot ihm nicht nur die Möglichkeit, erstmals Kampfhandlungen aus nächster Nähe mitzuerleben, sondern auch die lang ersehnte Gelegenheit, seine über die Jahre entwickelten Kampf- und Erziehungskonzepte unmittelbar am Kriegsgeschehen zu überprüfen. «Der Krieg zwischen Russland und Japan», hielt Gertsch in seinem Gesuch an den Waffenchef der Infanterie fest, «wird in Anbetracht der Organisation, Bewaffnung und Ausbildung der beiden beteiligten Heere für jede moderne Armee so lehrreich werden wie seit 1870 kein Krieg mehr war. Ich glaube, dass da gerade auch für unsere Armee so wertvolle Beobachtungen gemacht werden können, dass es sich reichlich lohnte, einen oder zwei Offiziere auf den Kriegsschauplatz zu entsenden.»15 Er sollte mit seiner kühnen Prognose recht behalten. Am Ende des Russisch-Japanischen Kriegs wurden die Reglemente aller Heere – auch diejenigen der Schweizer Armee – umgeschrieben und angepasst. Der Bundesrat – sich der Tragweite des Konflikts durchaus bewusst – folgte dem Ansinnen Gertschs umgehend und entsandte Ende Februar eine vierköpfige Mission in beide Heerlager in Ostasien: Zusammen mit dem Kavallerieinstruktor Richard Vogel wurde Gertsch zur japanischen Armee abkommandiert.16
Nach zahlreichen Gefechten und verschiedenen Schlachten kehrte Gertsch reich an Erlebnissen und Erfahrungen vom mandschurischen Kriegsschauplatz in die Schweiz zurück. Von den Russen war er in Übermassen enttäuscht. Wo immer sie sich dem Gegner entgegenstellt hätten, seien sie mit verhältnismässig geringer Mühe zurückgeschlagen worden. Und selbst wenn sie in der Übermacht gewesen seien, seien sie von den Japanern schliesslich niedergerungen worden. Den Grund für diese desolate Vorstellung der russischen Armee erblickte er in erster Linie in den unfähigen Offizieren und den schlecht ausgebildeten Soldaten. Weiter prangerte er die in geschlossenen Formationen vollzogenen Bajonettangriffe der russischen Verbände an, die in keiner Weise den militärtechnologischen Umwälzungen der letzten Jahrzehnte Rechnung tragen würden: «Bis zum letzten Tage wurde überall nach dem ewig gleichen, öden Schema gekämpft: schwache Feuerlinie, starke Reserven, Gegenangriff mit dem Bajonett, wenn die Feuerlinie zurückgeschlagen war. Die vielen, vorher erlebten Misserfolge hatten die Russen nicht zu der Erkenntnis zu bringen vermögen, dass die Reserven zum Feuern eingesetzt werden müssen, oder eine Schwächung der Gefechtskraft bedeuten. Diese Gegenangriffe geschlossener Reserven, mit dem Bajonett, sind ja die unbegreiflichsten aller sonderbaren Erscheinungen dieses Kriegs.»17
Die Japaner hingegen hatten ihn mit ihrer ausgeprägten Todesverachtung und eindrucksvollen Tapferkeit vollauf begeistert. Den Grund für den hohen Ausbildungsstand der Truppe sah er im exzessiven Einsatz von Drillübungen: «Die Japaner drillen tüchtig. Bessere und gleichmässigere Haltung habe ich nie gesehen. Auch nie glattere Gewehrgriffe. Der Paradeschritt war nach unsern Begriffen schlecht, nicht lang genug und mit dem Fuss nicht nahe genug über den Boden hinweg. Aber er war kräftig und von einer Exaktheit, die gar nichts zu wünschen übrig liess.» Die Japaner hätten «von ihrem Ratgeber [den Deutschen – d. A.] gelernt, dass minuziöser Straffheit, als Selbstzweck gepflegt, eine tief gehende Wirkung als Mittel zur Erziehung von Gewissenhaftigkeit und von zuverlässiger Pflichttreue innewohne. […] Das war übrigens dieselbe Erscheinung wie im deutsch-französischen Kriege. Wie dort die Deutschen, so konnten 1904 auch die Japaner gar nicht anders als tapfer sein, weil sie durch straffe Schulung zu exakter Arbeit und damit zu gewissenhafter Pflichterfüllung erzogen waren.»18
Die Schweizer Beobachter – insbesondere die beiden Offiziere im japanischen Heerlager – hatten im Laufe ihrer Mission genügend Erkenntnisse und Eindrücke gesammelt, um nach ihrer Rückkehr in die Schweiz die Reformdebatte nachhaltig zu befruchten. Dabei wurden nicht nur taktische Fragen über Schützenlinien, Artillerieangriffe und Nachtgefechte eifrig diskutiert, sondern auch neue Ausbildungs- und Erziehungskonzepte erörtert. Die Grundlehren, die man aus dem Krieg in Fernost für das Schweizer Heerwesen gezogen hatte, flossen nacheinander in die revidierte Militärorganisation von 1907, ins neue Exerzierreglement für die Infanterie von 1908 sowie in die neue Truppenordnung von 1911 ein. Die theoretische Auseinandersetzung mit den Erfahrungen aus dem Russisch-Japanischen Krieg verlief jedoch alles andere als reibungslos. Schuld daran waren vor allem Dissonanzen in den höchsten Kreisen des Schweizer Offizierskorps – Unstimmigkeiten, an denen Gertsch nicht ganz unbeteiligt war.
Gertsch wollte seine Erlebnisse und Erfahrungen nicht wie die anderen Schweizer Beobachter bloss dem Militärdepartement vorlegen. Vielmehr beabsichtigte er seine Theorien mit einer gross angelegten Publikation – sie sollte am Ende auf zwei Bände anwachsen – einer breiten Leserschaft zugänglich zu machen. Er erhoffte sich dadurch nicht zuletzt eine Stärkung seiner Autorität als militärischer Fachmann. Sein Schlusszitat: «Möge es mir gelingen, in meinem Lande Gehör zu finden!», bewahrheitete sich mehr, als ihm lieb war – allerdings nicht in seinem Sinne. Gertsch verwickelte sich nach Veröffentlichung seiner Bände in heftige Auseinandersetzungen – unter anderem mit dem Generalstabschef Theophil Sprecher von Bernegg –, die ihn schliesslich seine Anstellung als Instruktionsoffizier kosten sollte.
Stein des Anstosses war das Schlusskapitel des zweiten Bands, in welchem Gertsch seine Erkenntnisse aus dem fernöstlichen Kriegsgeschehen zusammenfasste und daraus teilweise sehr umstrittene Schlüsse für das schweizerische Heerwesen zog. Seine Kernaussage war, dass die gebräuchlichen Formen des Kampfes an die Eigenschaften moderner Waffen angepasst werden müssen. Hiervon war Gertsch felsenfest überzeugt und postulierte daher eine «lichte» Schützenlinie, die in ihrem Aufbau nicht starr, aber auch nicht zu locker sein dürfe: «Die Schützenlinie muss deshalb mit Zwischenräumen von ein bis zwei Schritt gebildet werden. […] So gebildet, hat die Schützenlinie die grösster Feuerkraft. Es gibt keine andre Formation, die ihr an Kampfwert auch nur annähernd gleichkäme. Vor ihr brechen dichtere Schützenschwärme oder gar Massen rettungslos zusammen.» Die Idee von der Stosskraft dichter, geschlossener Truppenkörper entspreche dagegen mittelalterlichen Vorstellungen.19
Mit einem System von kleinen und grossen Reserven hinter den Schützenlinien seien die Russen den Japanern entgegengetreten und «wurden von deren geschmeidigen, reinen Schützenlinien durch die Mandschurei hindurchgejagt».20 Für Gertsch hatte diese – in der Schweiz vor allem bei Manövern praktizierte – «Reserventaktik» mit ihrer starren Tiefengliederung mit dem Russisch-Japanischen Krieg endgültig ausgedient.21 Es sei eine Kampfweise, die den anhaltenden militärtechnologischen Fortschritt und die damit einhergehende Steigerung der Waffenwirkung nur noch unzureichend berücksichtige.
Gertschs Idee einer aufgelockerten und breit gegliederten Schützenlinie als Kampftechnik sine qua non stellte an die Truppenausbildung indessen eine paradoxe Anforderung: Einesteils sollten die Soldaten befähigt werden, selbstständiger und verantwortlicher zu handeln, gleichzeitig musste ihr Gehorsam aber noch disziplinierter sein, damit sie sich auch unter den schwierigsten Verhältnissen und ohne unmittelbaren Kontakt mit einem Vorgesetzten in dessen Sinn verhielten. Dies war für Gertsch jedoch kein unüberwindbarer Widerspruch. Er erblickte im rein formalen Erziehungsdrill ein probates Mittel, um den Soldaten bedingungslose Subordination und zugleich taktische Disziplin zu internalisieren. Auf diese Weise rückte der Erziehungsdrill in den Mittelpunkt der soldatischen Ausbildung. Die Schulung des Soldaten zum tapferen und taktisch gewandten Kämpfer, so Gertsch, «ist die stolze und schöne, aber auch alleinige Aufgabe der Rekrutenerziehung und der elementaren Weiterbildung des Soldaten. Was dabei sonst noch nebenherläuft, ist an und für sich nichtig und muss dem grossen Zwecke ebenfalls dienstbar gemacht werden.»22
Die Theorie einer lichten, aufgelockerten Schützenlinie war für die damalige Zeit geradezu revolutionär. Deshalb musste er sich auch zahlreiche Anfeindungen gefallen lassen. Doch blind vor Überzeugung, seit seiner Rückkehr aus der Mandschurei eine unantastbare Autorität in Fragen der taktischen Gefechtsführung geworden zu sein, erkannte er nicht, dass genau diese kompromisslose Haltung ihn angreifbar machte. Je mehr er sich in seinen Kriegslehren angegriffen fühlte, desto unversöhnlicher bezog er Position und umso kämpferischer gab er sich seinen Gegnern gegenüber – auch gegenüber militärischen Vorgesetzten. Dies konnte nicht lange gut gehen, und so wurde er 1910 zuerst von seinem Brigadekommando enthoben und 1911 infolge einer in den Zeitungen ausgetragenen Auseinandersetzung mit dem Chef der Generalstabsabteilung, Theophil Sprecher von Bernegg, aus dem Instruktionsdienst entlassen.23