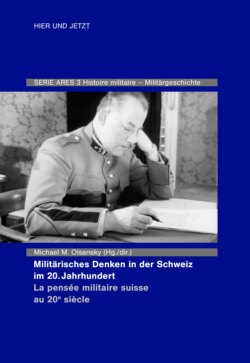Читать книгу Militärisches Denken in der Schweiz im 20. Jahrhundert La pensée militaire suisse au 20e siècle - Группа авторов - Страница 9
Im Banne der Staats- und Geschichtsphilosophie des deutschen Idealismus: Wilhelm Rüstow und Emil Rothpletz
ОглавлениеIn den 1860er-Jahren traten jedoch mit Wilhelm Rüstow und Emil Rothpletz zwei Militärpublizisten auf, welche die Staats- und Geschichtsphilosophie des deutschen Idealismus auf die Schweiz übertrugen und die Entwicklung des schweizerischen Nationalstaates und seiner Streitkraft mit der idealistischen Kriegsdeutung verbanden. Beide waren «1848er»: Rüstow war ein preussischer Offizier, der 1850 eine Schrift mit dem Titel Der deutsche Militärstaat vor und während der Revolution geschrieben hatte, in der er das stehende Heer als Instrument der Unterdrückung und Unfreiheit geisselt. Rüstow wurde darauf wegen Hochverrats verurteilt, entzog sich jedoch nach einem halben Jahr Festungshaft der Strafe und flüchtete in die Schweiz.7 Der Schweizer Milizoffizier Rothpletz hatte sich als Student 1848 an den Barrikadenkämpfen in Berlin beteiligt. Er ist dem politischen Aargauer Radikalismus zuzurechnen.8 Rüstow entfaltete in der Schweiz eine reiche militärpublizistische Tätigkeit. Rothpletz trat Ende der 1860er-Jahre mit seiner Anleitung zum militairischen Denken und Arbeiten: die Schweizerische Armee im Feld hervor. Beide aspirierten auf den 1874 neu geschaffenen Lehrstuhl für Militärwissenschaften an der ETH, den Rothpletz 1878 definitiv erhielt, worauf sich Rüstow erschoss. Rothpletz bekleidete den ETH-Lehrstuhl bis 1897.
Mit dem aus Preussen exilierten, linksliberalen Rüstow war ein herausragender militärtheoretischer Kopf in die Schweiz gekommen. Rüstow musste von der Feder leben, was seine publizistische Produktion enorm steigerte. Daneben gelang es ihm jedoch nicht, eine kontinuierliche Verwendung als Instruktor und Militärsachverständiger der schweizerischen Milizarmee zu erlangen. Neben Abhandlungen zum schweizerischen Wehrwesen verfasste Rüstow historische und militärtheoretische Werke sowie Kommentare zu den europäischen Kriegen vom Krimkrieg bis zum Ersten Balkankrieg. In seinen allgemeinen militärtheoretischen Büchern befasst sich Rüstow nicht nur mit «Kriegführung», sondern auch mit «Kriegspolitik» und der «Stelle des Krieges in der Weltordnung». Nach Lohbauer, der kaum publizierte, leistete Rüstow mit seinen zahlreichen Publikationen einen herausragenden Beitrag zur Deutung des Kriegs aus der Sicht der liberal-demokratischen Republik.
Weggefährten und Konkurrenten, Offiziere und militärische Denker: Emil Rothpletz und Wilhelm Rüstow (Bilder: BiG).
Rüstow arbeitete in seinen Betrachtungen über den «Krieg», vor dem Hintergrund der Konstruktion des physisch-geistigen Machtkampfs der staatlich verfassten Völker, dessen Natur- und Kulturorientierung heraus. «In der Natur ist nun eine Erscheinung, welche sie vollständig durchdringt, der Kampf, das ewige Verändern der Formen, Vergehen und Entstehen, das Werden […]. Den Krieg aber, welchen die Menschen untereinander führen, dürfen wir mit Recht als eine besondere menschliche Form jenes allgemeinen Werde-Kampfes in der Natur hinnehmen, mit um so grösserem Recht, da der Mensch, wie vernunftbegabt er sein möge, ausserdem auch ein sinnliches Wesen ist und dadurch der Naturgeschichte verfällt, unter den allgemeinen Naturgesetzen steht.»9 Revolution und Krieg würden die «schadhaften Theile der Maschine» zusammenschlagen und sie durch neue ersetzen, «und bald geht das Werk wieder rüstig seinen ruhigen Gang».10 Rüstow nannte diese Betrachtungsweise in Abgrenzung zur militärischen Strategie «Allgemeine Kriegspolitik oder politische Strategik». Während es die Aufgabe der militärischen Strategie war, «eine Anzahl zu gewinnende Schlachten zweckmässig (zu) verknüpfe(n)», erhob sich darüber «eine höhere, die Politische Strategik, welche die Kriege eines Volkes wiederum dermassen verknüpft, dass ihre gesamte Reihe dem Staate zu Macht und Grösse in der von Natur gegebenen Richtung, zur Erfüllung der Mission des Volkes verhelfe und ihn in jedem Momente vor dem Falle bewahre».11 Kriege spielten sich im Bereich des natürlich-physischen Kampfes ab, dort, wo «Neues und Schönes» aus der Vernichtung des «Alten und Faulen» entstand. Der Krieg ist aber auch die Grundlage der Staatsexistenz. Mittels Krieg begründen Fürsten und Völker Staaten, und mittels Krieg bewahren sie ihre unabhängige Staatsindividualität. Erst auf der Basis von «Macht und Grösse» könne ein Volk seine «eigene weltgeschichtliche Mission» erfüllen und seine «Volkskraft» bzw. seinen Volksgeist weiterentwickeln und Teil der Weltgeschichte werden.12 Vor der Folie der Dialektik von physischem und geistigem Kampf wird der Krieg zu etwas Notwendigem – zu einem Instrument, das prinzipiell auf Sieg auszurichten ist, aber immer auch das Moment der Niederlage und des Verlusts der staatlichen Individualität bzw. Existenz eines Volks in sich trägt.
Es ist im Rahmen dieses Beitrags nicht möglich, die Wirkungsgeschichte Rüstows auf das schweizerische Militärdenken umfassend zu untersuchen. Es ist aber davon auszugehen, dass er sowohl auf die «Nationale Richtung» im Offizierskorps (Welti, Fisch, Gutzwiller, Hungerbühler) wie auf die Offiziere der «Neuen Richtung» (Affolter, Wildbolz, Wille) einen erheblichen Einfluss ausübte.13 Rüstows Einfluss auf seinen Weggefährten und Konkurrenten Emil Rothpletz ist jedoch formell und inhaltlich belegbar. Rothpletz nennt Rüstow neben Clausewitz, Jomini und Willisen in seiner Anleitung zum militärischen Denken und Arbeiten ausdrücklich als Autorität der Kriegswissenschaft.14
Rothpletz bemerkt zu Beginn seines Werks, dass er nicht immer mit den «Meistern unserer Kriegsliteratur» übereinstimme und dass dies daher rühre, weil «er zum ersten Mal die Theorie des Krieges vom rein republikanischen Standpunkt aus behandle». Auf die Schweizer Armee bezogen, traf dies sicher zu. Allgemeiner gefasst, kam dieser Anspruch Rüstow zu, auf den sich Rothpletz stützte. Neu war auch, dass eine für die Schweizer Armee im Felde geschriebene Anleitung zur Hälfte «Vom Kriege» handelte und sich dabei «absoluter» Begriffe bediente.15 Rothpletz entwickelte wie Rüstow seinen Kriegsbegriff am Hegelianischen Kriegsbegriff, der zwei Lesarten zuliess.16 Die eine Lesart erblickte im Krieg ein Mittel, die Männer der bürgerlichen Gesellschaft, welche im Schutz des konstitutionellen Staates ihren persönlichen Nutzen maximierten, kollektiv zu Tapferkeit und Entbehrung zu erziehen und den Tod und die Vernichtung von Hab und Gut fühlen zu lassen. Das andere, von Rothpletz herausgestrichene Moment sah im Krieg primär ein geschichtsnotwendiges Mittel, um die Anerkennung und Selbsterhaltung des Staates zu sichern. In der Sichtweise des Radikalismus mussten die «Bürger» der Schweiz nicht mittels Militär und Krieg zu Soldaten gemacht werden. Das selfgovernment der Schweizer Staatsbürger bildete die Basis der Miliz. Rothpletz stellt den Zusammenhang von Staatsexistenz und Krieg ins Zentrum seiner Abhandlung über den «absoluten» Krieg: «Die Existenz eines Staates ist gegenüber den andern Staaten und gegenüber seiner eigenen Bevölkerung eine Frage der Macht […]. Das letzte Mittel der Lösung der Machtfrage ist die Gewalt. Der Krieg ist das stärkste und äusserste Mittel der Politik – er ist der Kampf um die Existenz.»17 Die republikanische Staatsexistenz wird als Form der Entwicklung des Volksgeists begriffen und der lediglich mit physischen Mitteln geführte Krieg im Vergleich zu dem mit den Mitteln der «Volkskraft» geführten Krieg als sekundär dargestellt. Wie ein für das Auge unbeweglicher Gletscher arbeite der Volksgeist: «[A]lles scheint geistiges Leben und organische Form, bis im nächsten Augenblick die herrlichen Gebilde in der unaufhaltsamen Wucht der von blinden Kräften bewegten Masse verschlungen werden, aus der neue Gestalten zum neuen Untergang sich erheben, so arbeitet die Volkskraft, die selbst wieder ein Product des Kampfes um die Existenz ist.»18 Kriege müssten deshalb zur rechten Zeit und als «gerechte Volkskriege» ihren «Ursprung» nehmen, sonst arbeite der beste General umsonst: «Staaten im Verfall, so lehrt die Geschichte alter und neuer Zeit, erfechten selten oder keine fruchtbaren Siege […]. Der Krieg als blosse siegreiche Schlächterei ist für die Zukunft werthlos, nur der Kampf als Mittel der Politik eines lebensfähigen Staates bringt den erfolgreichen Sieg […].»19 Krieg ist für Rothpletz Kampf um den Sieg und zugleich Kampf um die Staatsexistenz: Vor dem Hintergrund dieser existenziellen Kriegsdeutung lehnt er eine Unterscheidung von strategischer Verteidigung und strategischem Angriff ab.
Um diese Vorstellungen mit der Schweiz in Bezug zu setzen, musste einiger theoretischer Aufwand getrieben werden. Wegen der Schwäche und Kleinheit des schweizerischen Staates, und weil das Volk darauf eingeschworen sei, müsse die Neutralität aufrechterhalten und allenfalls ein «gerechter Volkskrieg» gegen monarchische Übergriffe geführt werden. Immerhin schliesst Rothpletz eine Allianz mit einem republikanischen Staat «von gleicher moralischer Grundlage» nicht aus und hofft zumindest im Bedrohungsfall auf einen solchen Bündnispartner, ohne dass «die kleinlichen nichtssagenden Bedenken der Neutralitätspolitik» dies verhinderten. Auch sinniert er darüber nach, dass die Schweiz in den Grenzen des Ancien Régime «ein mächtiger und kein neutraler Staat» wäre. Er tröstet sich aber mit der Gewissheit der Entwicklungsfähigkeit des schweizerischen Volksgeistes darüber hinweg: «Solange die Republik lebenskräftig nach immer grösserer Vervollkommnung ihrer sittlichen Grundlagen strebt, kann ihr die Neutralität auch nicht an Einfluss und Ansehen schaden.»20
Die Fixierung auf die absolute Begrifflichkeit des militärischen Siegs und des Kriegs als Todeskampf um die staatliche Existenz erforderte eine gewaltige Dynamisierung der Humanressourcen der republikanischen Miliz. In der Vision von Rothpletz soll die militärische Qualifizierung der männlichen Bevölkerung in die zivile Ausbildung und ins zivile Sozialleben integriert werden. Mit dem Schuleintritt beginnt auch die militärische Ausbildung. Die Rekrutenschule zum Zeitpunkt der politischen Mündigkeit soll lediglich als «Prüfung und als Repetitorium der elementarwissenschaftlichen und der militairischen Arbeit der Jugendzeit» und als «Übergang vom Spiele der Jugend zu dem Ernst der Kriegstüchtigkeit» dienen.21 An den höheren Schulen, eingeschlossen die Hochschulen, sollen militärische Pflichtvorlesungen eingeführt werden, um die Unteroffiziere und Offiziere auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Zudem sollen die Schützen-, Jäger-, Turner- und Bergsteigervereine und ihre eidgenössischen Zentralfeste zur «nationalen Erziehung» herbeigezogen werden.22 Am Lebensende erhalte der ältere, zum Felddienst nicht mehr verwendbare Mann die Aufgabe, die militärische Erziehung des nachkommenden Geschlechtes zu überwachen und für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Innern des Landes besorgt zu sein: «Grundsätzlich ist auf diese Weise das ganze männliche Geschlecht von der Jugend bis zum Alter in steter Beziehung zum Kriege».23 Die Frauen gelten als die «vegetative, der Natur zugewandte Seite des Menschengeschlechts». In Hinsicht auf den existenziell aufgefassten Krieg ist den Frauen aufgegeben, «ein gesundes, kräftiges Geschlecht» zu erzeugen und Kranke und Verwundete zu pflegen: «Das Weib hat somit eine für den Krieg und die Zukunft des Vaterlandes höchst bedeutungsvolle, aber doch nur primitive Aufgabe.»24 Mit der Biologisierung der Frauen wird ihr Status auch für den Bereich des Staates und der Streitkraft auf die Rolle der gebärenden und fürsorgenden Mutter eingeschränkt.
Rothpletz entwarf sein Konzept der Militärrepublik in Abgrenzung zum monarchischen Militärstaat und seinem stehenden Konskriptionsund Söldnerheer. Wenn die militärische «Erziehung das ganze Menschenleben» umfasse und die Republik aus «einem Volk besteht, das den Pflug und die Waffe mit gleicher Leichtigkeit und Freude handhabt», dann sei die Republik «die wohl stärkere Kriegsbasis» und «der eigentliche Soldatenstaat».25 Rothpletz bezeichnete dies als «idealen Wunsch», welcher der «Wirklichkeit nur in geringem Masse» entspreche. Die Gefahr der Militarisierung und der Dominanz des Militärischen über das Zivilleben sah Rothpletz in der Tradition der liberalen Militärtheorie nur bei den stehenden Heeren der Monarchien, die über ein autonomes Militär verfügten. Sein «radikales», geradezu staatssozialistisch anmutendes Konzept hatte zusammen mit den Schriften von Wilhelm Rüstow eine nicht geringe Wirkungskraft: Es entsprach in grossen Zügen dem Ideengerüst des Entwurfs zur Armeereform von Bundesrat Emil Welti für ein neues Militärorganisationsgesetz aus dem Jahr 1868. Bundesrat Welti war ein grosser Anhänger des Einbezugs der Volks-, Mittel- und Hochschulen in die Militärausbildung und des militärischen Vorunterrichtes, der die Zeit zwischen Ende der Schulpflicht und Beginn der Wehrpflicht überbrücken sollte. In sehr abgeschwächter Form fanden einige Elemente (Vorunterricht, Militärwissenschaften an der ETH usw.) des freisinnig-radikalen Militärkonzepts Eingang in die Militärorganisation von 1874. Das Konzept diente der «Nationalen Richtung» im schweizerischen Offizierskorps in den folgenden Jahrzehnten als Leitbild des auf den Staatsbürgerstatus aufbauenden Soldatenstatus. Rothpletz hatte die Vorstellung der Volksbewaffnung und der an der klassischen Kampforganisation orientierten Milizarmee unter dem Horizont der auf die Staatsexistenz radikalisierten Kriegsdeutung zusammengebracht. Hier knüpfte auch die «Neue Richtung» an, welche ebenfalls von den absoluten Begriffen des Kriegs und der Existenzvernichtung des Staates ausging, aber das Verhältnis von Bürger und Soldat umkehrte und am Soldaten der stehenden (monarchischen) Armeen Richtmass nahm und im Bürger nicht den Staatsbürger und soldat-citoyen, sondern den Bourgeois, den zum Soldaten zu erziehenden Staatsangehörigen, sah.26