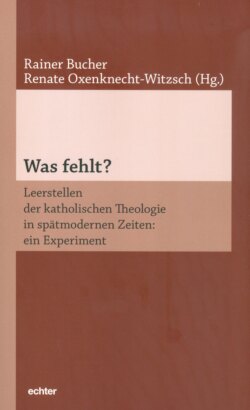Читать книгу Was fehlt? - Группа авторов - Страница 26
1.Erfahrung und Körper
ОглавлениеDie Kategorie der Erfahrung im Bereich der Wissenschaft zu berücksichtigen oder gar mit einzubeziehen ist gefährlich. Erfahrungen sind in der Regel subjektiv, kontextabhängig und ambivalent. Und sie leiten – wenn auch häufig unbewusst – unsere Interessen. Innerhalb der Feministischen Theologie oder auch der Befreiungstheologie hat die Erfahrung eine zentrale Rolle eingenommen und wurde häufig zum politischen Korrektiv eines Theologietreibens, das die Menschen aus den Augen verloren hatte. Beide Theologien sind von der Bildfläche verschwunden. Ihre Anliegen sind aber weder obsolet noch unsachgemäß, schon gar nicht sind sie eingelöst.
Auch für das Fach Pastoralpsychologie stellt die Erfahrung eine zentrale Dimension dar. Als „Verbindungswissenschaft“ verbindet sie nicht nur einzelne Fächer und Disziplinen, sondern auch Theorie und Praxis sowie die sie tangierenden AkteurInnen. Als eine wissenschaftliche Disziplin, die ihr Augenmerk auf krankmachende kommunikative Verhaltensweisen und Strukturen legt und sich um differenzierte Formen der Selbst- und Fremdwahrnehmung müht, klammert sie die Erfahrungsdimension auch im wissenschaftlichen Setting nicht aus. Es gehört zur Profession des pastoralpsychologischen Faches, die Zusammenhänge zwischen der eigenen persönlichen Alltagspraxis, die WissenschaftlerInnen auch jenseits ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit prägt, und professioneller Funktionalität zu reflektieren. Die professionelle Funktionalität lässt sich jedoch nicht nur im Bereich des seelsorglichen Handelns ansiedeln. Sie ist integraler Bestandteil von Wissenschaft selbst.
Theorie und Praxis, privater Alltag und beruflicher Alltag, Subjektivität und Objektivität bilden wie von selbst tiefe Straßengräben. Sie zu ignorieren oder zu banalisieren führt meistens in die Sackgasse. Schon gar nicht darf man sich ihrer wissenschaftstheoretisch bemächtigen. Sie selbst sind und bleiben so etwas wie offene Leerstellen, die dazu einladen, sie zu betreten und zwar mit Ehrfurcht, Respekt und Neugier.
Erfahrungen werden dort problematisch, wo sie absolut gesetzt oder zur Rechtfertigung von Deutungsmonopolen herangezogen werden. In Verbindung mit den einhergehenden Körperempfindungen gestalten sich Erfahrungen unmittelbarer. Die Körperwahrnehmung dient der Deutung erfahrener Wirklichkeit als Korrektiv. In spätmoderner Zeit ist der Körper mittlerweile eine „Ware“ geworden, die sich auch als eigenes „Projekt“ veranschlagen lässt. Dass die Gesellschaft sich des Körpers bemächtigt und ihn in seiner ästhetischen Dimension sowie seinen Funktionsweisen definiert, steht in eigenartiger Diskrepanz zur Phänomenologie des Körpers in seiner Fragilität, Verletzbarkeit und Lust. In therapeutischen und inszenatorischen Prozessen wird der Körper zumeist unverhohlen und bewusst eingesetzt, weil er nicht selten sprachlich schwer zu fassende Themen offenbart.
Erfahrungen zu benennen, sie auszusprechen und in den wissenschaftlichen Diskurs einfließen zu lassen ist eine Form, die Körperlichkeit nicht auszusparen. Der Körper lässt dem Verborgenen und dem Verdrängten keine Ausweichmöglichkeiten. Er konfrontiert mit seiner Stärke und Kraft, aber auch mit seiner Schwäche und seinem Verfall. Das Aussparen von Erfahrung und Körperlichkeit in der theologischen Wissenschaft heißt, auf andere Formen der Wahrnehmung, Deutung und Integration und die damit verbundenen Entdeckungsvarianten zu verzichten.