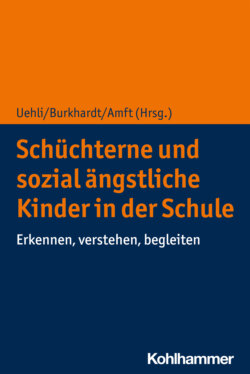Читать книгу Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Woher kommt Schüchternheit
ОглавлениеGemeinsam ist allen Definitionen von Schüchternheit, dass es sich um eine Reaktionsweise von Personen handelt, die in sozialen Situationen auftritt.
Je nach Erklärungsmodell gibt es unterschiedliche Annahmen für die Ursachen von Schüchternheit. Häufig wird Schüchternheit als ein angeborenes Temperamentmerkmal beschrieben, das somit biologisch bzw. genetisch mitbedingt ist. Dies wird von verschiedenen Autor/-innen damit erklärt, dass betroffene Kinder auf Grund einer übererregbaren Amygdala bereits auf minimale Auslöser mit Furcht und Geschrei reagieren. Unbekannte, neue Situationen wirken auf sie ebenso beängstigend wie die Begegnung mit unvertrauten Menschen. Die Forscherin Margarete Eisner geht in ihrer tiefenpsychologischen Betrachtungsweise davon aus, »dass der Charakterzug der Schüchternheit seinen Ursprung in der frühkindlichen Entwicklung hat, und zwar in der Zeit, wenn das Kind beginnt, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, um ihre Reaktionen zu antizipieren. Parallel zu seinen kognitiven Fähigkeiten entwickelt sich dann eben auch das Potential zur Schüchternheit« (Eisner, 2012). Borwin Bandelow (2007) geht in seiner Annahme davon aus, dass beide Erklärungsansätze ihre Berechtigung haben: »Wir wissen, dass genetische Faktoren eine Rolle spielen. Man schätzt den Einfluss der Vererbung – je nach Studie – auf zwischen 24 und 51 %. Wir wissen auch, dass frühkindliche Traumata einen Einfluss haben, vor allem die Trennung der Eltern. Bei anderen Traumata hingegen, wie Gewalt in der Familie, Alkoholabhängigkeit oder sexuellem Missbrauch, konnte das nicht bewiesen werden (FAZ, 21.10. 2007).
Entwicklungspsychologische Betrachtungsweisem legen die Annahme zugrunde, dass Schüchternheit zu einem großen Teil von der Erziehung, der Entwicklung und dem sozialen Umfeld des Kindes abhängt. Werden dem Kind durch ein Vorbild in der Familie soziale Kompetenzen vermittelt und zeigen sich die Eltern als kontaktfreudig, so wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch das Kind nicht an schüchternem Verhalten leiden. Anders als ein Kind, das in einem Umfeld aufwächst, in dem die Eltern selbst eher kontaktscheu oder ängstlich sind. Fröhlich-Gilldhoff (2013) weist auf Studien hin, die einen engen Zusammenhang zwischen dem ängstlichen Verhalten der Eltern und dem der Kinder aufzeigen. Er berichtet von der Bremer Jugendstudie, in der 34 % der Jugendlichen mit Angststörungen davon berichten, dass auch ihre Eltern unter Angststörungen leiden. Dabei sollen Mütter gegenüber ihren Kindern häufiger Angst benennen als die Väter. Das Angstniveau der Mutter scheint also Einfluss auf die Ängstlichkeit des Kindes zu haben. Solche Eltern sind oft überbehütend und trauen ihrem Kind nicht so viel zu. Wir alle kennen das Beispiel der ängstlichen Mutter, die mit ihrem kleinen Kind auf den Spielplatz geht. Das Kind rennt voller Freude auf die Rutschbahn. Die Mutter steht unten und ruft: »Pass auf, pass auf, dass du nicht herunterfällst oder dich verletzt!« Das Kind wird von Mal zu Mal zögerlicher, bis es die Freude an der Rutschbahn verliert oder diese ganz vermeidet. Der Erziehungsstil der Eltern prägt also das kindliche Verhalten. Somit tragen negative Erwartungen und ein negatives Selbstbild zum ängstlichen Verhalten bei. Es kommt zu einem Teufelskreis: Das negative Selbstbild und die negativen Erfahrungen führen zu Angst und Vermeidung. Die Vermeidung stärkt das negative Selbstbild und verhindert, dass soziale Fähigkeiten erlernt werden können.