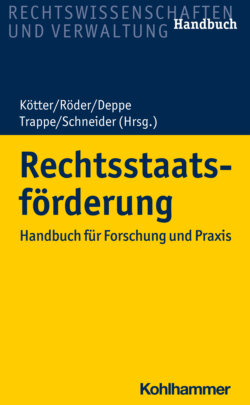Читать книгу Rechtsstaatsförderung - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.Deutsche Rechtsstaatsförderung
ОглавлениеDie Bedeutung der Rechtsstaatsförderung für die deutsche auswärtige Politik lässt sich schwer bemessen. Einerseits ist Rechtsstaatlichkeit tief im Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland verankert. Das zeigte sich bei der Entwicklung des Rechtsstaatsprinzips bundesrepublikanischer Prägung, die vor allem in den 1960er Jahren vom Bundesverfassungsgericht vorangetrieben wurde (§ 2 B.). Die deutschen Gerichte – und allen voran das Bundesverfassungsgericht – genießen im Land wie international große Anerkennung. Der Justizaufbau war ein zentraler Baustein bei der Erstreckung des westdeutschen Rechtsstaats auf die fünf neuen Länder (§ 2 D.). Die Besonderheit, dass Deutschland nach 1945 selbst Empfänger alliierter Unterstützung im Bereich des Staatsaufbaus und der Justiz war, verstärkt bis heute seine Glaubwürdigkeit bei der Rechtsstaatsförderung im Rahmen seiner auswärtigen Politik.
Andererseits ist nicht zu erkennen, dass es sich bei der Rechtsstaatsförderung um eine Priorität deutscher auswärtiger Politik, gar um eine Leitidee handelt. Eine Rechtsstaatsförderung deutschen Stils, die sich durch charakteristische Merkmale oder Methoden auszeichnet und die auch international als solche wahrgenommen würde, existiert nicht. Von deutscher Rechtsstaatsförderung lässt sich deshalb bestenfalls mit Blick auf solche Maßnahmen sprechen, die Deutschland politisch zugerechnet werden können. Als Zurechnungskriterien kommen dabei vor allem die Finanzierung einer Maßnahme aus Haushaltsmitteln und eine koordinierende Verantwortung der Bundesregierung in Betracht. Eine solche Betrachtung bezieht auch Maßnahmen ein, die selbständige Akteure wie politische Stiftungen (§ 3 I.) aus öffentlichen Mitteln bestreiten, und solche, bei denen die Mittel von anderen Gebern wie der EU kommen, die aber wenigstens von der Bundesregierung mitorganisiert und -verantwortet werden.
Zur Bemessung des finanziellen Volumens deutscher Rechtsstaatsförderung im hier verstandenen Sinne bietet es sich an, auf die von Deutschland jährlich an die OECD gemeldeten und nach Förderbereichen aufgeschlüsselten ODA (= official development assistance)-Zahlen abzustellen. Mittel für die Zwecke der Rechtsstaatsförderung sind vollständig ODA-anrechenbar und werden von der OECD im Sektor 151 „Staat und Zivilgesellschaft allgemein“ in verschiedenen Förderbereichen ausgewiesen (s. Anlage, Abb. 1). Im Jahr 2019 betrug die Gesamtsumme deutscher ODA 19 Mrd. EUR. Davon entfielen 1,9 Mrd. auf den Sektor 151, wovon gut 127 Mio. EUR im Förderbereich 15130 „Entwicklung von Rechts- und Gerichtswesen“ und weitere gut 68 Mio. EUR im Förderbereich 15160 „Menschenrechte“ verwendet wurden. Inwieweit die den anderen Förderbereichen zugeordneten Mittel für Zwecke der Rechtsstaatsförderung verwendet wurden, ist eine Definitionsfrage (s. III.) und lässt sich anhand der vorliegenden Daten nicht näher bestimmen.
Bemerkenswert ist, dass die ODA-Zahlen im Förderbereich 15130 in den Jahren 2014–19 Schwankungen von +/- 30 % aufwies (s. Anlage, Abb. 2). Das liegt an einzelnen großen Vorhaben, wobei vor allem die deutsche Beteiligung an der Finanzierung der Gehälter afghanischer Polizeikräfte im Rahmen des 2001 aufgelegten UNDP Law and Order Trust Fund Afghanistan (LOTFA) heraussticht. Diese machte fast die Hälfte der Mittel in diesem Förderbereich aus, die immer wieder erheblich erhöht oder verringert wurden (s. Anlage, Abb. 3). Mit UNDP war bei diesem Vorhaben ein internationaler Akteur Mittelempfänger und Durchführungsakteur (s. Anlage, Abb. 4). Die Zuordnung dieser Mittel zum Förderbereich „Entwicklung von Recht und Gerichtswesen“ und nicht zur Sicherheitssektorreform steht im Gegensatz zu denen für das GIZ Polizeiprogramm Afrika, das bei einer Reihe von Ländermaßnahmen auch Rechtsstaatsförderung umfasst, was auf den großen Spielraum verweist, den die Geber bei der Interpretation der Titel haben.
In der Politik der Bundesregierung wird die Rechtsstaatsförderung seit den 1990er Jahren immer deutlicher sichtbar. In der Entwicklungspolitik6 zeigt sie sich ab 1994 in dem Vorhaben der (damaligen) GTZ zur Rechtskooperation mit China (§ 3 A.). Der Rechtsstaatsaufbau war zur selben Zeit explizites Ziel der Beratung im Verfassunggebungsprozess in Südafrika7 (§ 3 D.) und den Staaten des ehemaligen Ostblocks8 (§ 3 B.), um 2010 auch in Kenia.9 Die Rechtsstaatsförderung stellt heute ein Kernelement in den vom BMZ erarbeiteten Programmen über Gute Regierungsführung und im Rahmen der Umsetzung der SDGs und der Agenda 2030 dar.10 In der vom BMJV verantworteten internationalen rechtlichen Zusammenarbeit erlangte die Rechtsstaatsförderung insbesondere in Folge der Bemühungen um den Verfassungsaufbau in den Staaten Ost- und Südosteuropas an Bedeutung.11 Seit 2000 bzw. 2008 bestehen überdies Rechtsstaatsdialoge mit China und Vietnam. Seit dem deutschen Staatsaufbau-Engagement in Afghanistan spielt die Rechtsstaatsförderung auch in der Außen- und Sicherheitspolitik eine bedeutende Rolle, was sich 2004 im Aktionsplan Zivile Krisenprävention widerspiegelte.12 Die Rechtsstaatsförderung gilt seitdem als ein zentrales Element eines vorsorgenden Ansatzes in der Politik der Bundesregierung gegenüber fragilen Staaten, den die Bundesregierung 2017 in den ressortgemeinsamen Leitlinien für Krisen und bewaffnete Konflikte ausbuchstabierte und 2019 durch Strategien zur Rechtsstaatsförderung, zur Sicherheitssektorreform und zur Vergangenheitsarbeit und Versöhnung ergänzte. Mit der ressortübergreifenden RSF-Strategie wurde 2019 ein gemeinsamer begrifflicher und konzeptioneller Rahmen für diese Politik geschaffen.13 Vor allem die Titel für Einzelmaßnahmen zur Stabilisierung und Krisenprävention im Haushalt des Auswärtigen Amts sind seit 2010 immer weiter angewachsen.
Die Rechtsstaatsförderung ist nicht unumstritten. Die Einwirkung auf grundlegende Strukturen der Staatlichkeit im Partnerland halten manche für eine unzulässige Einmischung in autonome gesellschaftliche Angelegenheiten, gar ein neo-koloniales Projekt, mit dem eine strukturelle Anpassung an vermeintlich universelle Standards erzwungen werde („Isomorphismus“ § 10 A.). Aus völkerrechtlicher Sicht werden die Grenzen einer unzulässigen Intervention infolge des asymmetrischen Machtverhältnisses der beteiligten Staaten erörtert (§ 11 B.) und daraus auch die verfassungsrechtliche Pflicht zur Zurückhaltung entwickelt (§ 11 A.). Dennoch, und obwohl Rechtsstaatlichkeit eng mit der Idee moderner (Verfassungs-)Staatlichkeit verknüpft ist, gilt sie andererseits – und anders als Demokratie oder Menschenrechte – auch als ein nicht-ideologisches und global zustimmungsfähiges Ziel für Reformen.14 Zugleich sind die globalen Debatten über Rechtsstaatsförderung stets von der Auseinandersetzung über die Entstehung und Ausübung legitimer (Rechts-)Staatlichkeit unter ganz verschiedenen institutionellen wie normativen Bedingungen geprägt.15 Die global geteilte Zustimmung zur Rechtsstaatlichkeit erweist sich freilich als ein Lippenbekenntnis, so lange keine konkreten inhaltlichen Anforderungen damit verbunden werden. Was abschließend zu der Frage nach dem Rechtsstaatsbegriff der Rechtsstaatsförderung führt.