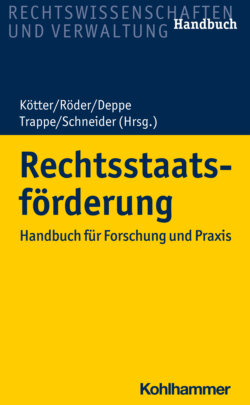Читать книгу Rechtsstaatsförderung - Группа авторов - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.Durchführungsebene
ОглавлениеAuf der Durchführungsebene findet sich eine Vielzahl von Akteuren, die bei der Umsetzung eines Projekts unterschiedliche Funktionen in der Bewilligungskette haben. Je nach Handlungsformat unterscheiden sich die Aufgaben innerhalb eines Projekts erheblich (z. B. Beratung durch Langzeit- oder Kurzzeitexpert:innen, integrierte Fachkräfte, Durchführung von Fortbildungen etc.). Bei den Durchführungsakteuren kann es sich um deutsche, internationale oder lokale Personen oder Organisationen handeln, deren rechtlicher Status je nach Organisationsform, aber auch abhängig von der Art der Mittelbewilligung sehr unterschiedlich sein kann. Das zeigt sich auch am uneinheitlichen Sprachgebrauch: Durchführungsakteure werden auch als Implementierer, Projektdurchführer, Umsetzungspartner oder Zuwendungsempfänger bezeichnet.
Die Ziele und Handlungsweisen der Durchführungsakteure hängen nicht unwesentlich von ihrem jeweiligen institutionellen Zweck und den Interessen ihrer Gesellschafter oder Mitglieder ab. Ganz grob lassen sich drei Arten von Durchführungsakteuren unterscheiden. Das sind erstens deutsche staatliche Durchführungsorganisationen, die als rechtlich verselbständigte Stellen im Geschäftsbereich eines Ressorts der Bundesregierung angesiedelt sind und dezidiert zur Durchführung von Projekten eingerichtet wurden, wie die GIZ und die KfW beim BMZ (§ 12 A.)32, oder die 1992 auf Initiative des BMJV gegründete Deutsche Stiftung IRZ (§ 12 C.).
Von den Durchführungsorganisationen unterscheiden sich zweitens nicht-staatliche Organisationen wie die Stiftungen oder nicht gewinnorientierte Unternehmen, die zur Verfolgung eines eigenen Zwecks im Bereich der Rechtsstaatsförderung handeln und dafür Projektmittel in der Form von Zuwendungen erhalten. Hierzu rechnen etwa die Max-Planck-Stiftung für Frieden und Rechtsstaatlichkeit oder Nichtregierungsorganisationen wie Democracy Reporting International. Als Empfänger von öffentlichen Aufträgen kommen auch gewinnorientierte privatwirtschaftliche Unternehmen in Betracht, aus der Consultingwirtschaft etwa GFA oder GOPA.
Nur vereinzelt kommt es zur direkten Zusammenarbeit der Bundesregierung mit nicht-staatlichen Akteuren aus dem lokalen Handlungskontext. Soweit sie Teil der Erbringungsstruktur sind, handeln sie in aller Regel als lokale Kooperationspartner und Subunternehmer des deutschen Mittelempfängers (§ 13 F.). Nicht selten sind sie dagegen selbst die Empfänger der von den Projektdurchführern erbrachten Rechtsstaatsförderungsleistungen. Wirken bei einem Vorhaben sowohl auf der Durchführungs- als auch auf der Empfängerseite lokale Akteure mit, entsteht eine komplexe Akteursstruktur, was die Abgrenzung der Aufgaben und Verwantwortlichkeiten erschwert und das Bild des Akteursdreiecks verunklart, was aber zugleich Raum schafft für einen Intermediär, der zwischen den Akteuren im Durchführungskontext übersetzt und zu ihrer Koordinierung beiträgt (§ 3 E.).
Drittens findet sich in seltenen Fällen auf der Durchführungsebene auch die Mitwirkung internationaler Organisationen. Ein Beispiel hierfür ist das in Afghanistan bis zuletzt durchgeführte Polizeiprojekt LOTFA (Law and Order Trust Fund for Afghanistan), bei dem das Auswärtige Amt Mittel in einen von UNDP verwalteten Fonds einzahlte und an dem die Bundesrepublik auch als Co-Träger beteiligt war.33 Hierbei handelte es sich im Grunde freilich um ein multilaterales Projekt mit einer komplexen Projektstruktur (s. u. IV.).
Was die Projektdurchführer wie machen, hängt außerdem von den jeweiligen Projektverträgen ab, die sie im Verhältnis zum Mittelgeber – bzw. bei Kofinanzierungen zu mehreren Mittelgebern – und zum lokalen Projektpartner – der auch als „politischer Träger“ bezeichnet wird – schließen. Die Praxis der unterschiedlichen Durchführungsakteure weicht erheblich voneinander ab. Entscheidend ist der jeweilige Finanzierungsmodus, also die Rechtsform der Mittelbewilligung. Ob Projektmittel als Zuwendung oder im Rahmen eines öffentlichen Auftrags bewilligt werden (§ 11 C.), hängt auch vom Selbstverständnis der jeweiligen Organisation ab. Das gilt etwa für die parteinahen Stiftungen, die sich explizit nicht als Durchführungsakteure verstehen und deshalb Zuwendungen für die Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben erhalten.