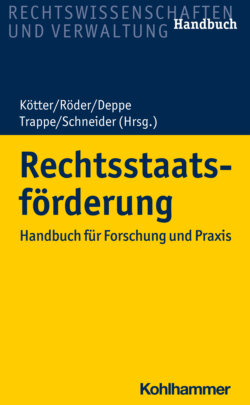Читать книгу Rechtsstaatsförderung - Группа авторов - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеI.
Dieses Handbuch stellt die deutsche Rechtsstaatsförderung im Zusammenhang und aus unterschiedlichen Perspektiven dar. Es bringt 70 Autoren und Autorinnen zusammen, die an der politischen Praxis, der Durchführungspraxis oder im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit an der Rechtsstaatsförderung mitwirken. Dankenswerterweise haben sie sich auf diesen Austausch eingelassen und es übernommen, das Handbuch durch das Verfassen eines Abschnitts um ihre Erfahrung und Sicht zu bereichern. Das Ergebnis ist ein Werk, das nicht nur die verschiedenen Aspekte der Rechtsstaatsförderung, sondern auch die Vielfalt der deutschen Akteure widerspiegelt.
Gemeinsam mit ihren Partnern leistet die Bundesrepublik Deutschland einen wichtigen Beitrag zur internationalen Förderung von Rechtsstaatlichkeit. Dies geschieht im Wege der direkten Zusammenarbeit durch verschiedene Ressorts der Bundesregierung, aber auch indirekt durch die Mitarbeit in internationalen Organisationen. In diesem Sinne ist Rechtsstaatsförderung als ein Handlungsfeld der deutschen Außen- und Entwicklungspolitik zu verstehen. Aber nicht nur die Bundesregierung ist in diesem Feld aktiv. Auch zivilgesellschaftliche Akteure, die politischen Stiftungen und die juristischen Berufsstände fördern auf vielfältige Weise Rechtsstaatlichkeit. Begleitet wird dieses Engagement durch wissenschaftliche Akteure, die einerseits aktiv an einzelnen Maßnahmen und Projekten mitwirken und diese andererseits aus kritischer Distanz analysieren.
Die Vielzahl der Akteure und Ansätze ist eine Stärke und zugleich Schwäche der deutschen Rechtsstaatsförderung. Denn sie erschwert es mitunter, den Überblick zu bewahren und ein gemeinsames Gespräch zu führen. Das Handbuch ist aus der Erkenntnis entstanden, dass ein engerer Austausch zwischen Politik, Durchführungspraxis und Wissenschaft erforderlich ist, um die Kohärenz und Koordination der Rechtsstaatsförderung zu stärken und deren konzeptionelle Grundlagen zu verbessern. Für die Praxis ist es unabdingbar, auf die theoretischen Grundlagen der Rechtsvergleichung, kritische Analysen der Rechtstransferforschung und systematische Darstellungen über die Entwicklung und den Stand der Rechtssysteme von Partnerländern zurückgreifen zu können. Die Wissenschaft wiederum braucht immer wieder aktualisierte Einblicke in die Praxis als Anknüpfungspunkt für ihre Analysen. Die enge Verbindung aus Praxis und Forschung ist in diesem Sinne ganz bewusst in der Konzeption des Handbuchs angelegt, und auch die Herausgeberin und die Herausgeber sowie die Autorinnen und Autoren stammen aus verschiedenen Bereichen der Rechtsstaatsförderungspraxis und der Wissenschaft.
Unser Ziel ist es, mit diesem Handbuch zu mehr Reflexion darüber anzuregen, was Rechtsstaatsförderung bedeutet, was sie leisten kann und was nicht, aber auch kritisch zu fragen, was besser gemacht werden könnte und sollte. Das Handbuch versteht sich als ein Beitrag zur aktuellen Diskussion um die Fortentwicklung und die Rahmenbedingungen der Rechtsstaatsförderung und richtet sich gleichermaßen an Politik, Durchführungspraxis und Forschung.
II.
Für die Zwecke dieses Handbuchs haben wir uns entschieden, den Fokus auf die „deutsche“ Rechtsstaatsförderung zu legen. Wir verstehen darunter alle Aktivitäten, die direkt oder indirekt – etwa über die EU – aus dem deutschen Staatshaushalt finanziert werden. Dabei sind wir uns bewusst, dass der Begriff auch Fragen aufwirft, etwa die, ob es nicht auch eine deutsche Rechtsstaatsförderung im Sinne eines deutschen Stils der Rechtsstaatsförderung gibt. Dies kommt etwa mit Blick auf die Förderung der Juristenausbildung nach deutschem Vorbild oder die Vermittlung der deutschen Subsumtions- bzw. Relationsmethode in Betracht. Ein anderer Anknüpfungspunkt könnte die Organisation des Handlungsfelds sein, insbesondere die Aufteilung der Rechtsstaatsförderung auf verschiedene Bundesressorts, auf Bund und Länder und auf eine Vielzahl von weiteren staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren. Weitere Charakteristika „deutscher“ Rechtsstaatsförderung könnten aus der deutschen Geschichte folgen. Die Erfahrungen des nationalsozialistischen Unrechtsstaates und des nach 1945 entstandenen demokratischen Verfassungsstaats des Grundgesetzes sind spezifische Erfahrungen, die für die Entwicklung der deutschen Rechtsstaatsförderung von Bedeutung waren. Dies gilt auch für die deutsche Teilung und die spätere Wiedervereinigung sowie die damit verbundene Unterstützung der Justiz in den ostdeutschen Bundesländern in den 1990er Jahren. Die Frage nach der mit einer „deutschen“ Rechtsstaatsförderung verbundenen nationalen Perspektive verliert allerdings an Bedeutung, soweit die Stärkung von Rechtsstaatlichkeit oder Rule of Law zusehends auf europäischer bzw. internationaler Ebene erfolgt.
Rechtsstaatsförderung ist in globale Zusammenhänge eingebettet, die einem ständigen Wandel unterliegen. In dem Systemwettbewerb zwischen den USA und der Sowjetunion, der die internationale Politik bis Anfang der 1990er Jahre prägte, lassen sich ab den 1960er Jahren in der US-amerikanischen Entwicklungshilfe erste Projekte zur Förderung von Rule of Law identifizieren. Erst mit dem Ende des Ost-West-Konflikts wurde Rechtsstaatsförderung weltweit zu einem Thema und rückte auch in Deutschland stärker ins Blickfeld. In immer mehr internationalen Vereinbarungen findet sich inzwischen das Bekenntnis zu Rule of Law. Dabei handelt es sich allerdings lediglich scheinbar um einen Konsens der internationalen Gemeinschaft. Einzelheiten des Konzepts sind weiterhin ungeklärt, insbesondere inwieweit Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit zusammenhängen. Auch mit Blick auf die politische Diskussion über die Agenda 2030 (SDG 16) wird deutlich, dass die mit dem Konzept in verschiedenen rechtlichen und politischen Systemen verbundenen Grundannahmen teilweise stark voneinander abweichen. Zugleich lässt sich eine gewisse Internationalisierung der Rechtsstaatsförderung beobachten, die sich in der zunehmenden Konvergenz der Ansätze und Konzepte verschiedener (westlicher) Geber ausdrückt.
Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Demokratie stehen weltweit vor großen Herausforderungen. Im Rahmen der digitalen Transformation kommt es etwa zu grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen, die auch das Verständnis von Rechtsstaatlichkeit beeinflussen. So etablieren sich globale Räume (etwa über die Plattform-Ökonomien), die sich dem Zugriff (national-)staatlicher Regulierung weitestgehend entziehen. Auch die fortschreitende Entwicklung Künstlicher Intelligenz birgt nicht nur Chancen, sondern wirft auch Fragen mit Blick auf Datenschutz, Transparenz, politischer Teilhabe und der Verhinderung von Diskriminierung auf. Zudem verändert sich die Akteurslandschaft: China und die Türkei spielen beispielsweise in der internationalen Zusammenarbeit eine größere Rolle und transportieren direkt oder indirekt ihre eigenen Vorstellungen von (Rechts-)Staatlichkeit. Parallel dazu steht auch in den „Exportländern“ des globalen Nordens der Rechtsstaat zusehends unter Druck. Weltweit sind insoweit Einschränkungen der Handlungsspielräume für die Zivilgesellschaft (shrinking space), Repression, Diskriminierung und rückläufige Demokratisierung zu beobachten. Manche dieser Entwicklungen wurden durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. In Zeiten der Krise verschwinden Governance-Reformen zudem leicht von der Agenda. Welche langfristigen Folgen all dies auch für die Rechtsstaatsförderung haben wird, kann momentan nur erahnt werden. Förder- und Beratungspraxis werden sich jedenfalls anpassen müssen.
Sicherlich werden auch die Entwicklungen in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban die selbstkritische Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragen zu Wirkungen und Machtstrukturen der Rechtsstaatsförderung in Praxis und Wissenschaft verstärken: Was kommt von der Förderung wirklich an und bei wem? Welche Art der Unterstützung erweist sich als nachhaltig? Wie kann verhindert werden, dass insbesondere in Ländern mit hoher Geberdichte die Konkurrenz der Rechtsordnungen stärker im Vordergrund steht als die Bedürfnisse des Partnerlandes? Wie gelingt es, mit den Partnerinstitutionen auf Augenhöhe zu kooperieren? Die Diskussionen um das Verhältnis von Recht und Entwicklung und die Übertragbarkeit von Rechtsnormen und -vorstellungen begleiten die Praxis der Rechtsstaatsförderung bereits seit den 1960er Jahren. In jüngerer Zeit ist die Empfängerperspektive stärker ins Blickfeld gerückt. Dabei ist das Bewusstsein dafür gewachsen, dass Rechtsstaatsförderung nicht in einem Vakuum erfolgt und dass das eigene Verständnis von Rechtsstaatlichkeit angesichts vielfältiger geschichtlicher und kultureller Kontexte nicht als allgemeingültiger Maßstab dienen kann. Auch, um dem Vorwurf des Neokolonialismus und der politischen Bevormundung durch den globalen Norden zu begegnen, ist es nötig, die Kontextgebundenheit von Recht im Blick zu haben und dabei gleichzeitig immer wieder die eigene Sicht in Frage zu stellen.
III.
Das Handbuch ist in fünf Teile gegliedert. Der Erste Teil ist konzeptionellen und strukturellen Überlegungen gewidmet. Die deutsche Rechtsstaatsförderung wird innerhalb der bundesdeutschen institutionellen Strukturen verortet, ihre Akteure und Instrumente vorgestellt. Auch der aktuelle Stand der deutschen Wissenschaft im Bereich Rechtsstaatsförderung wird in den Blick genommen. Anschließend wird nach der Bedeutung der Rechtsstaatsförderung für das Selbstverständnis der Bundesrepublik gefragt. Dabei geht der Blick zurück in die deutsche Geschichte, um auch zu beleuchten, inwiefern etwa die deutsche Erfahrung als Kolonialmacht und der Rechtsstaatsaufbau nach dem Ende zweier Diktaturen die deutsche Rechtsstaatsförderung bis heute prägen.
Die Vielgestaltigkeit deutscher Rechtsstaatsförderung wird in den Darstellungen verschiedener Praxisbeispiele im Zweiten Teil deutlich. Diese illustrieren die Bandbreite der deutschen Rechtsstaatsförderung, gehen auch auf die Herausforderungen ein und fragen nach den Bedingungen für erfolgreiche Maßnahmen. Die Darstellungen der deutschen Akteure werden durch die Berichte von Autoren und Autorinnen aus den Partnerländern ergänzt, die selbst als Mittler und Mittlerinnen am Staats- und Rechtsstaatsaufbau in ihren Ländern beteiligt waren bzw. sind und einen anderen Blick auf die deutschen Akteure und die von ihnen verfolgten Ziele und Aktivitäten haben.
Die Beiträge im Dritten Teil des Handbuchs unterscheiden zunächst zwischen verschiedenen übergeordneten außen- und entwicklungspolitischen Zielsetzungen, die mit den Mitteln der Rechtsstaatsförderung verfolgt werden. Rechtsstaatsförderung kann dem deutschen und europäischen Interesse an Frieden und Sicherheit dienen, sie kann z. B. aber auch ein Mittel zur Verbesserung des Menschenrechtsschutzes im Partnerland sein. Nicht selten bündelt ein Engagement mehrere Interessen und Motive. Von der strategischen Zielsetzung zu unterscheiden sind verschiedene Konzepte, die sich in der Gebergemeinschaft entwickelt haben und ständig fortentwickeln, in denen Rechtsstaatsförderung eine wichtige Rolle zur Erreichung bestimmter politischer Veränderungen in einem Handlungskontext spielt. So sind etwa Fragen von Transitional Justice oder Antikorruption eng mit der Rechtsstaatsförderung verbunden.
Der Vierte Teil des Handbuchs widmet sich der Forschung zur Rechtsstaatsförderung. Die Beiträge stammen aus den Bereichen der Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft, Rechtsanthropologie und Rechtslinguistik und spiegeln damit die Interdisziplinarität der Rechtsstaatsförderung wider. Sie fragen nach Entstehung, Wandel und Transfer von Recht und beschäftigen sich mit den für die Praxis der Rechtsstaatsförderung unentbehrlichen Kontextanalysen. Dabei wird auch auf Prozesssteuerung und Projektmanagement sowie Fragen der Evaluierung eingegangen.
Der Fünfte Teil des Handbuchs beleuchtet die Prozesse und Strukturen verschiedener Akteure der Rechtsstaatsförderung sowie die komplexen Rechtsverhältnisse, die zwischen ihnen bestehen und in denen nationales und internationales Recht miteinander verwoben sind. Außerdem werden eine Reihe von Handlungsformaten und ihre Wirksamkeitsvoraussetzungen dargestellt. Hier zeigt sich wiederum die Vielgestaltigkeit der Rechtsstaatsförderung. Schließlich geht es auch um die Frage nach der Generierung und Speicherung von Erfahrungswissen, das nicht zuletzt zur Herausbildung von weitgehend anerkannten, teils normativ verankerten Praxisstandards führt, die auf die Prozesse der Planungs- und Durchführungspraxis zurückwirken.
Deutsche Rechtsstaatsförderung ist außerdem eng verwoben mit internationaler Rechtsstaatspolitik. Im Sechsten und letzten Teil des Handbuchs werden deshalb die Rechtsstaatspolitik von EU, Europarat, OSZE, UN und Weltbank dargestellt. Das Setzen normativer oder auch nicht-normativer Standards für die Rechtsstaatsförderung auf internationaler Ebene hat enorme Auswirkungen auch für die deutsche Praxis. Deutschland schreibt an internationalen Standards mit und ist im nächsten Moment selbst daran gebunden. In diesem Teil geht es in diesem Sinne nicht nur um die Verpflichtung Deutschlands, die Realisierung internationaler Konventionen zu fördern oder zu stärken, sondern auch um die Mitwirkung Deutschlands an der Bildung solcher Standards für die internationale Rechtsstaatsförderung.
Das Zusammenspiel der verschiedenen Teile des Handbuchs hat schon im Entstehungsprozess zu neuen Verbindungen und Gesprächen zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik geführt. Als Herausgeberin und Herausgeber haben wir die Hoffnung, dass dieses Handbuch die Vernetzung über disziplinäre und berufliche Grenzen hinaus anregt und festigt. Wir wünschen uns, dass das Buch als Denk- und Diskussionsanstoß dient und damit zu einer Stärkung der Rechtsstaatsförderung beitragen kann.
IV.
Unser Dank gilt zuallererst den Autorinnen und Autoren, die es trotz ihrer vielfältigen Verpflichtungen und pro bono übernommen haben, einen Beitrag für das Handbuch zu verfassen. Ein großer Dank gilt weiter unseren studentischen Helferinnen und Helfern, die den Entstehungsprozess des Handbuchs in verschiedenen Phasen unermüdlich unterstützt haben: Michelle Benzing, Markus Buderath, Daniel Caspary, Katharina Dürmeier, Julika Enslin, Malte Hüggelmeyer, Merle Jungenkrüger, Stephanie Lorang, Alisha Morell, Jochen Schlenk, Marie-Thérèse Schreiber, Pia Schupp, Ingrid Sinell, Nora Wacker und Alexander Weber. Für ihre Mitarbeit ebenso wie für die Durchführung zweier Workshops und einen Zuschuss zu den Druckkosten standen uns Mittel aus der Projektförderung für den RSF Hub, einer Wissenschaftskooperation der Freien Universität Berlin mit dem Auswärtigen Amt, zur Verfügung. Hierfür möchten wir uns bei allen an dem Projekt beteiligten Personen bedanken. Danken möchten wir außerdem der Goethe Universität Frankfurt am Main und dort vor allem der Leitung des Exzellenzclusters Normative Orders, die uns ihre großartigen Konferenzräume für unseren zweiten Workshop mit den Autorinnen und Autoren, der im November 2019 stattfand, überließen. Schließlich möchten wir uns bei den Organisationen und Institutionen bedanken, bei denen die Autorinnen und Autoren des Handbuchs beschäftigt sind und die seine Entstehung auf unterschiedliche Weise unterstützten, etwa indem sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Freistellung gewährten, und die für viele Beiträge des Buchs die ganz entscheidenden Praxisbeispiele zur Verfügung stellten. Herauszuheben ist an dieser Stelle die GIZ, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zahlreichen Beiträgen mitgewirkt haben.
Matthias Kötter, Tilmann Röder, Jens Deppe, Julie Trappe, Tillmann Schneider
Berlin im Dezember 2021