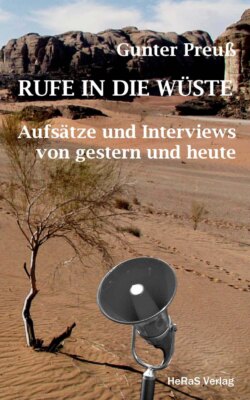Читать книгу Rufe in die Wüste - Gunter Preuß - Страница 12
9. Hänsel und Gretel und die Morgenlandfahrer (1986)
ОглавлениеVor einem großen Walde wohnte ein armer Holzfäller mit seiner Frau und seinen zwei Kindern; das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen und zu brechen, und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er auch das tägliche Brot nicht mehr schaffen. Wie er sich nun abends im Bett Gedanken machte und sich vor Sorgen herumwälzte, seufzte er und sprach zu seiner Frau: „Was soll aus uns werden? Wie können wir unsere armen Kinder ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben?“
„Weißt du was, Mann“, antwortete die Frau, und die Not hatte ihr Herz hart gemacht, denn sie wusste nicht aus noch ein, „wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dicksten ist: Da machen wir ihnen ein Feuer und geben jedem noch ein Stückchen Brot, dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht nach Hause, und wir sind sie los.“
„Hänsel und Gretel“ könnte auch ein Lehrstück sein zu unsrem heutigen Thema „Arbeit und Familie“. Das Märchen ist ein Beispiel für menschliche Grausamkeit, die entstehen kann, wenn die Arbeit die Familie nicht mehr nährt. Dem Fleiß vieler ist es zu danken, dass wir hierzulande geschafft haben, eine „Hänsel und Gretel Geschichte“ im Märchenbuch zu belassen. Unsere Problematik ist nicht mehr die soziale Armut und ihre Folgen, wir haben uns viel eher mit übersteigerten Ansprüchen materieller Art auseinanderzusetzen. Die magische Formel „Fortschritt“, die uns „Lebensglück“ suggeriert, bringt uns in einen Taumel, der uns süchtig werden lässt gegenüber den Dingen, die in ihrer Vielzahl längst nicht alle schön und nützlich sind. Lebensläufe werden darauf angelegt, den Dingen nachzujagen und sich dabei selber aus dem Weg zu gehen, und manch einer, der sich dann doch einmal zufällig begegnet, hastet nun doch lieber blind und taub weiter.
Unser Dasein, das wir ja vom „Schöpfer“ nicht ganz selbstlos geschenkt bekommen haben, verlangt uns ab, kaum auf die Beine gekommen, dass wir uns täglich neu der Realität stellen, die nur allzu oft ein beängstigendes Bild bietet. Wenn wir die Realität bewältigen wollen, müssen wir Ideale haben, einen unerschütterlichen Glauben an das Unmögliche, damit wir das Mögliche erkennen und gestalten können. Seit meiner frühen Jugend trage ich eine Geschichte in mir, die zu einem Sinnbild des Aufbruchs geworden ist, dem nachzugehen ich trotz wiederholter Irrungen und Wirrungen bestrebt bin. Hermann Hesses „Morgenlandfahrer“ sind Menschen wie du und ich, die trotz aller Unterschiedlichkeit sich auf einen Weg wagen zu einem gemeinsamen Ziel hin: dem Morgenland eben. Niemand muss befürchten, dass dieses Morgenland ein Paradies sein könnte, das würde Hesse wohl nicht genügt haben und vielen von uns ein Ort tödlicher Langeweile sein; aber vielleicht ist es ein Ort der Vernunft, der uns zur Besinnung bringt. Und wo sollte dieser Ort denn sein, wenn nicht auf der Erde, denn wenn er nicht hier und da ist, so ist er nirgendwo. Er heißt Nizza, Kairo, Nowosibirsk, Los Angeles, Köln, Erfurt, und wie auch jeder noch so kleine Ort, der auf unseren Kontinenten zu finden ist. Die Lage des Ortes ist also weniger wichtig, sondern vielmehr, wie wir ihn gestalten, was wir aus ihm machen, einen Raum der Freiheit, die nur aus einer Demokratie erwachsen und in ihr bestehen kann.
Die Menschenfamilie im Morgenland: das heißt vor allem Individualität gewinnen, um die Gemeinschaft zu stärken. Wir haben immer den Weg vom „Ich zum Wir“ propagiert, aber der Einzelne muss erkennbar bleiben und darf sich nicht in einer Menschenmasse auflösen. Im Gegenteil, er soll inmitten der anderen an Profil gewinnen, denn wenn das Ich auch nichts ist ohne das Du, so ist das Du nichts ohne das Ich. Die eigenen Tugenden lassen sich ohnehin nur an den Mitmenschen entdecken.
Aber es kann keine Weltfamilie geben, wenn die kleine Familie, die Mutter, der Vater und die Kinder miteinander keinen Frieden finden und halten können. Es ist eine Welt der Erwachsenen mit einem Wust von Gesetzen und Lebensregeln, in die sich Kinder nur schwer einfügen können, viele in ihrer Persönlichkeit gestört oder gar schon gebrochen. Natürlich müssen die Eltern ihren Kindern eine lebbare Welt anbieten; aber je „fertiger“ wir sie ihnen vorsetzen, umso weniger von dem zur Entwicklung notwendigen Spielraum werden sie darin finden. Der Homo ludens, der „spielende Mensch“ also, der noch in naiver Schönheit im Kinde zu Hause ist, will sich an Menschen und Dingen ausprobieren und dabei sein Selbst erfahren. Schiller sagt uns dazu, und das gilt in einer hoch technisierten Welt umso mehr: ...der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Kinder, die in Verantwortung für sich und andere hineinwachsen sollen, brauchen frühzeitig das schöpferische Gefühl, Welt zu entdecken und zu erschaffen. Die Normen unserer „Erwachsenenwelt“ können nicht zur glatten Anpassung, die einer Selbstaufgabe gleichkäme, auf unsere Kinder übertragen werden. Wenn die „Kinderwelt“ auch ihren Platz in der Realität hat, so hat sie ihr unendliches Reich, das weit über die Grenzen der Wirklichkeit hinausgeht, vor allem auch in der Fantasie, die keine erstarrten Formen kennt, keine festgelegten Farben, Berührungen und Gerüche, die alles sprengt, was anscheinend für die Ewigkeit festgefügt ist. Kinder hören, sehen und fühlen, wofür Erwachsene für verrückt erklärt und weggesperrt werden, sie scheuen sich nicht Gefühle zu zeigen, Zuneigung, Wut, Verzweiflung, Trauer, auch in aller Öffentlichkeit. Aber schon bald stellen wir Erwachsenen ihnen unsere Welt vor, wie unsere Mütter und Väter sie uns vorgestellt haben, und bitten oder drohen sie da hinein und weisen ihnen ihren Platz zu, den sie bei Strafandrohung nicht zu verlassen haben. Wir nennen Kinder schwierig, disziplinlos und gar asozial, wenn ihr gesunder Drang nach Bewegung und Eroberung ihrer Welt und ihre unersättliche Fantasie sie über von uns errichtete Zäune springen und Mauern, mit denen wir uns vor den anderen abgesperrt haben, einreißen lässt. Wir sehen eine Gefahr in Widerspruch und Zweifel, in uns verloren gegangenem Fühlen und Denken, in womöglich sogar anderem Tun, wir sehen von uns schwer Erarbeitetes in Frage gestellt, wir fürchten um unsere in verlustreichen Kämpfen errungene Macht, die wir um keinen Preis wieder hergeben wollen. Der gewichtige Sockel, auf den wir uns gebieterisch gestellt haben, wäre wohl von einem Kind, wenn wir es an uns heranließen, mit einem Pusten oder Stups ins Wanken zu bringen.
Wie sieht es denn überhaupt aus mit unserer Kinderliebe? Kommt sie nicht oft mit unserer Eigenliebe daher? Sind uns denn nicht alle Äpfel, die vom Stamm fallen, faul? Wir pflücken sie doch besser selbst und bestimmen, was mit ihnen geschieht, ob wir sie nun aufpolieren und zur Schau stellen, weglagern oder zum alsbaldigen Verzehr bereitstellen. Unter dem Deckmantel Liebe passt alles Unheil der Welt. Noch immer sind wir der selbstzufriedene, autoritäre Gott, von dem Mose sagt: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut. Der Vater setzt seine Kinder in das von ihm eingerichtete Paradies, und weil er ihrer Liebe nicht traut - wohl zu Recht bei seinem Verhalten -, führt er sie so lange in Versuchung, bis sie sich als schwach erweisen und er Grund hat, sie durch Bestrafung seine Autorität spüren zu lassen und für immer zu unterwerfen: Ich bin dein Herr, dein Gott, du sollst nicht ...! Der verehrte Sigmund Freud, der es wohl zu seiner Zeit schon ahnte, aber noch nicht besser wissen wollte oder durfte, lastete mit seiner Verführungstheorie dem Kind den Ödipuskomplex an. (Wie groß muss doch die Angst sein, die die allmächtigen Götter vor ihren unschuldigen Kindern haben.)
Ist es aber nicht vielmehr so, dass nicht unsere Kinder, sondern wir Eltern die Verführer sind? Da schließen junge Leute, manchmal fast selbst noch Kinder, im Sinnesrausch erster Berührungen oder aber um dem Elternhaus zu entfliehen, einen Bund fürs Leben und geloben sich ewige Liebe und Treue. Von heute auf morgen stellt sich der Alltag ein mit all seinen uns bekannten Problemen, und jetzt erweist sich, wie gut oder schlecht sie füreinander vorbereitet waren. Sie leben im Zeitalter der Information, sie haben mit Büchern und modernen Techniken Zugriff auf die gesammelten Menschheitserfahrungen, sie wollen bald ferne Welten begehen; aber es zeigt sich, dass sie von sich selbst und dem anderen kaum etwas wissen. Von ihrem Körper haben sie erfahren, alles über Anatomie und Blutkreislauf, über die Organe, Knochen und Sehnen und wie er eben so funktioniert. Die Lust auf den anderen, ihre Begierde nach Befriedigung hat sie erst einmal leichtsinnig gemacht, dann wird, was neu war, Wiederholung, der andere, sie selbst werden austauschbar, der große Zauber zeigt seinen doppelten Boden. Sie meinen nun alles erfahren zu haben, doch es genügt ihnen nicht. Es ist ihnen nicht beigebracht wurden, mit den Irrungen und Wirrungen ihres Geistes umzugehen, aufgeklärt sind sie nun hilflos, sie spüren die Zuckungen ihrer Seele und leugnen sie gleich ihren Eltern. Da stehen sie nun plötzlich allein da, völlig ungewohnt, weil nie losgelassen; ins Elternhaus wollen sie nicht zurück, wirklich zusammenfinden können sie aber auch nicht mehr, für eine Trennung sind sie nicht stark genug. Wohin also mit der Enttäuschung, dass eben auch und vor allem in der Liebe nicht alle Blütenträume reifen, mit der Erkenntnis, dass „immer“ und „ewig“ sehr kurze Zeiten sind und das Leben dafür nicht angelegt ist? Wohin mit ihrer unerfüllten Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit? Da ist ihr Kind, das inzwischen auf der Welt ist, das nächstbeste „Liebesobjekt“, auf dessen Unschuld sie widerstandslos die eigene Problematik projizieren können. In diesem Missbrauch, den sie ja nicht als solchen erleben, tun sie nun aus „Liebe“ für ihr Kind „alles“. Für das heranwachsende Kind sind seine Eltern tabu, wie es im Garten Eden der Herrgott für Adam und Eva war. Alle Rechte für das Kind – das ist ein großer Verdienst in der Gesetzgebung unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung; doch was auf dem Papier steht, das muss noch lange nicht in unserem Denken und Fühlen sein, dass wir auch danach handeln können. Seit Menschengedenken tun Eltern „alles“ für ihr Kind, in dem sie sich in ihm ausleben und mit ihm ihr Selbst zu verwirklichen versuchen, anstatt es leitend, aber auch immer wieder loslassend auf seinem Lebensweg zu begleiten. Denn es soll uns ja nicht ein wilder Spross aus unserem geraden Stamm schlagen und Wurzeln bilden, die uns das Wasser abgraben, und eine Krone fächern, die uns in den Schatten stellt.
Und dann die Schule. Sollte sie nicht die Erweiterung einer „gesunden“ Familie sein, ein vielgestaltiger Spielplatz, wo die Lust am eigenen Denken und die Freude an der Bewegung unterstützt wird? Erziehung, also die Beförderung der guten Anlagen jedes Einzelnen, sollte wieder vor Bildung stehen; denn was fangen Kinder und Jugendliche denn an mit ihrem Wissen in seiner verwirrenden Vielfalt, wenn sie nicht den Glauben haben an das, dem es dienen soll. Aber auch in der Schule sieht das Kind sich einer dem elterlichen Zuhause ähnlichen Institution gegenüber; es werden ihm zwar Fragen gestellt, aber die „richtigen“ Antworten vorgegeben. Der Lehrer ist wie schon die Eltern autorisiert und tabuisiert eine allein gültige Weltanschauung, nämlich die eigene, oder eine von höherer Autorität vorgegebene. Diese bemüht er sich zu vermitteln und durchzusetzen, anstatt sein Hauptaugenmerk darauf zu richten, dem Schüler zum zwanglosen Denken zu verhelfen und Eigenentscheidungen, die einem gesunden Selbstvertrauen entspringen, zu würdigen. Die Schule sollte Mut machen zum lebensnotwendigen Zweifel, sie sollte Unruhe schaffen, die sich gegen Erstarrtes wendet, und nicht zuletzt soll sie unsern Kindern das unbequeme Fragen lehren und eigene Antworten gelten lassen, damit sich aus dem Widerstreit pubertierender Gefühle und wechselhafter Ansichten ein fester Charakter bilden kann.
Natürlich muss der Lehrer sein Weltbild haben, sein Morgenland also, und er selbst muss ein Morgenlandfahrer sein, ein Suchender also, der sein Ziel kennt. Ein Pädagoge ist eben nicht nur ein Erziehungsberechtigter, sondern auch ein Erziehungsbedürftiger, er bedarf der erzieherischen Kraft der Kinder. Wenn er ihr Staunen und ihre Lust am Spiel nicht mehr wahrnimmt oder gar störend empfindet und sich längst in toten Buchstaben und Zahlen verfangen hat, dann wird er bestenfalls Wissende aus seiner Schule entlassen können. Das aber ist zu wenig. Wir Menschen sind nichts ohne den Glauben. Ob wir ihn nun Gottglauben nennen oder nicht, es ist der Glaube an uns selbst, an das Gute in uns, an die uns innewohnende lebensgestalterische- und erhaltende Kraft.
Wir hatten in unserem Land eine Zeit, die noch gar nicht so lange zurückliegt, in der wir fest überzeugt waren, dass wir unser Morgenland, eben den Kommunismus, mit ein paar Katzensprüngen heraus aus jahrtausendealter Menschheitsgeschichte erreichen könnten. Das waren gute Tage des Aufbruchs, des Wollens und Glaubens nach den langen Jahren faschistischer Entsetzlichkeit. Jetzt, wo uns der Alltag eingeholt hat, abgestiegen von den Gedankengipfeln in die Mühen der Ebene, sollten wir begriffen haben, dass unser schönes Ziel, eine Welt des Friedens, der Einheit und Gleichheit, eine wahre Herkulesaufgabe ist, an der wohl, solange es Menschen gibt, gearbeitet werden muss. Diese Erkenntnis zeugt von notwendiger Reife, sie sollte uns nicht mutlos machen; denn eine große Zielstellung bedarf einer noch größeren Anstrengung.
Wir schufen und benutzten noch vor kurzem Wortgebilde wie „Sozialistische Menschengemeinschaft“. Sie wurden von oben herab suggestiv gebraucht, um uns immer wieder einzuschwören auf Gemeinsamkeit. Manchmal haben wir sie wohl auch bewitzelt wegen ihrer allgemeinen Größe, dem einen und anderen ist es in dieser „Kollektivierung“ zu eng geworden, und dennoch trugen sie unsere Hoffnung auf Entwicklung. Inzwischen gehen wir vorsichtiger mit Worten um, ja, manchmal ängstigen wir uns, eine gute Sache mit guten Worten zu benennen, und es sieht in der Tat wieder einmal nicht zum Besten aus mit uns Menschen auf unserer Erde. Aber eine Untergangsstimmung lähmt uns nur, wo es doch jeden klugen Gedanken und jede zupackende Hand braucht, um aus den Wirren unserer Zeit herauszufinden. Und dazu braucht es auch die Künste, die Literatur, das Wort eben, Geschichten, Theaterstücke, Gedichte, die uns unbestechlich die Realität spiegeln und mit ihrer poetischen Ehrlichkeit Mut zur Veränderung machen. Es werden dringend Menschenbilder, Welt- und vor allem auch Zukunftsbilder gebraucht, vor allem auch für unsere Kinder, damit sie ihre Welt mitgestalten können. Jetzt zu resignieren wäre ebenso tödlich wie in einen blinden Zukunftsoptimismus zu verfallen.
Wir, die wir uns hier zusammengefunden haben, sind Lektoren, Schriftsteller, Illustratoren und Verlagsmitarbeiter, die mit Wort und Bild, dieser wohl größten menschlichen Errungenschaft, künstlerisch umzugehen wissen. Man könnte auch sagen, unsere Aufgabe ist es, uns zur Wahrheit hinzulügen. Auch wir sind Morgenlandfahrer, und wir erfinden und gestalten Geschichten für Morgenlandfahrer. Und jeder, der mit uns auf dem Weg ist, sollte seinen Platz unter uns finden können. Wir Büchermacher sind Anwälte unserer Kinder. Wir vertreten sie gegenüber denen, die sie zur Durchsetzung eigener Interessen benutzen wollen, mit unserer Lebenserfahrung, Bildung und Fantasie. Wir stellen ihnen keine fertige Welt vor, sondern viele Welten, zu denen sie neue hinzuerfinden und ausmalen sollen. Würden wir uns von der Zukunft, von der Freiheit der Entscheidung lossagen, würden wir uns unseren Kindern entziehen, wir würden sie, und nicht aus materieller Not, wie Hänsel und Gretel in den dicksten Wald schicken, um sie loszuwerden. Haben wir doch nicht soviel Angst um unsern Machtanspruch, gestatten wir doch unseren Kindern in Familie und Schule mehr praktizierte Gleichberechtigung. Ich denke, um eine Überforderung brauchen wir uns beim gegenwärtigen Stand der Dinge nicht zu sorgen. Wenn man die Augen dafür öffnet, so erkennt man, dass Kinder uns viel zu zeigen haben, und wenn man ein Ohr dafür hat, so hört man aus Kindermund längst Verlerntes. Denn auch wir beherrschten einmal die Sprache der Tiere und Pflanzen, wir konnten Steine zum Leben erwecken und es fiel uns nicht schwer, jede Gestalt anzunehmen und mit den Vögeln im Herbst nach Süden zu ziehen.
Im Märchen „Hänsel und Gretel“ kann die Familie nur durch ein Wunder gerettet werden. – Und endlich erblickten sie von weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater und ihrer Mutter um den Hals. Der Mann und die Frau hatten keine frohe Stunde gehabt, seitdem sie die Kinder im Wald gelassen hatten. Gretel schüttete sein Schürzchen aus, dass die Perlen und Edelsteine in der Stube herumsprangen, und Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seiner Tasche dazu. Da hatten alle Sorgen ein Ende, und sie lebten in lauter Freude zusammen.
Wir wissen, dass aus „Perlen und Edelsteinen“, wenn man sie denn schon gewonnen hat, nicht eitel Freude entsteht. Das Geschmeide von dazumal müssen wir heute von der Haut in unsere Herzen bringen. Dafür bedarf es unter anderem auch vieler Bücher, die uns die Welt verstehen lassen und sie zu verändern helfen.