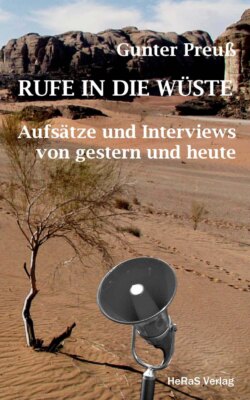Читать книгу Rufe in die Wüste - Gunter Preuß - Страница 13
10. Und es muss blaue Hunde geben (1986)
ОглавлениеDas Gespräch führte: Michael Hinze
1975 brachten Sie die „Mühsal des Schreibens“ auf die Formel: „Lieber schwere Möbel tragen als tausend unbeschriebene Seiten.“ Ist diese Last leichter geworden?
Nein. Aber vielleicht bin ich mir inzwischen auch der Freuden der Schreibarbeit etwas bewusster geworden. Denn es ist ja keine Strafarbeit, zu der mich irgendwer zwingt. Eigentlich kann dabei niemand außer mir selbst Druck auf mich ausüben. Es ist ein Beruf, der wie jeder andere auch ernst zu nehmen ist, wobei man in der Übung bleiben sollte, wenigstens ab und an über sich zu lachen.
Nach wie vor überkommt mich jedoch das schlechte Gewissen, wenn ich nichts zu Papier bringe. Meine Eltern mussten sich schwer arbeitend ihr Leben verdienen. Und mir erging es nicht anders in verschiedenen Berufen, die ich ausübte. Ich fühle mich unzufrieden, nutzlos belastet, wenn ich nicht gearbeitet habe. Irgendwie schuldig. Hier wirkt wohl die Erziehung nach; es hat mich keiner gelehrt, faul zu sein, was ja für Zeiten der Entspannung gut und richtig, ja notwendig ist.
Weshalb schreiben Sie?
Nicht eine abstrakte Idee führt mich zu einer Geschichte, sondern ein starkes Gefühl, das aus einer Beziehung zu einem oder mehreren Menschen, also auch zur Gesellschaft insgesamt entstanden ist. Wut und Verzweiflung können dabei ebenso starke Motive wie Freude und Lust sein. Zweifel und Gewissheit sind dabei sich bekämpfende Geschwister.
Es ist doch so: Hätte ich ein sonniges Gemüt, würden mich Konflikte abstoßen und nicht anziehen. Wollte ich Menschen und Welt belassen, wie sie sind, und wäre nicht darauf aus, sie zu bessern, müsste ich nicht versuchen, Leben durch Kunst zu kompensieren. Ich gehöre wohl zu den ewig Unzufriedenen, die keine Nörgler sein wollen und sich durch Fleiß und Engagement aus diesem misslichen Zustand, an Ideale gebunden zu sein, befreien wollen. Der Besserwisser hat nur eine Entschuldigung: das Bessermachen.
Mir scheint, dass in all Ihren literarischen Arbeiten ein großer autobiografischer Anteil steckt?
Ja. Mit dem Schreiben von Geschichten habe ich - nach langem Suchen - eine Möglichkeit gefunden, diese Unruhe in mir in eine Form zu bringen, ähnlich wie bei einer Uhr, wo sie ein kompliziertes Getriebe in Gang setzt, das dann die Zeit anzeigt. Es ist wohl immer wieder der gleiche Typus Mensch, den ich losschicke, der wie im Märchen die Prüfungen des Lebens bestehen muss, bevor er (vielleicht) aus den Händen seiner Schönen den goldenen Apfel erhält.
Ich wurde und werde mit meinem Erleben nicht fertig. Im Berlin der Fünfzigerjahre studierte ich an der Fachschule für Artistik. Eigentlich war ich darauf aus, die behüteten Spiele der Kindheit fortzusetzen, fest im Glauben an die eigene Unsterblichkeit und voller Vertrauen auf die eigene Kraft. In einem Alter (ich war damals achtzehn), in dem man nach Verlassen des zu eng gewordenen Elternhauses ein allumfassendes Zuhause sucht, sich von der mütterlichen Liebe in die zur Geliebten befreien will und voller Ideen der Weltveränderung ist, wurde die geteilte Stadt für mich zur Erfahrung von Weltprinzipien: die Machtkämpfe, das verwirrende Spiel der Gegensätze, die Verlockungen äußeren Glanzes und die Verstrickungen der Seele in Glauben und Wissen, das Alleinsein in einer Millionenstadt. Mein Anspruch, eigene Interessen durchzusetzen, an Wesentlichem mitzudenken und mitzutun, das Bild vom Selbst zu finden und zu festigen, überforderte mich. Ich flüchtete mich in Krankheit. Da war ich erst einmal entschuldigt vor mir selbst und den anderen. Es hat lange gedauert, bis ich begriff, dass man, wohin man auch geht, immer sich selbst mitnimmt. Ich musste Mittel und Wege finden, mich zu mir selbst zu bekennen, mich in ein Ganzes einzuordnen, ohne mich zu verlieren, meinen Idealen treu zu bleiben, ohne Realität aufzugeben, einfach zu begreifen, dass das eine nichts ist ohne das andere. Da keiner von uns ein anderer werden kann, ist Schreiben für mich eine Schule geworden, in der ich mich zugleich als Lehrer und Schüler empfinde. Es ist eine Schule mit dem Hauptfach: Charakterbildung.
Ihr erstes Buch war eines für Kinder. Diesen blieben Sie auch treu, als Sie bereits Geschichten für Erwachsene geschrieben hatten. Was bedeutet es Ihnen, für Kinder zu schreiben?
Kinder leben in derselben Welt wie Erwachsene. Wenn ich für Kinder schreibe, darf ich Ihnen keine Welt vorgaukeln, die sie in ihrem Denken und Fühlen von der Welt der Erwachsenen entfernt. Im Gegenteil. So fantastisch die Geschichte auch sein und auf welchem Stern sie auch spielen mag, es muss den Kindern durch das Lesen ermöglicht werden, „unsere Welt“ zu entdecken, eigene Zugänge zu ihr zu finden, sich in ihr als eigenständiges Wesen zu sehen und anzunehmen. Und das mit allen Bitternissen und Freudvollem; mit allem, was da ist und uns bewegt oder von uns bewegt wird.
Die Aufgabe von Kunst und Literatur sehe ich auch darin, der Seele Futter zu geben. Unsere Kinder sollen nie verlernen, sich mit Tieren und Pflanzen zu unterhalten, sich aus einer Decke ein Zelt und aus ein paar Steinen ein Schloss zu bauen. Und es muss blaue Hunde geben. Das Tor zum unermesslich reichen und für uns Menschen lebensnotwendigen Kelch der Fantasie muss jederzeit offen stehen.
Ich möchte den Kindern Mut machen, in einer Welt der Dinge, Namen und Nummern, mitten im Wettlauf anzuhalten wegen einer Hundeblume oder eines Käfers, den sie sich, die Augen geschlossen, ein Lächeln auf den Lippen, den nackten Arm hoch krabbeln lassen. Ich möchte ihnen Glauben geben, nicht an die Allmacht von Göttern und Menschen, sondern an sich selbst, was zugleich heißt, sie sollen Verantwortung übernehmen für unsere zerrissene Welt, die aber noch immer viel Schönes hat, für dessen Erhalt es sich zu kämpfen lohnt.