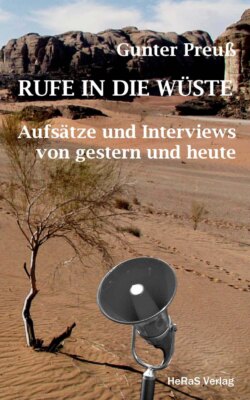Читать книгу Rufe in die Wüste - Gunter Preuß - Страница 15
12. „Warum?“ als Zauberformel (1986)
ОглавлениеDas Gespräch führte: Ilona Rühmann
„Annabella und der große Zauberer“ heißt ein Buch, das demnächst im Kinderbuchverlag Berlin erscheint. Es ist eins von der Sorte, die Kindern und Eltern gleichermaßen Vergnügen und Nachdenklichkeit bescheren können – sofern die Älteren den Jüngeren beim Lesen über die Schulter schauen.
Sein Autor, Gunter Preuß, erhielt in diesem Jahr den Alex-Wedding-Preis der Akademie der Künste für seinen Beitrag zur Kinder- und Jugendliteratur der DDR. Im Mittelpunkt seiner Bücher stehen oft Mädchen – als literarische Helden mit ungewöhnlichen Zügen.
Sie sind ein äußerst produktiver Autor. Warum haben Sie das Schreiben zum Beruf gemacht?
Angefangen habe ich mit idyllisierenden Kindergeschichten. Ich wollte der zerstrittenen Erwachsenenwelt eine freundlichere Welt entgegensetzen. Aber das half nicht, die Probleme zu benennen und vielleicht sogar aus der Welt zu schaffen. Nach eigenen bitteren Erfahrungen wurde Schreiben für mich zum Mittel, andere Menschen in ein lebenswichtiges „Frage- und Antwortspiel“ einzubeziehen.
Die Kinderliteratur in unserem Land verdankt ihren guten Ruf der Tatsache, dass sie jungen Lesern keine Extra-Welt anbietet, sondern die Welt zeigt, in der Kinder und Erwachsene miteinander leben. Ihre Kinderbücher sind Beispiele dafür. Sie schreiben auch für Erwachsene. Was machen Sie bei Kinderbüchern anders?
Erwachsene haben mehr Erfahrungen, für sie kann ich Probleme umfassender, zugespitzter, in größeren Zusammenhängen darstellen. In meinen Kinderbüchern ist die Welt nicht weniger kompliziert. Aber der gezeigte Wirklichkeitsausschnitt ist überschaubarer, ähnlich einer Kurzgeschichte, seine Gestaltung verlangt einesteils mathematische Genauigkeit und anderenteils die Freiheit der Poesie. Ich versuche ein Kinderbuch so zu schreiben, dass der Leser darin Fuß fassen kann und sich ein paar Schritte weiter in die Welt vorwagt, aber noch die Chance hat, sich darin zurechtzufinden.
Verständnis für die Seele eines Kindes zeichnet Ihre Bücher aus. Wie bewahren Sie sich das?
Das Kind, das jeder von uns einmal war, steckt wohl lebenslänglich in uns. Kindheit, als Zeit des Werdens und der Bewusstseinserweiterung, hat auch in der Literatur für Erwachsene enorm an Bedeutung gewonnen – ein exemplarisches Beispiel dafür ist Christa Wolfs „Kindheitsmuster“. So richtig wohl in unserer Haut fühlen wir uns anscheinend nicht, mit unserem Erwachsenwerden sind wohl durch Verletzungen auch hässliche Verwachsungen entstanden. Wir möchten wissen, wie das passieren konnte und lassen noch einmal das Kind sichtbar werden, dass wir über die Jahre in uns eingesperrt haben. Dem Künstler gestattet man noch am ehesten, seinen Spieltrieb, eine gewisse Naivität und seine ungebrochene Empfänglichkeit für alles Neue mit ins Erwachsensein zu nehmen. Ohne dieses kindhafte Vermögen die Realität mit der Fantasie zu erweitern könnte ich nicht schreiben. Ob ich aber als Erwachsener wirklich das Fühlen eines Kindes treffe, darin liegt für mich auch immer eine gewisse Unsicherheit. Und das ist wohl gut so, um nicht „liederlich“ zu werden.
Julia im gleichnamigen Buch wagt es, den erfolgreichen Klassenleiter in Frage zu stellen und gegen die ganze 8 b Partei für die neue Lehrerin zu ergreifen. In „Tschomolungma“ ist Peter vom höchsten Berg der Erde fasziniert, versagt aber vor dem alten Wachtturm, den jeder Junge der Klasse bereits bezwungen hat. Und die 14-jährige Luise in „Feen sterben nicht“ schreibt Briefe an die Märchenfee Scheherezade, weil sie verunsichert ist von den Veränderungen im Elternhaus, im Freundeskreis, in den eigenen Empfindungen. Sie begreift, dass das Leben nicht nur gut und schön ist und man nicht aufhören darf, nach anderen Menschen zu fragen. Immer wieder wenden Sie sich diesem Thema zu: Sie zeigen mit großem Einfühlungsvermögen junge Leute auf der Suche, auf dem Weg zu sich selbst, beschreiben das komplizierte Reifen von Persönlichkeiten.
Es reizt mich, die im Menschen versteckten Möglichkeiten zu einer selbstbestimmten Existenz zu gelangen, aufzuspüren und den Werdegang zu gestalten. Oft sind die verschiedenen Lebensansätze im Widerstreit. Daraus erwachsen für den Erzähler, der die Dramatik nicht ausschließt, durchaus reizvolle Probleme. Vor allem junge Leute, die noch nicht ausreichend reflektieren können, haben es mit dem inneren Widerspruch besonders schwer. Sie wollen am Althergebrachten rütteln und es womöglich umwerfen, sie wissen aber noch nichts Gleichwertiges oder gar Besseres dafür aufzubauen. Ausbruchsversuche und das Bedürfnis, bemuttert zu werden, wechseln einander ab. Die Umbruchphase zwischen Kind sein und Erwachsenwerden ist schon eine ganz besondere Konfliktsituation, die in ihrer Problemvielfalt prägend für den weiteren Lebenslauf ist. Das Thema beschäftigt mich immer wieder: Erkenne dich selbst, entwickle was dir gegeben ist, versuche nicht mit Macht, ein anderer zu sein.
Sie nannten Kindheit einmal den „Einstieg des Menschenwesens in seine Zeit“. Ihre Helden erleben Krisen auf dem Weg zu sich selbst. Ist Erwachsenwerden wirklich so schwer?
Nun, der Körper wächst von allein, aber ein „freier Geist“ will erarbeitet sein, und die „liebe Seele“ soll keine Ruhe haben, sie soll empfänglich sein für eigene Signale und das Mitfühlen erlernen. Das geht nicht ohne kleine und große Konflikte, die zumeist nicht offen ausgetragen oder in einem Ersatzproblem versteckt werden. Aber im stillen Kämmerlein kann ich nicht wachsen, und wenn ich mich finden will, dann muss ich mich in den anderen suchen. Das heißt, ich muss mich der Welt stellen, in die ich hineinwachsen will.
Ich gestalte Einzelbeispiele, die zuspitzen sollen, was ich bei Heranwachsenden für wünschens- und erstrebenswert halte: frei, eigenständig und aufrecht laufen zu lernen. Wir nehmen aber unsere Kinder lieber an die Hand als dass wir sie auf die eigenen Beine stellen. Wir wollen immer alles fest im Griff haben und dabei lässt sich doch nichts festhalten.
Es ist noch gar nicht so lange her, da unterschieden sich Mädchen in ihren Träumen und Taten erheblich von den Jungen, und so stand es auch in den Büchern. Reste des traditionellen Rollenbildes sind immer noch zu finden. „Ihre „Julia“ und Luise aus „Feen sterben nicht“ tragen dagegen interessante neue Züge. Warum wählen Sie so häufig Mädchen als literarische Helden, und welche Konsequenzen hat es, wenn Sie einen Jungen oder ein Mädchen in den Mittelpunkt stellen?
Ich denke, Literatur hat auch die Aufgabe, mit der Jahrhunderte währenden Ungerechtigkeit gegenüber den Frauen aufzuräumen. Ich habe als Mann kein Problem, Frauen als gleichwertige und gleichberechtigte Menschen zu sehen. Frauen könnten, wenn Männer es denn zuließen, sehr viel Eigenes in unsere zerstrittene Welt einbringen; vielleicht lässt sich ja mit „Weiblichkeit“ eher Vernunft und Toleranz durchzusetzen. Die von Männern dominierte Welt zeigt uns bis auf den heutigen Tag eine Menschheitsgeschichte voller Kriege und Mord und Totschlag. Die Männer können sich einfach nicht „kultivieren“, sie kommen aus ihrer gewalttätigen Pascharolle nicht heraus, ihr Ego will ständig mit Unterwerfungen und Dominanzgehabe gefüttert werden. Frauen können auf die friedvolle Präsenz ihrer Mütterlichkeit bauen, sie besitzen kraftvolle Impulse zum Bewahren des Lebens, und ihr Selbstwertgefühl beziehen sie nicht aus Gewalttaten. Sie sollten endlich mehr Macht ausüben, ohne dabei in die Hosenrolle zu schlüpfen. Dabei würden sie nur an Weiblichkeit verlieren, und alles bliebe wie gehabt.
Im Annehmen dieser Thematik sehe ich auch eine Fundgrube für die Literatur, auch für die Kinder- und Jugendliteratur. Wenn Bücher bewusstseinformend in Gesellschaftsprozesse eingreifen können, dann doch vor allem bei Kindern. Alle Grundsteine für ein durchs Leben tragendes Fundament werden ja in den ersten Lebensjahren gelegt.
Ob nun der Held eines Buches ein Mädchen oder ein Junge ist, hat für die Details der Geschichte sicher viele Konsequenzen. Aber im Wesentlichen bewegen sich in meinen Überlegungen Jungen und Mädchen charakterlich aufeinander zu: Jungen sind auch verträumt und sensibel, Mädchen rebellisch und tatkräftig, die Geschlechter sind ja einander verwandt und dennoch verschieden. Ich erfinde also kindliche und jugendliche „Helden“, die sich selbst und somit auch die Erwachsenen herausfordern, die aus dem Laufgitter ausbrechen und sich auf eigenen Wegen versuchen. Vielleicht ist das bei Mädchen spannender, weil man es von ihnen weniger erwartet.
Ihr neues Buch, „Annabella und der große Zauberer“, erzählt wieder von einem ungewöhnlichen Mädchen. Annabella entdeckt das „Warum?“ als Schlüssel zu wichtigen Lebenserkenntnissen. Sie variieren damit wieder ihr Grundthema – diesmal für Leute, die gerade das Lesen gelernt haben.
Annabella ist ein Widerspruchsgeist, eine kleine Rebellin. Sie ist nicht bereit, die Welt so hinzunehmen, wie sie ihr zur schnellen Anpassung vorgesetzt wird. Die alte Frau, bei der sie mit ihren Eltern lebt, lehrt sie, ihre Fantasie zu gebrauchen. Aber Annabellas Fantasiegeschichten kollidieren mit dem wirklichen Leben. Das „Warum?“ wird für sie zur weltbewegenden Frage, es hilft ihr Brücken zu bauen von der Realwelt in eine Fantasiewelt und zurück. Damit fordert sie die unumstößlich installierte Erwachsenenwelt heraus, die strikte Einordnung und letztendlich Unterwerfung verlangt. Dem sperrt sich Annabella nicht, weil sie böse ist oder stören will, sondern um zur Selbstbehauptung Erfahrungen zu sammeln.
Was können Ihre Leser außerdem in der nächsten Zeit von Ihnen erwarten?
1987 wird im Verlag „Neues Leben“ die Erzählung „Frau Butzmann und ihre Söhne“ erscheinen. Das ist eine Geschichte, die danach fragt, ob bei der rasanten technischen Entwicklung uns „Naturwesen“ genügend Zeit bleibt, dies alles zu verarbeiten und schließlich nicht selbst zum Ding zu werden. Der Verlag „Tribüne“ bereitet die Herausgabe der Erzählung „Das Kind aus dem Brunnen“ vor, der „Postreiterverlag“ das Kinderbuch „Margit mit der Stupsnase“. Außerdem habe ich zwei Theaterstücke geschrieben, über ihre Aufführung ist noch nicht entschieden.