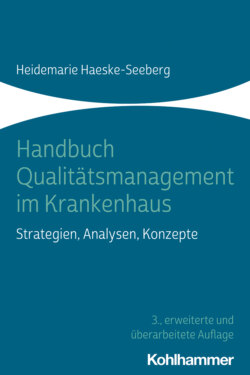Читать книгу Handbuch Qualitätsmanagement im Krankenhaus - Heidemarie Haeske-Seeberg - Страница 124
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ursache-Wirkungs-(Ishikawa-)Diagramm
ОглавлениеWozu es dient:146
• Es hilft der Gruppe, sich auf den Inhalt des Problems oder Zustandes zu konzentrieren (und nicht auf dessen Geschichte oder unterschiedliche persönliche Interessen der Teilnehmer).
• Es stellt eine Momentaufnahme des Wissens der Gruppe dar und sorgt für Unterstützung der daraus abgeleiteten Lösungen.
• Es richtet die Gruppe auf Ursachen aus (und nicht auf Symptome).
Zur Erstellung eines Ursache-Wirkungs-Diagramms wird zunächst die Wirkung – als das Problem, um das es geht, die Aufgabe, die gelöst werden soll – möglichst präzise auf einer Karte formuliert und rechts auf einer Pinnwand angebracht. Danach werden die Rubriken festgelegt, in denen man die Ursachen suchen will. Diese sollten möglichst umfassend sein, denn der Effekt des Ursache-Wirkungs-Diagramms ist es ja gerade aufzuzeigen, dass die wirklichen Ursachen an anderen Stellen liegen, als zunächst vermutet. Hat man noch nicht so viel Übung mit einem Ursache-Wirkungs-Diagramm, so haben sich die Bereiche: Mensch, Maschine, Milieu, Material, Methode, Messung als immer mögliche Rubriken bewährt. Ein erfahrener Moderator wird in der Lage sein, spezielle Rubriken mit der Gruppe oder selbstständig zu formulieren. Die Karten mit der jeweiligen Rubriken-Bezeichnung werden in einer Fischgrätenstruktur zur Karte mit der »Wirkung« angebracht. Aus diesem Grund wird das Ursache-Wirkungs-Diagramm auch als »Fischgräten-Diagramm« bezeichnet.
Nun werden pro Rubrik ein Brainstorming oder eine Kartenabfrage durchgeführt und alle von den Beteiligten wahrgenommenen oder ihnen bekannten Ursachen, die zu der unerwünschten Wirkung, zum Problem führen, einzeln auf Karten notiert. Die Karten werden der Reihe nach an den »Hauptgräten« angebracht.
Nun beginnt der schwierigste Arbeitsschritt, das Zuordnen von Einzelursachen und Nebenursachen. Dabei fragt der Moderator jeweils pro Ursache: »Und warum ist das so?«. Dabei zeigt sich, dass zahlreiche, zunächst als Einzelursachen gruppierte Karten Nebenursachen werden und voneinander abhängen bzw. einander nach sich ziehen. Bei der Zuordnung der Nebenursachen spielt die Rubrik keine Rolle mehr. Es entsteht nach und nach ein sich verzweigendes Bild von »Nebengräten« ( Abb. 34). Dabei kann das Schreiben von noch weiteren Karten nötig werden, die zunächst bei der Ursachensammlung nicht formuliert wurden.
Wichtige Aufgabe des Moderators ist es, rechtzeitig mit der Ursachenforschung aufzuhören. Als Faustregel kann gelten, immer dann mit der Frage: »Und warum ist das so?« aufzuhören, wenn die Ursache zwei Hierarchieebenen über der der Mitglieder der Gruppe angesiedelt ist. Hier kommt man in Bereiche, die durch die Führung des Unternehmens zu regeln sind. Die Mitglieder der Gruppe haben kaum mehr eine Möglichkeit, diese Ursachen zu beseitigen und für sie durchsetzbare Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Die gefundenen Ursachen in diesem Bereich können ggf. dokumentiert werden. Die weitere Arbeit der Gruppe sollte sich den lösbaren Problemen zuwenden.
Die Anwendung des Ursache-Wirkungs-Diagramms ist schwieriger als die der Anwendung anderer Qualitätszirkel-Werkzeuge. Es sollte erfahrenen Moderatoren vorbehalten bleiben. Will man in die Arbeit mit dem Ursache-Wirkungs-Diagramm einsteigen, kann es hilfreich sein, es zunächst nur bis zur strukturierten Ursachensuche
Abb. 34: Ursache-Wirkungs-Diagramm
mittels Brainstorming oder Kartenabfrage für die einzelnen Rubriken einzusetzen und sich erst bei einiger Übung in der Moderation an die weiteren Arbeitsschritte heranzutasten.
Heute wird das Ursache-Wirkungs-Diagramm auch als Root-Cause-Analysis bezeichnet und findet im klinischen Risikomanagement in der Fallanalyse Anwendung.