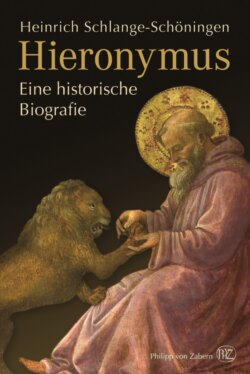Читать книгу Hieronymus - Heinrich Schlange-Schöningen - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
Eine Trauerfeier in Rom
ОглавлениеIm Jahre 384 wurde in Rom eine junge Frau unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit zu Grabe getragen. Blesilla war nur zwanzig Jahre alt geworden. Da sie aus einer der führenden Familien der Stadt stammte, begleiteten viele Menschen, hoch und niedrig, den Trauerzug. Als älteste Tochter des römischen Senators Toxotius und seiner Frau Paula verkörperte Blesilla die lange Geschichte Roms: Ihre Mutter stammte aus der Familie der Aemilier und zählte zu ihren Vorfahren so berühmte Männer wie Lucius Aemilius Paullus, der 168 v. Chr. Makedonien unterworfen, oder Scipio Africanus Minor, der 146 v. Chr. Karthago besiegt und zerstört hatte.1
Unter den Trauernden befand sich auch Hieronymus, der mit der Familie der Toten eng verbunden war. Blesillas Mutter Paula hatte sich nach dem Tod ihres Mannes dafür entschieden, ihren christlichen Glauben in einer betont asketischen Lebensführung zu praktizieren, und ihre Töchter folgten ihr auf diesem Weg, für den sich Hieronymus als Seelenführer hatte empfehlen können. In häufigen Zusammenkünften mit Paula und ihren Töchtern waren moralische und theologische Fragen erörtert worden, und auch mit Blick auf ein breiteres Publikum hatte Hieronymus Briefe an die Frauen verfasst, um sie in ihren asketischen Bemühungen zu unterstützen. Was er 384 nach dem Tod der jungen Blesilla sehen und hören musste, gefiel ihm allerdings nicht. Kurze Zeit nach der Trauerfeier schrieb er einen Brief an Paula, mit dem die Mutter weniger getröstet als vielmehr zur rechten christlichen Demut ermahnt werden sollte. Denn was gab es zu trauern, wenn ein junger Mensch das weltliche Jammertal verlassen durfte?
„Nachdem Blesilla die Last des Fleisches abgelegt hatte, die Seele zu ihrem Schöpfer zurückgeflogen und nach langer Wanderung zu ihrer ursprünglichen Heimat zurückgekehrt war, wurde die übliche Leichenfeier veranstaltet. Die Reihen der Adeligen gingen vorauf, und eine golddurchwirkte Hülle breitete sich über der Bahre aus. Mir schien es, als riefe Blesilla vom Himmel herab: ‚Dieses Gewand ist nicht das meine; diese Umhüllung gehört mir nicht; solcher Pomp ist mir fremd.‘“2
Hieronymus störte sich an den traditionellen heidnischen Elementen, die auch einer christlichen Bestattung noch anhafteten, zumal, wenn es sich bei den Verstorbenen um Angehörige des senatorischen Adels handelte, der führenden Schicht der römischen Gesellschaft. Das Renommee, das Hieronymus als Moraltheologe und Präzeptor in den achtziger Jahren des 4. Jahrhunderts in der alten Hauptstadt des Reiches gewonnen hatte, beruhte auch darauf, dass er Zugang zu diesen führenden Kreisen besaß.3 Und seine Stellung erlaubte es ihm, klare moralische Richtlinien zu formulieren: Mit einem neuen, aus dem Glauben und der Glaubenspraxis gewonnenen Adel sollten die frommen, unter seiner Leitung stehenden Frauen ihren alten, aus ihrer sozialen Stellung entspringenden Adel übertreffen.4
Paula und Blesilla waren diesem Programm gerecht worden. Paula verfügte über ein riesiges Vermögen und begann damals, ihre Einkünfte für die Armen und Kranken in Rom zu verwenden. Nicht viel später, gegen Ende des Jahrzehnts, finanzierte sie den Bau der Klöster in Bethlehem, in denen sie und Hieronymus den Rest ihres Lebens verbringen sollten. Nach ihrem Tod erinnerte Hieronymus in einem Nachruf daran, dass die Wohltätigkeit Paulas in ihrer eigenen Familie auf Widerspruch gestoßen war, von dem sie sich aber nicht beeindrucken ließ. Durch die reichen Spenden hatte Paula ihr Vermögen erschöpft, „doch den Verwandten, die sie deswegen schalten, gab sie zur Antwort, sie hinterlasse ihren Kindern mit der Barmherzigkeit Christi eine noch größere Erbschaft“.5
Paulas Tochter Blesilla war erst seit vier Monaten verheiratet gewesen, als ihr Mann verstarb. Zunächst setzte sie auch als Witwe das luxuriöse Leben einer reichen Römerin fort. Dann aber erkrankte sie schwer, und sie scheint diese Krankheit als Strafe für ein sündiges Leben verstanden zu haben. Denn nachdem sie wieder zu Kräften gelangt war, bekehrte auch sie sich unter dem Einfluss von Hieronymus und Paula zu einem asketischen und glaubensstrengen Leben. Ihre christliche Bildung, ihre Demut und ihre Glaubensstärke werden in dem Trostbrief, den Hieronymus kurz nach ihrem Tod an Paula schrieb, in den höchsten Tönen gelobt. In bescheidener Kleidung und mit blassem Gesicht habe sie sich kaum auf den Füßen halten können, dabei aber immer die Schrift eines Propheten oder ein Evangelium in den Händen gehalten. Und in ihrer letzten Stunde habe sie nur darüber geklagt, dass sie ihren Entschluss, in ein Kloster einzutreten, nicht mehr habe umsetzen können.6 Als Mutter dürfe Paula nun zwar Tränen vergießen, aber doch nur in Maßen, und als Christin müsse sie dann ihr mütterliches Gefühl zurückstellen, um nicht mit zu vielen Tränen ihren Glauben zu verleugnen und Gott zu lästern.7 Es war schon schlimm genug, dass Paula während des Trauerzuges außer sich geraten war und der breiten Menge ein Schauspiel des Schmerzes geboten hatte, das Hieronymus’ Stellung in Rom gefährden konnte:
„Allzu große Anhänglichkeit an die Seinigen kann zur Pflichtverletzung gegen Gott werden. Abraham tötet freudigen Herzens seinen einzigen Sohn, und Du beklagst Dich, dass ein Kind aus Deiner großen Kinderschar die Krone erlangt hat? […] Als man Dich ohnmächtig mitten aus dem feierlichen Leichenbegängnis hinwegtrug, da fing die Menge an zu raunen: ‚Haben wir es nicht oft genug gesagt, dass es so kommen wird? Paula weint um ihre Tochter, die ein Opfer des Fastens geworden ist. Sie ist untröstlich, dass sie nicht wenigstens aus deren zweiter Ehe Enkel zu sehen bekam. Wie lange mag es noch anstehen, bis man das abscheuliche Geschlecht der Mönche aus der Stadt vertreibt, mit Steinen zu Tode wirft oder in das Wasser stürzt? Sie haben die arme Paula verführt; denn jetzt zeigt es sich, dass sie keine Nonne sein wollte. Hat doch niemals eine heidnische Mutter so wie sie ihre Kinder beweint.‘“8
Zu dem „abscheulichen Geschlecht der Mönche“ wird manch ein Römer auch Hieronymus gezählt haben. Er war zwei Jahre zuvor, 382, gemeinsam mit zwei Bischöfen, Paulinus von Antiochia und Epiphanius von Salamis, von Konstantinopel aus nach Rom gekommen. Hier wollten die drei Männer vom Bischof Damasus eine Entscheidung revidieren lassen, die kurz zuvor auf dem zweiten ökumenischen Konzil in Konstantinopel gefallen war. Dort hatte man neben dem großen theologischen Problem der Trinität auch Fragen der Kirchendisziplin beraten und den Bischofsstuhl von Antiochia nicht Paulinus, sondern nach dem Tod des Meletius dessen Presbyter Flavian übertragen (s. S. 118).
Die Reisenden wurden in Rom in den Häusern christlicher Aristokraten beherbergt, und da Epiphanius bei der bereits verwitweten Paula wohnte, dürfte auch Hieronymus sie bald kennengelernt haben. Er war jünger als die beiden Bischöfe, hatte sich aber bereits einen Namen als christlicher Schriftsteller gemacht. Und er besaß Autorität als Asket. Denn Hieronymus hatte nicht nur eine Biographie des heiligen Einsiedlers Paulus geschrieben, sondern auch selbst einige Jahre in der syrischen Wüste gelebt. In Rom wurde Damasus schnell auf den gelehrten Asketen aufmerksam und zog ihn als Ratgeber an sich, hatte Hieronymus doch in Antiochia und zuletzt in Konstantinopel die aktuellen dogmatischen Auseinandersetzungen, von denen die Kirche des Ostens stärker betroffen war als die des Westens, genau kennenlernen können.
Mit Damasus im Rücken gewann Hieronymus in Rom an Einfluss. Bis zum Tod des Bischofs von Rom und dem der Blesilla, die beide gegen Ende des Jahres 384 verstarben, hatte er wohl kaum Kritik an seinen radikalen asketischen Positionen zu hören bekommen, wie sie dann in den Unmutsäußerungen während des Trauerzuges laut wurde. Widerspruch hatten seine Neuübersetzungen von Büchern des Neuen Testaments erfahren, doch meinte Hieronymus in Rom über so viel Rückhalt in den Kreisen der Kirche zu verfügen, dass er es sogar für möglich hielt, Nachfolger des Damasus zu werden.