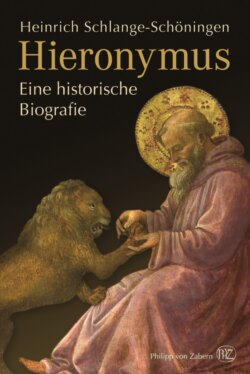Читать книгу Hieronymus - Heinrich Schlange-Schöningen - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Ideal der christlichen Askese
ОглавлениеMit welcher Vehemenz er seine asketischen Vorstellungen in Rom vertreten hat, zeigt sein Brief an Julia Eustochium, eine weitere Tochter der Paula. Das Schreiben an Eustochium (sie wird meistens nur mit diesem Namen bezeichnet) hat Hieronymus ebenfalls im Jahr 384 verfasst, allerdings geraume Zeit vor der Krankheit und dem Tod der Blesilla, und so lässt er hier seinen Forderungen nach Verzicht auf weltliche Freuden geradezu ungezügelten Lauf. Seiner Thematik und Länge wegen erscheint der Brief wie ein Traktat, der dem Ideal der Jungfräulichkeit gewidmet ist, und wie andere Briefe dieser Art war er nicht allein an die Adressatin, sondern an alle Christen Roms, ja des ganzen lateinischen Westens gerichtet.9 Da sich Hieronymus in dieser ‚Werbeschrift für die Jungfräulichkeit’ als asketisches Vorbild präsentiert, verrät sie einiges darüber, wie er sich selbst sah und wie er gesehen werden wollte. Und sie bringt mit dem berühmten Traum, in dem sich Hieronymus als Ciceronianer vor den Richtstuhl Gottes geschleppt sieht und in höchster Not aller heidnischen Bildung abschwört, ein gleichermaßen rhetorisch überwältigendes wie psychologisch zweifelhaftes Selbstzeugnis, vom dem aus sich die kulturellen Konflikte sowohl des Hieronymus als auch seiner Zeit genauer verstehen lassen.
Eustochium ist Hieronymus zufolge die erste junge Frau aus ‚besseren Kreisen‘, die sich für die dauerhafte Jungfräulichkeit entschieden hat. Deshalb muss sie ihrem Gelübde allen denkbaren Anfechtungen zum Trotz treu bleiben, um nicht nur nicht selbst zu straucheln, sondern auch der großen Verantwortung gerecht zu werden, die ihr als Muster rechten christlichen Lebens zukommt.10
In seinem Brief entwickelt Hieronymus eine theologische Begründung für die Askese, für die er sich auf den Apostel Paulus beruft. Dieser habe in seiner Körperlichkeit den Stachel des Teufels gesehen und ihre Überwindung als von Gott gestellte Aufgabe verstanden. Maßgeblich für dieses Verständnis sind die Worte, die Paulus an die Kolosser gerichtet hat: „‚Ertötet also‘, sagt der Apostel, ‚eure Glieder auf Erden.‘“11 Hieronymus verallgemeinert solche Aussprüche des Apostels, um mit ihm die höchste Legitimation für eine sich selbst strafende Askese zu gewinnen. Paulus, „das Gefäß der Auserwählung“, habe sich „wegen des Stachels des Fleisches“ und „wegen des Reizes zur Sünde“ selbst gezüchtigt.12
Auch wenn Hieronymus in seinem Brief an Eustochium das Fasten nicht ausführlich behandelt, weil er diesem Thema noch eine eigene Schrift widmen wollte (die er nach dem Tod Blesillas aber nicht mehr geschrieben hat), will er doch daran erinnern, dass die Heiligen Schriften „unzählige Aussprüche“ enthielten, „welche die Gaumenlust verurteilen und für einfache Kost eintreten“. Und da Adam seiner Gaumenlust wegen aus dem Paradies vertrieben worden sei, müsse es „unser ernstes Streben sein, dahin zu wirken, dass der Hunger die ins Paradies zurückführt, welche der Mangel an Enthaltsamkeit daraus vertrieben hat“.13 Auf der Grundlage dieses theologisch überraschenden Arguments, das aus der Verführung zur Erkenntnis eine Verlockung zur Völlerei macht, gelangt Hieronymus zu der praktischen Schlussfolgerung, dass die junge Eustochium ihre Freundinnen nach deren asketischer Leistungsfähigkeit auswählen soll. Nur die soll sie auswählen, die durch Fasten mager und deren Gesichter blass geworden seien.14
In eine theologische Grauzone gerät Hieronymus bei seiner anschließenden Warnung vor dem Verlust der Jungfräulichkeit. Denn sollte Eustochium auf diese Weise fehlen und fallen, könnte selbst Gott ihr nicht mehr helfen. Denn Gott kann zwar eigentlich alles, aber er kann doch einer gefallenen Jungfrau ihre Jungfräulichkeit nicht zurückgeben.15 Neben diesem Argument der Abschreckung steht das Versprechen, mit der Jungfräulichkeit dem Paradies nahe zu sein, denn der Mensch sei in seinem ursprünglichen Zustand ohne Geschlechtsleben gewesen. Erst als Eva ihre Blöße bedeckte, kam es zur ersten Ehe unter den Menschen. Die Ehe ist also das Kennzeichen des menschlichen Lebens nach dem Sündenfall.16
Damit will Hieronymus nicht generell den Wert der Ehe bestreiten. Er weiß, dass er mit seiner Position ohnehin schon für Ärger sorgt, denn viele Christen berufen sich auf Paulus, um den Ehestand zu rechtfertigen.17 So gesteht Hieronymus diesen Gegnern der Jungfräulichkeit auch zu, dass die Ehe eben den Sinn habe, neue Menschen zu zeugen, die dann ihrerseits jungfräulich leben könnten.18 Aber Hieronymus hält doch an seinem Ideal fest und verstärkt seinen Appell mit der Unterscheidung zwischen dem Alten und dem Neuen Bund zwischen Gott und den Menschen: Für den Alten Bund, der durch Eheschließungen und zahlreiche Geburten gekennzeichnet sei, stehe Eva, für den Neuen Bund dagegen die Jungfrau Maria. Und darüber hinaus argumentiert er auch noch eschatologisch: Da man sich in der letzten Phase der Geschichte befinde und Paulus die „bevorstehende Drangsal“ angekündigt habe, sei nun die Zeit gekommen, ganz auf Ehen zu verzichten.19
In den langen Ausführungen zu allen Gefahren und Sünden, die Eustochium bedrohen, zeigt sich, dass das moralische Konzept, das hier von Hieronymus vertreten wird, auf einer negativen Anthropologie beruht. Nach dem Sündenfall ist jeder Mensch in der Gefahr, sich in den Lastern zu verfangen, die zudem alle miteinander verbunden sind. Kann etwa eine Frau ihre Gier nach Nahrung nicht beherrschen, so ist damit zu rechnen, dass sie auch ihre Jungfräulichkeit verlieren wird.20 Nachdrücklich wird Eustochium vor Augen geführt, was ihr droht, wenn sie schwanger werden sollte. Denn Hieronymus weiß, dass ‚gefallene‘ Frauen oftmals abzutreiben versuchen. Koste die Abtreibung der schwangeren Frau aber das Leben, dann fahre sie, beladen mit dreifacher Schuld, „dem Selbstmord, dem Ehebruch gegen Christus und der Tötung des noch nicht geborenen Kindes, hinab in den Abgrund der Hölle“.21
Für Eustochium kann es aber nicht allein darum gehen, selbst jungfräulich zu bleiben. Sie muss auch darauf achten, dass sie Männer nicht zu erotischen Phantasien anregt, denn auch damit würde sie ihre Jungfräulichkeit gefährden. Sie wäre dann zwar noch eine „Jungfrau im Fleische“, nicht aber der Gesinnung nach.22 Die Verwirklichung des Ideals der Jungfräulichkeit, dem Eustochium folgen will und soll, beruht auf beständiger Selbstkontrolle, und diese kann nur gelingen, wenn eine Reihe von Regeln eingehalten wird. Hieronymus entwickelt einen ganzen Katalog von solchen Vorgaben, mit denen alle Bereiche des alltäglichen Lebens erfasst werden. Überall lauert die Gefahr des Hochmuts, der selbst ein Asket erliegen kann, wenn er seine Eitelkeit nicht bekämpft. Also muss sich Eustochium davor hüten, mit ihrer Demut und Bescheidenheit, mit Fasten und einfacher Kleidung Eindruck machen zu wollen.23 Sie soll deshalb den Kontakt auch mit den Mönchen und mit den Asketen meiden, die ihre Bußübungen öffentlich durchführen,24 und sich am besten selbst gar nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen.25
Die Rigorosität der asketischen Ideen, die Hieronymus vertritt, kulminiert in der vehementen Forderung, die sozialen Kontakte zu begrenzen oder besser noch ganz aufzugeben. Da sich Paula und ihre Töchter in den höchsten Kreisen der Gesellschaft bewegen, bedeutet dies konkret auch, dass Eustochium zukünftig keine Besuche in „vornehmen Häusern“ mehr machen soll. Die Frauen dort „bilden sich gerne etwas auf ihre Männer ein, wenn diese ein richterliches Amt oder sonst eine Würde bekleiden“, und sie wetteifern um die Gunst, die Frau des Kaisers bei sich begrüßen zu dürfen.26 Unausgesprochen wird hier von Hieronymus das Gefüge der Gesellschaft infrage gestellt: Für eine zu Jungfräulichkeit und Askese entschlossene Aristokratin wie Eustochium sind alle Kategorien des gesellschaftlichen und politischen Lebens außer Kraft gesetzt.