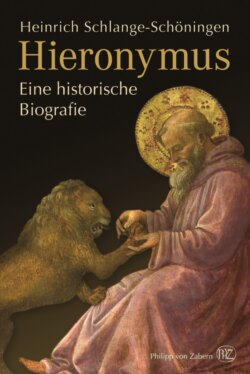Читать книгу Hieronymus - Heinrich Schlange-Schöningen - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eine christliche Erziehungslehre
ОглавлениеSeinen Kommentar zu Jesaia und die Apologie gegen Rufin hat Hieronymus wie noch viele andere Schriften während seines langen Lebens im Kloster von Bethlehem verfasst, und hier entstand auch ein Lehrbrief in Fragen christlicher Erziehung, in dem er ein radikales Gegenprogramm zu den Studieninhalten entwickelte, mit denen er sich selbst einst so intensiv und erfolgreich beschäftigt hatte. Dieser um 401 geschriebene Brief „Über die Erziehung der Tochter Paula“ war an Laeta gerichtet, die einige Jahre zuvor Toxotius, den Sohn von Hieronymus’ Freundin und Gönnerin Paula, geheiratet hatte. Ihr gemeinsames Kind hatten Laeta und Toxotius noch vor der Geburt Gott geweiht und damit für ein klösterliches Leben bestimmt. Nun erkundigte sich Laeta von Rom aus bei Hieronymus, wie sie ihre Tochter, die jüngere Paula, erziehen sollte.
Hieronymus entwickelte in seiner ausführlichen Antwort eine kompromisslose christliche Erziehungslehre, die alle heidnischen Einflüsse auszuschalten sucht. Jeder Kontakt zu Personen außerhalb des Hauses soll verhindert werden. Das Kind muss einfach gekleidet und einfach ernährt werden. Mit den Sklaven darf es nicht spielen und ein Besuch in den öffentlichen Bädern ist nicht gestattet. Gut wäre es auch, wenn die kleine Paula eine Freundin um sich hätte, die „in der Abtötung geübt, einfach gekleidet und etwas traurig ist“. Und sie soll zwar das Fasten nicht übertreiben – erinnert sich Hieronymus noch an den Tod der Blesilla? –, aber sie soll doch niemals ganz satt sein, sondern immer etwas Hunger spüren.
Der Brief gipfelt in dem Vorschlag, die kleine Paula aus dem sündigen Rom zu entfernen und nach Bethlehem zu schicken, damit sie im Kloster ihrer Großmutter erzogen werden kann.103 Und Hieronymus hat auch eine Idee, wie die kleine Paula lesen und schreiben lernen könnte, ohne mit der heidnischen Literatur und ihrer Götterwelt in Berührung zu kommen:
„Besorge ihr Buchstaben aus Buchs oder Elfenbein und lasse sie deren Namen lernen! Sie soll damit spielen, und sie wird aus dem Spiele Belehrung schöpfen. […] Laß sie Silben zusammensetzen und gib ihr, wenn’s gelingt, eine kleine Belohnung! […] Die Buchstaben, aus denen sie allmählich Worte zusammenfügt, sind nicht dem Zufall zu überlassen, sondern es sollen bestimmte, mit Absicht gewählte Namen sein, wie die der Propheten und Apostel und die ganze Reihe der Patriarchen von Adam an, wie sie sich bei Matthäus und Lukas findet.“104
Wenn sie erst einmal so weit ist, dass sie den christlichen Elementarunterricht hinter sich hat, dann soll sich Paula allein mit der christlichen Literatur beschäftigen. Jeden Tag, so empfiehlt Hieronymus, soll sie einige Abschnitte aus der Heiligen Schrift auswendig lernen, und zwar sowohl in griechischer als auch in lateinischer Sprache.105 Und außerdem gilt es, schrittweise die ganze Bibel zu erarbeiten. Dazu entwickelt Hieronymus ein regelrechtes Curriculum der christlichen Lektüre:
„Zuerst lerne sie das Psalterium, dessen Gesänge sie zerstreuen mögen; dann bilde sie ihr Leben an den Sprüchen Salomos! Aus dem Prediger lerne sie die Dinge der Welt verachten! Nach dem Beispiele Hiobs übe sie Tugend und Geduld! Dann gehe sie über zu den Evangelien, die sie eigentlich nie aus der Hand legen sollte. Aus der Quelle der Apostelgeschichte und der Briefe trinke sie mit der ganzen Inbrunst ihres Herzens! Sobald die Schatzkammer ihrer Seele mit diesen Kostbarkeiten bereichert ist, mache sie sich mit den Propheten und den ersten Büchern des Alten Testaments, weiterhin mit den Büchern der Könige und der Chronik sowie mit Esra und Esther vertraut! Zuletzt, wenn es ohne Gefahr geschehen kann, lese sie das Hohelied! Würde sie damit anfangen, so könnte sie Anstoß nehmen, da sie unter den fleischlichen Worten für das Brautlied der geistlichen Hochzeit kein Verständnis aufbringen dürfte. Sie hüte sich vor allen apokryphen Schriften! Sollte sie diese gelegentlich lesen wollen, nicht um die Wahrheit des Glaubens in ihnen zu suchen, sondern aus Ehrfurcht vor den Wundererzählungen, dann denke sie stets daran, daß sie nicht auf die angegebenen Verfasser zurückgehen. Vielmehr ist ihnen viel Falsches beigemischt, und es bedarf schon großer Klugheit, um das Gold aus dem Schmutze herauszufinden. Die Werke Cyprians seien ihr immer zur Hand! Die Briefe des Athanasius und die Schriften des Hilarius kann sie ohne Bedenken lesen.“106
Cicero kommt in diesem Studienplan nicht vor. Für die kleine Paula entwirft Hieronymus ein Leben, wie er es in seinem Traum gelobt, aber niemals selbst zu leben vermocht hat. Es ist eine Pädagogik nicht nur des Kulturbruchs, sondern auch der Selbstverleugnung.
Aber im Umgang mit der heidnischen Literatur hat Hieronymus doch bisweilen auch eine kompromissbereitere Position vertreten, wie sie etwa in einem Brief zum Ausdruck kommt, den er am Ende des 4. Jahrhunderts an den christlichen Rhetor Magnus geschrieben hat. Vermutlich handelt es sich bei Magnus um den durch eine auf seinem Sarkophag angebrachte Inschrift bekannten Flavius Magnus, der als „Redner der Stadt Rom“ am Ende seiner Tätigkeit mit dem Ehrenrang eines „Grafen erster Ordnung“ (comes primi ordinis) ausgezeichnet wurde.107
Magnus hatte bei Hieronymus kritisch nachgefragt, warum er denn in seinen Werken „zuweilen Beispiele aus der weltlichen Literatur anführe und so den Glanz der Kirche durch den Schmutz des Heidentums besudle“.108 Magnus selbst hat bei seinem Unterricht sicher nicht auf die klassischen Vorbilder der Beredsamkeit verzichten können, dabei aber vielleicht bewusst keine Verbindungen zu Werken der christlichen Literatur hergestellt. Gar zu sehr gehe Magnus wohl in den Werken Ciceros auf, so entgegnet Hieronymus. Denn sonst wüsste er, wie viele christliche Autoren seit Jahrhunderten die Heiden und ihren Irrglauben mit ihren eigenen Waffen bekämpft hätten. Keiner von ihnen hätte sich dabei gescheut, die eigene klassische Bildung in Apologie und Exegese unter Beweis zu stellen. Auch zur Abwehr christlicher Häresien sei die Kenntnis der antiken Philosophie notwendig, seien sie doch durch eine falsche Anwendung philosophischer Ideen auf die christlichen Glaubenslehren entstanden.109
Hieronymus stellt sich hier in die Tradition von Kirchenvätern wie Origenes oder Clemens von Alexandria, und er verweist über Philon und Josephus hinaus sogar auf Moses, Salomon und den Apostel Paulus. Sein Brief ist eine kurz gefasste christliche Literaturgeschichte in apologetischer Absicht. Dabei werden zahlreiche Autoritäten der frühen Kirche zu Hilfe gerufen, um eine Frage zu beantworten, die für das Christentum des späten 4. Jahrhunderts eigentlich längst geklärt war. Hieronymus aber fühlte sich persönlich herausgefordert und vermutete sogar, hinter der Anfrage des Magnus stehe sein Kontrahent Rufin.110 Ein einfaches Eingeständnis, dass die einst von ihm so geliebten heidnischen Autoren wie Cicero oder Plautus auch um ihrer selbst willen gelesen und studiert werden könnten, kam ihm dabei aber nicht über die Lippen. Vielmehr verwendet er ein Bild aus dem 5. Buch Mose, in dem erklärt wird, wie die Juden mit im Krieg gefangenen Frauen umzugehen hatten, wenn sie mit ihnen die Ehe eingehen wollten: Ihnen sollten zuvor alle Haare und Nägel kurz geschnitten werden.111 Nach diesem Vorbild will Hieronymus die „weltliche Weisheit wegen der Gefälligkeit des Ausdrucks und der Schönheit der Glieder in eine wahre Israelitin verwandeln“, womit er unfreiwillig zugesteht, dass die heidnische Literatur eben doch und immer noch einen großen ästhetischen Reiz auf ihn ausübt.