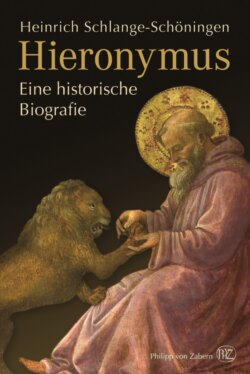Читать книгу Hieronymus - Heinrich Schlange-Schöningen - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Geburtsort Stridon
ОглавлениеAuch die Frage nach seinem Geburtsort bereitet Schwierigkeiten. Hier ist der Name des Ortes durch Hieronymus selbst sicher überliefert, aber unklar, wo er sich genau befunden hat. Treffend hat Hieronymus’ Biograph Georg Grützmacher 1901 vermerkt: „Wie um die Geburtsstadt Homers sieben Städte stritten, so haben mehr als sieben Städte den Ruhm beansprucht, der Geburtsort des Heiligen zu sein.“26 Seit Jahrhunderten ist mit viel Scharfsinn versucht worden, eine Lösung des Problems herbeizuführen.27 Ausgehen muss man dabei von den Abschnitten im Werk des Hieronymus, in denen er sich direkt oder indirekt über seine Heimat äußert; direkt, wenn er von der Ortschaft Stridon oder dem elterlichen Haus spricht, indirekt, wenn sich seine Briefe auf die nähere oder weitere Umgebung seines Heimatortes beziehen. An direkten Zeugnissen gibt es nur die folgenden drei:
Um das Jahr 393 hat Hieronymus einen Katalog christlicher Schriftsteller verfasst und damit ein Genre der traditionellen Literatur in die christliche Literaturgeschichte überführt. Während das erste „Verzeichnis berühmter Männer“ von Cornelius Nepos (100–28 v. Chr.) stammte und das Leben griechischer und römischer Könige, Feldherren und Autoren schilderte, hatte Sueton (70–122) den Titel für eine kurz gefasste Literaturgeschichte übernommen. Hieronymus begann seine chronologisch geordnete Sammlung von insgesamt 135 Kurzbiound Kurzbibliographien mit dem Apostel Petrus und konzentrierte sie mit Ausnahme von Philon und Seneca, die ihm als Zeugen für die Kirchengeschichte bedeutsam erschienen, auf christliche Schriftsteller, von denen etliche nur mehr durch dieses Verzeichnis bekannt sind.28 An das Ende dieser ersten ‚Patrologie‘ stellte er ein Verzeichnis seiner eigenen Werke, eine stolze Liste von 32 Schriften, die er bislang, also „bis zum vierzehnten Jahr der Herrschaft des Theodosius“ (393), veröffentlicht hatte. Und über sich selbst sagt er dabei:
„Die Zusammenstellung der kirchlichen Schriftsteller beende ich mit mir selbst, Hieronymus. Ich hatte Eusebius zum Vater und bin in Stridon geboren, einer Stadt, die an der Grenze zwischen Pannonien und Dalmatien gelegen ist und inzwischen von den Goten zerstört wurde.“29
Das zweite Zeugnis entstammt dem Kommentar, den Hieronymus wenige Jahre zuvor zum Propheten Zefanja geschrieben hatte. Dabei erläuterte er die Ankündigung von Gottes vernichtendem Strafgericht mit dem Hinweis auf die Zerstörungen, von denen das Illyricum und Thrakien in der jüngeren Vergangenheit betroffen waren, und er spezifizierte dies mit der Region, aus der er selbst stammte: „Dort ist alles zerstört; es gibt nur noch Himmel und Erde, wuchernde Dornenbüsche und Wälder.“30
Schließlich berichtet Hieronymus in einem Brief, den er gegen Ende des 4. Jahrhunderts an Pammachius geschrieben hat, dass er sich aufgrund der Finanznot seiner Klöster in Bethlehem dazu gezwungen sah, seinen Bruder Paulinianus auf eine Reise in die alte Heimat zu schicken, um die Reste des väterlichen Besitzes zu verkaufen. Hier ist von den „halbzerstörten Landhäusern“ die Rede, die „den Händen der Barbaren entkommen“ seien, und von den „Überresten des elterlichen Besitzes“.31 Offenbar hoffte Hieronymus, dass Teile des Besitzes nicht niedergebrannt worden waren; vielleicht waren sie den Plünderungen entgangen, nach den Angriffen der Goten aber aufgegeben worden. Da Hieronymus zwischen den Landhäusern und dem übrigen Besitz seiner Eltern unterscheidet, könnte die Familie ein Haus in Stridon und verschiedene Güter im Umfeld der Ortschaft besessen haben.
Aus diesen Informationen lässt sich sicher entnehmen, dass der Heimatort des Hieronymus auf dem westlichen Balkan lag. Stridon war eine Ortschaft, die sich im Grenzbereich zwischen Dalmatien und Pannonien befand, und Hieronymus bezeichnet sie zudem als oppidum. Könnte man hier den (auf den keltischen Raum bezogenen) Sprachgebrauch Caesars voraussetzen, müsste es sich um eine befestigte Siedlung gehandelt haben, doch ist diese Bedeutung für die Spätantike nicht zwingend vorauszusetzen. Oppidum kann schon zur Zeit der römischen Republik jede „stadtähnliche Siedlung ohne Rücksicht auf ihre Rechtsstellung“32 meinen. In der Regel wird man annehmen können, dass der Begriff auf einen „Zentralort“ verweist, „in dem sich das kommunalpolitische, administrative und jurisdiktionelle Geschehen“ einer Region konzentrierte.33 Im Falle vom Stridon ist darüber hinaus festzustellen, dass die dortige christliche Gemeinde keinen Bischof besaß, sondern unter der Leitung eines Presbyters stand. So muss ein Brief des Hieronymus verstanden werden, in dem er sich über die christliche Gemeinde in seinem Heimatort äußert.34 Sein Hinweis lässt vermuten, dass das oppidum Stridon verhältnismäßig klein gewesen sein dürfte.
Wo aber könnte sich das antike, dann zerstörte Stridon befunden haben? Jeder Versuch einer Lokalisierung muss von Hieronymus’ Angabe ausgehen, Stridon habe auf der Grenze zwischen Pannonien und Dalmatien gelegen. Was ist damit gemeint?
Die in der frühen Kaiserzeit eingerichtete Provinz Pannonien war im weiteren Verlauf der römischen Herrschaft zweimal geteilt worden; zunächst unter Trajan in das westlich gelegene Oberpannonien und das östliche Unterpannonien. Unter Diokletian entstanden im Rahmen einer Neuorganisation des gesamten Reichsgebietes die vier Provinzen Pannonia prima, Pannonia secunda, Pannonia Valeria und Pannonia Savia.35 Auch die unter Augustus geschaffene Provinz Dalmatia war von Diokletian neu zugeschnitten worden; ihre südliche Spitze wurde abgetrennt und der neuen Provinz Praevalitana (im Raum des heutigen Montenegro) zugeschlagen. Im Westen stießen Pannonien und Dalmatien an Italien.
Es war der französische Kirchenhistoriker Ferdinand Cavallera (1875–1954), der in seiner 1922 erschienenen Hieronymus-Biographie ein neues Argument ins Spiel brachte. Hatte man bislang den von Hieronymus verwendeten Ausdruck confinium einfach als Begriff für „Grenze“ verstanden, so führte Cavallera einige Passagen der antiken Literatur an, um zu belegen, dass der Begriff auch das Zusammentreffen von drei Teilen oder Landstrichen meinen kann.36 Auch Hieronymus hat den Ausdruck gelegentlich so gebraucht. Und zur Lokalisierung von Stridon habe er den Ausdruck nur deshalb verwenden können, weil er in diesem konkreten Sinne auf eine klar umgrenzte Region verweisen konnte. Allgemein verstanden, hätte confinium dagegen auf einen langen Grenzverlauf zwischen Dalmatien und Pannonien verwiesen und den Lesern keine brauchbare Information gegeben.
Der entscheidende Aspekt liegt bei diesem Argument also in dem Berührungspunkt, den die beiden genannten Provinzen mit einer dritten Region gehabt haben, und bei dieser kann es sich nur um die Provinz Moesien im Osten oder im Westen um Italien beziehungsweise die italienische Provinz Venetia et Histria gehandelt haben, deren Grenze zu den Balkanprovinzen östlich von Aquileia und westlich von Emona (Ljubljana) verlief.
Dalmatien im 4. Jahrhundert (nach einer Karte von R. Bratož).
Wäre Hieronymus am confinium von Dalmatien und Pannonien mit der Provinz Moesien aufgewachsen, dann hätte das nahe gelegene Sirmium, die Hauptstadt von Pannonia secunda und Sitz der illyrischen Präfektur, im Verlauf seiner Ausbildung oder im Rahmen seiner kirchlichen Kontakte eine Rolle spielen müssen. Da dies nicht der Fall ist, Hieronymus dagegen die Städte Aquileia und Emona gut kennt und Briefe dorthin schreibt, führt die confinium-These von Cavallera an die Westgrenze von Dalmatien. Und vielleicht kann man noch einen Schritt weiter gehen, wenn man überlegt, warum Hieronymus vom confinium zwischen Dalmatien und Pannonien, nicht aber zwischen Dalmatien und Italien beziehungsweise Istrien spricht. Vermutlich nennt er doch seine eigentliche Heimatprovinz an erster Stelle, und dass er Dalmater gewesen ist, wird auch durch andere spätantike Quellen bestätigt.37 Indem er sich auf Pannonien und nicht auf Italien oder Istrien bezieht, lokalisiert er das untergegangene Stridon nur in der Nähe, nicht aber im direkten Umfeld der Grenze zum westlich gelegenen Italien. Der Eintrag von „Stridonae“ auf der Karte von Rajko Bratož müsste folglich ein wenig nach Osten, in die Nähe von Kučar, verschoben werden.38
Nach diesen Überlegungen erscheint es plausibel, Stridon südwestlich von Poetovio (Ptuj) und damit in der Nähe der dreifachen Provinzgrenze zu verorten, vielleicht zwischen Praetorium und Neriodunum und jedenfalls auf dalmatischer Seite. Diese Lokalisierung passt auch dann, wenn man sich nicht darauf verlassen will, dass Hieronymus den Ausdruck confinium in dem von Cavallera betonten engen Sinn verstanden wissen wollte. Sie schließt dieses Begriffsverständnis aber nicht aus. Festzuhalten ist noch, dass Emona nach den jüngeren Forschungen von Marjeta Šašel Kos zur italienischen Provinz Venetia et Histria und nicht zu Pannonien gehört haben dürfte.39