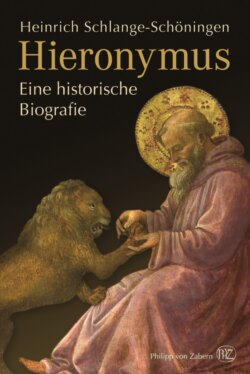Читать книгу Hieronymus - Heinrich Schlange-Schöningen - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Geburtsjahr
ОглавлениеSchon das Geburtsjahr stellt die Biographen vor das Problem, mit ungenauen bis widersprüchlichen Bemerkungen des Hieronymus und einer konkreten, aber doch wohl falschen Angabe einer anderen spätantiken Quelle umgehen zu müssen. Die Daten, die in der Forschung genannt wurden, variieren zwischen dem Jahr 330 – Hieronymus wäre dann noch unter dem Kaiser Konstantin geboren worden – und einem viel späteren Zeitpunkt um 350.2 Wie kann es zu so unterschiedlichen Datierungsvorschlägen kommen? Die Frage nach dem Zeitpunkt der Geburt ist nicht nur von chronologischer Relevanz für die Vita des Kirchenvaters, sondern auch deshalb bedeutsam, weil sich die Lebensumstände spätantiker Christen durch Konstantins Hinwendung zu ihrem Glauben stark veränderten. Da Hieronymus keinen Zweifel daran lässt, von seiner Kindheit an christlich erzogen worden zu sein, würde ein frühes Geburtsjahr die Annahme nahelegen, dass seine Eltern entschiedene und bekennende Christen und als solche noch Mitglieder einer minoritären Glaubensgemeinschaft gewesen wären. Ein späteres Datum führte dagegen in die Zeit der Söhne Konstantins, unter denen deutlich wurde, dass die religionspolitische Grundsatzentscheidung Konstantins nicht mehr revidiert, sondern vielmehr mit verstärktem Nachdruck umgesetzt werden würde.3 Die Christen stellten nun zwar noch immer eine Minderheit dar, doch stand ihr Glauben nicht mehr im Gegensatz zum römischen Staat; ihn zu bekennen, verlangte weniger Mut als zuvor.
Ein näherer Blick auf die Hinweise, die Hieronymus selbst zu seinem Geburtsjahr gibt, zeigt schnell, dass die Probleme der Forschung auch aus den Finessen seiner Rhetorik resultieren, die es ihm erlaubt, Begriffe zur Bezeichnung von Lebensaltern zur Beeinflussung seiner Leser ganz unscharf einzusetzen.
Unter den Briefen des Hieronymus befindet sich ein Schreiben, das er an seinen Kommilitonen Heliodor gesandt hat.4 Hieronymus wollte seinen Freund davon überzeugen, dass es für einen asketisch gesinnten Christen keinen besseren Ort zum Leben als die Wüste geben könne. Hieronymus war mit Heliodor in Antiochia zusammengetroffen, kurz bevor er selbst in die Wüste von Chalkis gezogen war. Heliodor dagegen war in den Westen zurückgekehrt, um wenig später Priester und schließlich Bischof im norditalienischen Altinum zu werden. Nicht lange nach seiner Ankunft in der syrischen Wüste versuchte Hieronymus, den Freund zu sich zu ziehen. Damit blieb er zwar erfolglos, aber sein Werbeschreiben für das christliche Wüstenleben fand eine breite Resonanz in den Kreisen christlicher Leser. Etwa zwanzig Jahre später sagt nun Hieronymus selbst in einem Brief an Nepotian, den Neffen Heliodors, über seinen früheren Brief an Heliodor, er sei zu der Zeit entstanden, als er als „Jüngling, fast noch als Knabe, die aufwallende Leidenschaft durch ein hartes Leben in der Einöde niederringen wollte“.5 Der zweifelsfreie Bezug auf seinen mehrjährigen Wüstenaufenthalt, den Hieronymus nach seiner Ausbildung in Rom, nach einem Aufenthalt in Trier, nach seiner Reise nach Antiochia und sicher vor seinem Aufenthalt in Konstantinopel, der in die Zeit des zweiten ökumenischen Konzils (381) fällt, in den mittleren siebziger Jahren des 4. Jahrhunderts absolvierte, wird hier also mit zwei Begriffen von Altersstufen verbunden, die Hieronymus als noch sehr jungen Menschen erscheinen lassen.
Zwar meinen die Begriffe „Knabe“ und „Heranwachsender“ zunächst nicht mehr als das Alter des Kindes und das des jungen Erwachsenen, doch wurde nach römischer Vorstellung aus dem Knaben ein Mann, wenn er im Alter von vierzehn oder fünfzehn Jahren die Männertoga anlegte. Als solcher war er in die zweite Lebensaltersstufe eingetreten, die dem antiken Verständnis zufolge bisweilen ohne weitere Differenzierung bis zum Beginn des Greisenalters reichen konnte, oftmals aber auch noch weiter unterteilt wurde.6 Nun hat Hieronymus sicher nicht als Kind in der Wüste gelebt. Wenn er einen solchen Eindruck hervorrufen will, so könnte dies dem von ihm selbst propagierten Vorbild des heiligen Eremiten Hilarion geschuldet sein. Ihm hat Hieronymus eine Vita gewidmet, in der er berichtet, Hilarion sei im Alter von fünfzehn Jahren in die Nitrische Wüste gegangen.7 Als rhetorisch überformte Aussage lässt sich seine Zeitangabe zur Abfassung des Briefes an Heliodor nur so verstehen, dass sich Hieronymus rückblickend für die Zeit seines Wüstenlebens näher an der Kindheit als am Greisenalter sah, das zwanzig Jahre später, zum Zeitpunkt des Briefes an Nepotian, angeblich schon erste Spuren in seinen Körper eingegraben hat.8 Hieronymus wird tatsächlich etwa im Alter von fünfundzwanzig Jahren in die Wüste gegangen sein und mit Mitte vierzig sieht er sich schon beinahe als alten Mann.9
Eine Bestätigung für die Annahme, dass die Kindheit des Hieronymus nicht unter Konstantin, sondern unter dessen Söhne fällt, findet sich in einer beiläufigen Bemerkung, die Hieronymus in einer seiner Übersetzungen von Werken Eusebs macht. Dieser hatte in griechischer Sprache ein Verzeichnis der Orte erstellt, die in der Bibel genannt werden (das Onomasticon urbium et locorum Sanctae Scripturae). Hieronymus übersetzte das Werk ins Lateinische, wobei er den Text Eusebs an einigen Stellen zusammenstrich, an anderen aber erweiterte.10 Das Interesse an der biblischen Topographie ergab sich aus dem exegetischen Postulat, jeden Begriff der Heiligen Schrift erklären zu können, aber daneben spielte auch die Aura des sakralen Raums eine wichtige und durch das spätantike Pilgerwesen immer größer werdende Rolle. Im Verlauf seiner zweiten Reise in und durch den Orient, die er nach dem Tod des Damasus antrat, und auch weiterhin während der vielen Jahre, die er in seinem Kloster in Bethlehem lebte, hat Hieronymus die Stätten der christlichen Heilsgeschichte aufgesucht, und so zeugen mache seiner Einträge in das eusebische Onomastikon von seiner eigenen Reisetätigkeit.
Etwa zwanzig Kilometer südlich von Bethlehem konnte der fromme Christ in den judäischen Bergen die Stadt Hebron und in ihrer näheren Umgebung die Ortschaft Mamre besuchen, wo sich die Eiche Abrahams befand.11 Unter ihr hatte der biblische Patriarch sein Zelt aufgeschlagen, als Gott mit zwei Begleitern erschien. Nachdem Abraham seine Gäste bewirtet hatte, wurden ihm und seiner Frau Sarah die Geburt des Sohnes angekündigt, auf den die beiden lange Zeit und bis in ihr hohes Alter vergeblich gewartet hatten.12
Als um das Jahr 325 Konstantins Schwiegermutter Eutropia durch Palästina reiste,13 musste sie feststellen, dass in Mamre ein heidnischer Götzendienst blühte. Um ihn abzustellen, beauftragte Konstantin seinen Statthalter Acacius, an diesem heiligen Ort alle Spuren des Heidentums zu zerstören und eine christliche Basilika zu errichten. Außerdem beschwerte sich Konstantin bei Macarius, dem Bischof von Jerusalem, sowie den übrigen Bischöfen Palästinas über die Missstände, die man in Mamre hatte einreißen lassen.14 Konstantin betonte die Dringlichkeit seines Anliegens und die besondere Bedeutung des Ortes, denn hier hatte sich seiner Auffassung nach Gott zum ersten Mal einem Menschen gezeigt. Der Kaiser befahl schnelles Handeln; dass die Basilika tatsächlich wenige Jahre später gebaut war und benutzt werden konnte, bezeugt der sogenannte Pilger von Bordeaux für das Jahr 333.15
Als Hieronymus nach Mamre kam, gab es den Baum, der im Mittelpunkt des heidnischen Kultes gestanden hatte, nicht mehr. Glaubt man seiner Angabe, ist er allerdings nicht unter Konstantin, sondern erst unter Constantius II. gefällt worden. Denn Hieronymus vermerkt unter dem Eintrag Drys, dem griechischen Begriff für Eiche:
„Eiche von Mamre, bei Hebron, wo bis in die Zeit meiner Kindheit und der Herrschaft des Constantius eine uralte Terebinthe zu sehen war, die ihr Alter durch ihre Größe zu erkennen gab; unter ihr wohnte Abraham. Von den Heiden wurde der Baum mit einem sonderlichen Kult umgeben und wie ein bedeutendes Gotteszeichen verehrt.“16
Abgesehen davon, dass Hieronymus – wie vor ihm bereits Josephus – nicht zwischen einer Eiche und einem Terebinthen-Pistazienbaum unterscheidet,17 ist sein Bericht ein Indiz für die zunehmend nachdrücklichere Umsetzung antiheidnischer und antijüdischer Maßnahmen unter den Söhnen Konstantins. Denn Konstantin hatte in seinem Brief an die Bischöfe Palästinas zwar verlangt, die „heidnischen Götzenbilder“ zu beseitigen, nicht aber den für die jüdische Religion bedeutsamen Baum zu fällen.
Für die Frage nach dem Geburtsjahr bringt der Lexikoneintrag eine aufschlussreiche Parallelisierung der Kindheit des Hieronymus mit der Herrschaft Constantius’ II. Da dieser Sohn Konstantins allein genannt wird, ist anzunehmen, dass Hieronymus nicht an die Zeit der gemeinsamen Herrschaft der Söhne Konstantins denkt, sondern an die 350 beginnende Epoche der Alleinherrschaft des Kaisers.18 Damit fiele die Kindheit des Hieronymus ebenfalls in die fünfziger Jahre des 4. Jahrhunderts und seine Geburt wäre auf die Jahre um 348 zu datieren.
Diese Datierung wird durch ein weiteres Selbstzeugnis bestätigt. In seinem in Bethlehem zu Beginn der 390er Jahre geschriebenen Kommentar zum Propheten Habakuk, der in seinem Gebet die gegen Ungläubige gerichtete Strafgewalt Gottes beschwört, erinnert Hieronymus an die Reihe der römischen Kaiser, die als Christenverfolger ein schnelles Ende gefunden hätten: „Zur großen Verwunderung [der Gläubigen] hast Du die Köpfe der Mächtigen zerteilt“, so übersetzt er Habakuk (3, 14) aus der Fassung der „Septuaginta“, um dann zu erläutern, dass dies zuletzt an Julian zu beobachten war und vor dem Apostaten an den Kaisern Maximian, Valerian, Decius, Domitian und Nero. In solchen Fällen konnten und könnten die Christen in ihrem Jubel den Vers des Propheten rezitieren. Um die Bedeutung des Ausdrucks „Verwunderung“ (stupor) deutlich zu machen, verweist Hieronymus auf das plötzliche, die Zeitgenossen überraschende Ende Julians, das er selbst miterlebt habe, als er „noch ein Knabe gewesen und sich in der Schule des Grammatikers geübt“ habe. Damals, so behauptet Hieronymus in völliger Übertreibung der antichristlichen Politik Julians, sei in allen Städten des Reiches das Blut der Märtyrer vergossen worden, bis plötzlich die Nachricht vom Tod des Kaisers verbreitet wurde.19
Wenn Hieronymus im Juni 363, als Julian im Perserkrieg seinen Verwundungen erlag, den Unterricht eines Grammatiklehrers besuchte, hatte er zu diesem Zeitpunkt die zweite Stufe des traditionellen Ausbildungsganges erreicht. Dieser führte über den Elementarunterricht, den man im Alter von sechs bis sieben Jahren begann, zum Grammatikunterricht, den man mit etwa zwölf bis sechzehn Jahren durchlief, und schließlich zum Unterricht beim Rhetoriklehrer, der noch einmal drei bis vier Jahre dauern konnte. Dann war ein junger Mann, wenn er fleißig studiert hatte, mit den notwendigen sprachlichen Kenntnissen ausgestattet, um eine staatliche Laufbahn anzutreten.20 Nach diesem Schema müsste Hieronymus, der 363 noch als „Junge“ (puer), also mit mindestens zwölf und höchstens fünfzehn Jahren, im Unterricht des Grammatikers saß, zwischen 348 und 351 n. Chr. geboren sein.
Dieses Zeitfenster kann noch etwas enger gefasst werden, wenn man einer weiteren Aussage Glauben schenkt. In seinem Kommentar zu Obadiah, den er 396 für seinen Freund Pammachius verfasst hat,21 berichtet er, diesen alttestamentlichen Propheten schon einmal kommentiert zu haben. Das sei sein erstes und ganz unzulängliches Werk nach dem Abschluss des Rhetorikstudiums gewesen. Seitdem seien dreißig Jahre vergangen.22 Damit hätte Hieronymus seine Studien im Jahr 366 beendet, wenn man auch nicht ausschließen kann, dass er mit der runden Zahl wieder nur einen ungefähren, aber einprägsamen Wert angegeben hat.23 Da Hieronymus am Ende seiner Ausbildung achtzehn oder neunzehn Jahre alt gewesen sein wird, kann die Frage nach seinem Geburtsjahr somit wenigstens ungefähr beantwortet werden. Die Geburt fällt aller Wahrscheinlichkeit nach in das Jahr 348 oder 349.
Diese Datierung passt allerdings nicht zu den vermeintlich klaren Angaben in der Chronik des Prosper von Aquitanien, der im 5. Jahrhundert die von Hieronymus übersetzte und erweiterte Chronik des Euseb seinerseits fortsetzte und dabei auch Ergänzungen in den Text des Hieronymus eingetragen hat. Prosper behauptet, Hieronymus sei 331 geboren worden und am 30. September 420 verstorben. Prosper erklärt außerdem, im Widerspruch zu seinen eigenen Angaben, Hieronymus sei 91 Jahre alt geworden.24 Zurückgerechnet vom Jahr 420 müsste Hieronymus dann bereits 329 geboren sein. Aber die beiden frühen Daten lassen sich in keiner Weise mit den Selbstzeugnissen vereinbaren und sind deshalb abzulehnen.25