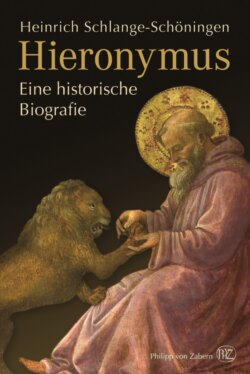Читать книгу Hieronymus - Heinrich Schlange-Schöningen - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Traum vom göttlichen Strafgericht
ОглавлениеDa Bildung ein Zeichen sozialer Distinktion ist, kann auch sie zum Hochmut verleiten. Hieronymus klagt über Frauen, die sündigen, indem sie ihre literarischen Kenntnisse zur Schau stellen. Sie begehen auf diese Weise einen „geistigen Ehebruch“, weil sie den einfachen christlichen Glauben durch gekünstelte Sprache verraten und sich mit ‚Bildungsfetzen‘ behängen.27 Solches Gehabe soll Eustochium vermeiden. Um hier eine klare Grenze auch zu den verderblichen Inhalten der heidnischen Literatur zu ziehen, zerschlägt Hieronymus zweimal hintereinander alle Verbindungen zwischen der traditionellen und der christlichen Bildung. Zunächst formuliert er eine generelle Konfrontation von heidnischen und christlichen Autoren, die das Bild völlig getrennter religiöser und kultureller Welten heraufbeschwört:
„Was hat Horaz mit dem Psalterium zu tun, was Vergil mit den Evangelien, was Cicero mit den Aposteln? Wird Dein Bruder nicht Ärgernis nehmen, wenn er Dich an einem Götzenaltar antrifft? […] Wir können nicht zu gleicher Zeit den Kelch Christi und den Kelch der Dämonen trinken.“28
Und da ihm diese rhetorisch gelungene, von seinem eigenen literarischen Werk indes nachdrücklich widerlegte Behauptung noch nicht ausreicht, greift Hieronymus zum Mittel der persönlichen Beichte, mit der Eustochium vor Augen geführt werden soll, dass die Warnungen und Ratschläge nicht allein theoretischer Natur, sondern aus dem Erleiden ihres Autors erwachsen sind. Hier soll ein längeres Zitat folgen, denn der Traumbericht, den Hieronymus im 30. Kapitel seines Briefes an Eustochium niedergeschrieben hat, ist von großer Bedeutung für das Bild, das sich spätantike Zeitgenossen und mehr noch spätere Leser von Hieronymus gemacht haben.
„Vor vielen Jahren verließ ich Heimat, Eltern, Schwester und Verwandte und verzichtete, was noch schwieriger ist, auf meinen wohlgedeckten Tisch.29 So hatte ich mich gleichsam um des Himmelreiches willen selbst verschnitten und machte mich auf nach Jerusalem, um ein Gott geweihtes Leben zu führen. Die Bibliothek aber, welche ich mir zu Rom mit großer Mühe und viel Arbeit erworben hatte, glaubte ich nicht entbehren zu können. Ich Elender fastete also, während ich den Cicero las. Nachdem ich manche Nacht durchwacht und viele Tränen vergossen hatte, welche die Reue über meine früheren Sünden gelöst, nahm ich den Plautus zur Hand. Als ich wieder zu mir selbst zurückfand, fing ich an, einen Propheten zu lesen, aber die harte Sprache stieß mich ab. Mit meinen blinden Augen sah ich das Licht nicht. Ich aber gab nicht den Augen die Schuld, sondern der Sonne. Während so die alte Schlange ihr Spiel mit mir trieb, überkam meinen entkräfteten Körper etwa um die Mitte der Fastenzeit ein Fieber, das bis ins innerste Mark drang. Es ließ mir, fast klingt es unglaublich, keinen Augenblick Ruhe und dörrte meine unglücklichen Glieder so aus, daß die Knochen kaum zusammenhielten. Man traf sozusagen schon Anstalten zu meinem Begräbnis. Der Körper war bereits erkaltet, und nur in der erstarrenden Brust zitterte noch ein Funken natürlicher Lebenswärme. Plötzlich fühlte ich mich im Geiste vor den Richterstuhl geschleppt. Dort umstrahlte mich so viel Licht, und von der Schar der den Richterstuhl Umgebenden ging ein solcher Glanz aus, daß ich zu Boden fiel und nicht aufzublicken wagte. Nach meinem Stand befragt, gab ich zur Antwort, ich sei Christ. Der auf dem Richterstuhl saß, sprach zu mir: ‚Du lügst, du bist ein Ciceronianer, aber kein Christ. Wo nämlich dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.‘ Darauf verstummte ich. Er aber gab Befehl, mich zu schlagen. Mehr noch als die Schläge peinigten mich die Gewissensqualen. Mir fiel der Vers ein: ‚Wer wird dich in der Hölle preisen?‘ Ich fing an zu schreien und zu heulen: ‚Erbarme dich meiner, o Herr, erbarme dich meiner!‘ Dieser Ruf übertönte die Peitschenhiebe. Schließlich warfen sich die Umstehenden dem Richter zu Füßen und baten, er möge meinem jugendlichen Leichtsinn verzeihen. Er möge mir Gelegenheit geben, meinen Irrtum zu büßen, jedoch die Strafe weiter an mir vollziehen, falls ich mir erneut einfallen lassen sollte, Werke der heidnischen Literatur zur Hand zu nehmen. In meiner unglücklichen Lage hätte ich noch viel mehr versprochen. Ich fing an, bei seinem Namen zu schwören: ‚Herr, wenn ich je wieder weltliche Handschriften besitze oder aus ihnen lese, dann will ich dich verleugnet haben.‘ Nach diesem heiligen Eide entließ man mich, und ich kehrte wieder zur Erde zurück. Zur Verwunderung aller öffnete ich meine Augen, aus denen Ströme von Tränen flossen, die selbst die Ungläubigen angesichts meines Schmerzes zum Glauben brachten. Es war dies kein Gaukelbild des Schlafes, es waren keine leeren Traumbilder, wie sie so manches Mal mit uns ihr Spiel treiben. Zeuge dafür ist mir der Richterstuhl, vor dem ich lag; Zeuge ist mir das schreckliche Urteil, vor dem ich erzitterte – ich habe nur den einen Wunsch, daß mir so etwas nie wieder zustößt –, meine Schultern zeigten blaue Flecken, nach dem Erwachen fühlte ich noch die Schläge. Und nachher habe ich mich mit einem solchen Eifer den göttlichen Schriften zugewandt, wie ich ihn bei der Beschäftigung mit den profanen nie gekannt hatte.“
In seiner Traumerzählung verdichtet Hieronymus den religiös-kulturellen Konflikt, der es den Christen der römischen Antike lange Zeit erschwert hatte, die Tradition der klassischen Bildung zu akzeptieren, während die Heiden in den Heiligen Schriften der Christen nur eine minderwertige Literatur erkennen konnten. Aus christlicher Sicht kam es nicht auf das Sprachniveau und Stilfragen, sondern auf die Heilsbotschaft an, die notwendigerweise einfach gehalten sein musste, um alle Menschen erreichen zu können. Was brauchte der Christ darüber hinaus an Bildung? Für sein Seelenheil war alle Wissenschaft überflüssig, vielleicht sogar hinderlich.
Obwohl die christlichen Gelehrten schon ab dem 2. Jahrhundert begonnen hatten, diese ablehnende Haltung aufzugeben und ihren Glauben mit den philosophischen und literarischen Traditionen zu verbinden, mussten Kompromisse dieser Art immer wieder neu erarbeitet werden.30 Das sieht man etwa an dem klassisch gebildeten Augustinus, für den die sprachliche wie philosophische Simplizität der christlichen Glaubenssätze ein schwer überwindbares Hindernis auf dem Weg zur Bekehrung darstellte.31 Auch der junge Hieronymus, der aus einer christlichen Familie stammte, war nicht in der Lage, seinen christlichen Glauben ohne Selbstzweifel und Gewissenbisse mit der klassischen Bildung zu harmonisieren. Sein Traumbericht ist von der scharfen Bipolarität zwischen Glauben und Bildung geprägt: Zwischen dem Ciceronianer und dem Christen kann es nichts Verbindendes geben. Nur einem „Stand“ kann ein Mensch angehören. Hier geht es also um ein eindeutiges Bekenntnis. Dabei entwickelt Hieronymus in der Schilderung seines Traumes eine Dramatik der Bekehrung, der jegliche Freiwilligkeit fehlt. Der letztendliche Verzicht auf die geliebte heidnische Literatur wird durch Gewalt erzwungen.
Die Folterszene vor dem Richtstuhl Gottes erinnert an die Verhöre und Peinigungen aus christlichen Märtyrerlegenden. Doch der Vergleich geht nicht auf. Denn während ein Märtyrer allen Drohungen zum Trotz an seinem Glauben festhält, gibt Hieronymus im Traum nach und schwört, sich gerade von dem abzuwenden, was dem Urteil des höchsten Richters zufolge sein eigentlicher Lebensinhalt ist. Da der Verzicht auf die heidnische Literatur ein „durch Folter und Todesgefahr erzwungener Akt“ sei und „die verleugnete pagane Kultur in Analogie zum Glauben der Märtyrer unsinnig aufgewertet werde“, so hat Barbara Feichtinger geurteilt, werde die Selbststilisierung des Hieronymus als Märtyrer letztlich „zur Groteske“.32 Sie hat auch darauf hingewiesen, dass sich Hieronymus in einer Tradition christlicher Träume und Visionen bewegt, zu der Paulus’ ‚Damaskuserlebnis‘ und Konstantins Traum vor der Schlacht an der Milvischen Brücke gehören, und sich so „in die Zahl jener Auserwählten einreiht, die Gott/Christus von Angesicht zu Angesicht sehen durften“.33 Aber welches Bild wird hier von der christlichen Religion gezeichnet? Der Gott, der den Anhänger Ciceros beinahe zu Tode prügeln lässt, ist seiner Kreatur nicht gerade liebevoll zugewandt.
Auf Eustochium scheint weder die Traumerzählung noch die Nachdrücklichkeit, mit der Hieronymus seine christliche Morallehre vertrat, abschreckend gewirkt zu haben. Sie hat Hieronymus und ihre Mutter Paula wenig später in das Heilige Land begleitet und ihr Leben in dem in Bethlehem gegründeten Kloster zugebracht. Hieronymus seinerseits hat keineswegs darauf verzichtet, in seinen Schriften Cicero und andere heidnische Autoren, Horaz etwa oder Vergil, zu zitieren. Der „größere Eifer“, mit dem er seit seinem Traum die christlichen Schriften studiert haben will, hat seinen früheren Freund, dann aber schärfsten Kritiker Rufin später nicht davon abgehalten, Hieronymus einen klaren Eidbruch vorzuwerfen, und Hieronymus sollte es einige Mühe bereiten, sich dagegen zu verteidigen.34
Die Bekehrung Paulas durch den Heiligen Hieronymus. Gemälde von Sir Lawrence Alma-Tadema, 1898.
1898 malte der Niederländer Lawrence Alma-Tadema (1836–1912) in London sein gleichermaßen romantisches wie historisierendes Ölgemälde „Die Bekehrung Paulas durch den Heiligen Hieronymus“. Es ist eines von wenigen Bildern der Kunstgeschichte, auf denen Hieronymus mit Paula zu sehen ist. Kein anderer Maler hat es indes gewagt, das Thema auf diese Art darzustellen, spielt das Werk doch mit der erotischen Spannung zwischen zwei jungen Menschen. Paula ist in ihrer angedeuteten Laszivität, hingestreckt auf ein Leopardenfell, noch ganz in der Schönheit der Welt verfangen, von der sie selbst ein Teil ist, während der Kirchenlehrer die Keuschheit, wie seine Haltung zeigt, verinnerlicht hat. Er ist nur noch moralisches Gewissen, und allein auf dem Weg, auf den sein erhobener Zeigefinger verweist, werden Paula und er zueinanderfinden. Auf dem Gemälde indes geht die Anziehungskraft von Paula aus, die dem heiligen Mann nur ihre Schulter zeigt und mit ihrer Hand auf die Weinschale und eine Szenerie weist, die vom Dionysoskult erfüllt ist.
Für Alma-Tadema stoßen in der Begegnung zwischen Paula und Hieronymus zwei Welten aufeinander: die durch Dekadenz geprägte und zum Untergang verurteilte römische Antike und das Christentum, dem die Zukunft gehört.35 Diese aber wird karg und dunkel sein. Auch Paula scheint noch nicht zu ahnen, wie ihr zukünftiges Leben aussehen wird.
Auf historische Details braucht ein bildender Künstler nicht zu achten. Ist die Paula auf dem Gemälde nicht zu jung für die Frau, die in der Mitte der achtziger Jahre des 4. Jahrhunderts mit Hieronymus zusammentraf? Beide, Paula wie Hieronymus, waren etwa gleich alt und damals in der Mitte ihrer dreißiger Jahre. Das Porträt, das Alma-Tadema malte, würde besser zu Paulas Tochter Blesilla passen, zu deren Konversion Hieronymus seinen Teil beigetragen hat. Paula dagegen hatte ihre Entscheidung für ein streng christlich-asketisches Leben schon einige Jahre früher getroffen, also noch vor der Ankunft des Hieronymus in Rom. Im Unterschied zu ihrer Tochter Blesilla erreichte Paula als Asketin an der Seite des Hieronymus wenigstens ein mittleres Alter: Mit 56 Jahren ist sie 404 in Bethlehem gestorben.