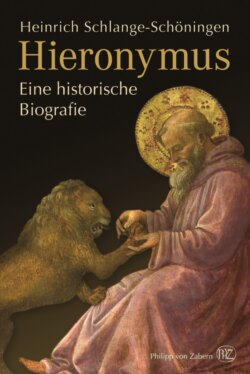Читать книгу Hieronymus - Heinrich Schlange-Schöningen - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Sohn aus gutem Hause
ОглавлениеAus einer Kindheitserinnerung des Hieronymus lässt sich entnehmen, dass sein Vater ein begüterter Mann war. So selten Hieronymus auch auf seine Kindheit und Jugend zurückblickt, zwingt ihn der erbitterte Streit, den er in späteren Jahren mit Rufin um die vermeintlich häretische Theologie des Origenes geführt hat, doch einmal dazu, eine solche Erinnerung als Argument einzusetzen. Rufin hatte Hieronymus vorgeworfen, trotz seiner im Brief an Eustochium formulierten Behauptung, der heidnischen Literatur ganz und gar abgeschworen zu haben, weiterhin die Klassiker zu lesen und zu zitieren, und Hieronymus verteidigt sich etwas hilflos gegen diesen Angriff mit der Behauptung, einmal Gelesenes und einmal Erlebtes sei im Gedächtnis fest verankert und jederzeit abrufbar:
„Wer von uns würde sich nicht seiner Kindheit erinnern? Ich kann mich jedenfalls gut daran erinnern […], als Kind durch die Wohnzellen der Sklaven gelaufen zu sein und meinen freien Tag mit Spielen zugebracht zu haben oder auch aus den Armen der Groß-mutter als Gefangener dem strengen Orbilius ausgeliefert worden zu sein.“49
Die Wohnzellen der Sklaven, von denen hier beiläufig die Rede ist, lassen an die Sklavenbaracken der Südstaaten denken, von denen Beecher-Stowe in „Onkel Toms Hütte“ erzählt. Durch vergleichbar ärmliche Behausungen, in denen eine größere Anzahl von Sklaven untergebracht war, die alltäglich auf den Feldern arbeiteten, konnte der junge Hieronymus als Sohn des Sklavenbesitzers streifen und sich vergnügen, bis er wieder in die Hände seines Pädagogen geriet, der wahrscheinlich ebenfalls dem Sklavenstand angehörte.
Vom familiären Wohlstand in Stridon ist auch im Brief an Eustochium die Rede. Hier unterlegt Hieronymus sein Plädoyer für ein asketisches Leben mit dem Hinweis darauf, einst selbst als junger Mann auf die Annehmlichkeiten eines wohlgedeckten Tisches verzichtet zu haben, als er die Heimat verließ, „um ein Gott geweihtes Leben zu führen“. Und noch einmal später, als ihm in Bethlehem das für den Unterhalt seiner Klöster notwendige Geld auszugehen drohte, weil sich das riesige Vermögen seiner asketischen Freundin und Gönnerin Paula doch erschöpft hatte, schickte er wie bereits erwähnt seinen Bruder Paulinianus in die Heimat, um zu verkaufen, was vom väterlichen Besitz nach den gotischen Plünderungen noch übrig war: halb niedergebrannte Landhäuser und Ländereien, während der mobile Besitz, über den die Familie verfügt haben muss, Sklaven und Vieh, geraubt oder geflohen war.50 Die hier genannten „kleinen Landhäuser“ sind – entgegen dem rhetorisch gebrauchten Diminutiv51 – ein Hinweis auf einen recht großen Landbesitz, denn es handelte sich dabei vermutlich um mehrere Häuser, die jeweils von Äckern und Gärten, vielleicht auch Weinbergen umgeben waren. Ein ganzes Netz von väterlichen Ländereien könnte sich um Stridon herum befunden haben, und ein größeres Haus wird der Familie, die somit zur wohlhabenden Schicht der größeren Landbesitzer gehörte, als Hauptsitz gedient haben. Ob es in Stridon Ämter und Aufgaben gab, die Hieronymus’ Vater aufgrund seiner besseren wirtschaftlichen und damit auch höheren sozialen Stellung hätte übernehmen können, hängt von der Größe und dem Rechtsstand der Gemeinde ab, der sich nicht genauer bestimmen lässt (S. 31).
Ist somit die soziale Stellung der Familie recht gut zu bestimmen, bleibt vieles andere im Dunkeln. Kein einziger Brief an den Vater oder die Mutter ist überliefert, und der Name der Mutter wird wie der der Schwester kein einziges Mal erwähnt. Der Vater hieß Eusebius, der Bruder Paulinianus und eine Tante Castorina. Seit wann die Eltern in Stridon lebten oder wie sie zum christlichen Glauben gekommen waren, berichtet Hieronymus nicht.52 Sein eigener kostspieliger Ausbildungsgang, der ihn nach Rom und dort in den Unterricht eines Grammatikers und eines Rhetors führte, bestätigt noch einmal indirekt den Wohlstand der Familie und deutet auf den elterlichen Wunsch, ihrem Sohn eine gute Bildung und damit auch eine Grundlage für eine Ämterlaufbahn zu verschaffen.53 Eine solche Laufbahn war gut mit einem größeren Landbesitz zu verbinden, den der Besitzer keineswegs selbst verwalten musste, und es gab, wenn man im Staatsdienst erst einmal weit genug gekommen war, gute Positionen, die es erlaubten, das eigene Vermögen noch beträchtlich zu vergrößern. Der Bildungsgang des jungen Hieronymus weist jedenfalls darauf hin, dass seine Eltern ihren Glauben mit Besitz und Wohlstand zu verbinden wussten. Dem frühchristlichen Ideal des völligen Verzichts auf Besitz und Bildung wollten sie offensichtlich nicht folgen.
Dass die Eltern Christen waren, steht außer Frage. Mehrfach weist Hieronymus darauf hin, christlich erzogen worden zu sein. In seiner Familie war, anders als etwa in der Familie des Augustinus, die grundsätzliche Entscheidung für den neuen Glauben längst gefallen. Ob der Vater, der um 320 geboren sein könnte, seinerseits bereits christliche Eltern hatte oder Christ wurde, bleibt offen, da er seinen christlichen Namen (Eusebius = „der Fromme“) auch angenommen haben könnte.54 Für Hieronymus indes war der Weg zur Taufe familiär vorgegeben. Im Vorwort zu seiner Hiob-Übersetzung sagt er ausdrücklich, dass er christliche Eltern gehabt habe,55 und in einem seiner späteren Briefe betont er die christliche Erziehung, die er genossen habe, sei er doch „von der Wiege an mit katholischer Milch ernährt“ worden.56 Da dieses Selbstzeugnis aus einem Brief stammt, den Hieronymus am Ende des 4. Jahrhunderts an Theophilus, den Patriarchen von Alexandria, geschrieben hat, könnte man fragen, wie aussagekräftig der Hinweis auf die „katholische“ Ausrichtung der christlichen Erziehung tatsächlich ist. In seinem Brief musste Hieronymus Stellung zu den Auseinandersetzungen um Origenes beziehen und in diesem Zusammenhang seine Rechtgläubigkeit betonen. Als Zeugnis für seine Kindheit bestätigt der Brief zunächst einmal grundsätzlich die christliche Erziehung. Doch Hieronymus hatte sich tatsächlich schon früh und klar auf die Seite der Orthodoxie gestellt. In dem bereits zitierten Brief, den er in den siebziger Jahren aus der Wüste an seine Freunde in Aquileia schickte, lobte er diese dafür, sich in den innerchristlichen Auseinandersetzungen behauptet und „Aquileia vor dem Gift der arianischen Irrlehre bewahrt“ zu haben.57 Da sich etliche Bischöfe des Westens unter Constantius II., der dieses Bekenntnis unterstützte, dem Arianismus angeschlossen hatten – darunter auch Auxentius, der Bischof von Mailand58 –, war ein „katholisches“ und das heißt somit ein antiarianisches Bekenntnis in seiner Jugend keine Selbstverständlichkeit.
Erstaunlich ist aber doch das Schweigen über Vater und Mutter. Zusammengenommen mit dem Konflikt, den es zwischen Hieronymus und seiner Tante Castorina gab, ergibt sich der Verdacht einer tiefen und anhaltenden Entfremdung, die zur Spaltung der Familie geführt haben könnte. Dabei stand Paulinianus, der etwa zehn Jahre jüngere Bruder, auf der Seite des Hieronymus, folgte er ihm doch im mönchischen Lebensentwurf und bis nach Bethlehem, wo er den größten Teil seines Lebens an der Seite seines älteren Bruders verbrachte. Für die wohlhabende Familie bedeutete dies, dass die potentiellen Erben des Vermögens aus dem bürgerlichen Stand ausgeschieden waren. Sofern man ihnen als zukünftigen Erben den Zugriff auf den Besitz nicht verstellte, indem man etwa andere Verwandte begünstigte, musste man damit rechnen, dass die Vermögenswerte eines Tages in die Verfügungsgewalt der Kirche übergehen würden. Genau das versuchten Hieronymus und sein Bruder später tatsächlich zu bewerkstelligen, als Paulinianus nach Stridon reiste, um die Überreste des väterlichen Besitzes zu Geld zu machen.
Noch einmal sei der hypothetische Charakter dieser Überlegungen betont. Ihnen kommt aber durchaus eine gewisse Plausibilität zu und dies vielleicht gerade dann, wenn man sie in einen Zusammenhang mit den oben erwähnten Briefen stellt, die Hieronymus nach Emona gerichtet hat (S. 35f.). Zu erinnern ist auch an die Zeugnisse aus dem 4. und 5. Jahrhundert, die belegen, dass es zu scharfen innerfamiliären Konflikten kommen konnte, wenn die Zukunft wohlhabender Familien durch die christlichen Ideale von Askese und Jungfräulichkeit gefährdet erschien. Keine Ehe einzugehen und keine Kinder zu zeugen, bedeutete nicht nur, eine persönliche Entscheidung gegen die Traditionen zu treffen, sondern auch die Familiengeschichte zu beenden, sofern nicht Geschwister vorhanden waren, die weniger radikal gesinnt waren. Hieronymus und Paulinanus hatten noch eine Schwester, doch auch sie hat sich offenkundig für die asketische Option entschieden. So jedenfalls lassen sich die Dankesworte verstehen, die Hieronymus an den Diakon Julian in Aquileia richtet: Er freue sich zu erfahren, dass die Schwester, „Deine Tochter in Christus, in ihrem neuen Entschlusse ausharrt“.59 Im Brief an die Freunde ist dann von einer „Wunde“ die Rede, „welche ihr der Teufel versetzt hatte“, bevor sie Hieronymus durch „Jesus wiedergeschenkt“ worden sei. Welche Art von Verfehlung gemeint sein könnte, wird nicht deutlich, doch da die Gefahren, denen die Schwester weiterhin ausgesetzt sei, mit denen verglichen werden, die Chromatius, Jovinus und Eusebius überstanden hätten, kann man hier den Vergleichspunkt im Entschluss zum asketischen Leben und im Beharren auf dieser Entscheidung sehen. Das aber würde bedeuten, dass die Familie des Hieronymus ohne Aussicht auf nachfolgende Generationen und damit ohne Zukunft war, wofür man Hieronymus als den Ältesten verantwortlich machen konnte. Hier könnte der Grund für das vollständige Schweigen zwischen Hieronymus und seinen Eltern liegen, und auch der Brief, den Hieronymus an die Tante Castorina schrieb, gehört möglicherweise in diesen Zusammenhang.
Eindringlich bittet Hieronymus seine Tante, den langen Groll aufzugeben und den brieflichen Kontakt zu ihm wieder aufzunehmen, doch er macht auch deutlich, dass er selbst der christlichen Pflicht zur Aussöhnung mit diesem Brief genügt habe; will sich die Tante nicht aussöhnen, so liege jedenfalls bei ihm keine Schuld.60 Letztlich aber könnte die Tante recht gehabt haben: Wenn Hieronymus durch sein persönliches Vorbild und wohl auch durch Briefe oder im persönlichen Kontakt und mit all seiner rhetorischen Kraft sowohl den Bruder als auch die Schwester ähnlich ‚bearbeitet’ haben sollte, wie er das später in Rom mit der jungen Eustochium machte, dann trug er einen großen Teil der Verantwortung dafür, dass die Kinder des Eusebius und seiner Frau die Zukunft ihrer Familie auf dem Altar der Askese und Jungfräulichkeit opferten. Vielleicht haben es die Eltern zuletzt bedauert, ihrem Ältesten eine lange und gute Ausbildung finanziert zu haben. Mit geringerer rhetorischer Kunst und weniger Gelehrsamkeit hätte Hieronymus seine radikale christliche Gesinnung wohl nicht so überzeugend vertreten können.