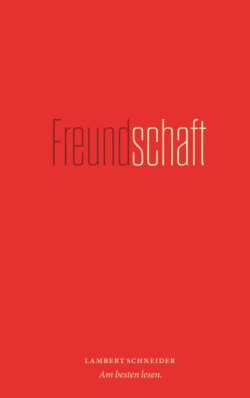Читать книгу Freundschaft - Helm Stierlin - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Freundschaft – Die Besiedelung der Welt
ОглавлениеMan kann nicht allen Menschen in gleicher Weise nahe sein. Man kann nicht an allen Orten in gleicher Weise beheimatet sein. Man kann nicht alle Bücher in gleicher Weise lieben. Wir sind nicht omnipotent, auch nicht in unseren erotischen Fähigkeiten. Wir sind endliche Wesen in unserem Verhältnis zu Menschen und Dingen. Darum schließen wir Freundschaft mit Menschen und Dingen und schaffen uns so eine Welt, in der wir zuhause sind; jedenfalls mehr zuhause als in anderen Welten. »Freundschaft schließen« – ich lese drei Bedeutungen in dieser Wortkombination, die erste: Ich schließe mich in besonderer Weise an einen Menschen oder an Dinge an. Ich schließe mich ihnen auf und befreunde mich mit ihnen. Dies ist ein Akt der auswählenden Liebe, ein Moment der Freiwilligkeit also. Mit Familienbeziehungen ist es anders, da hat man keine Wahl. Familien sind Schicksal, gnädiges oder bösartiges Schicksal. Eine Freundschaft ist ein Haus mit offenen Türen, man kann eintreten und man kann das Haus wieder verlassen; verlassen jedenfalls mit geringerer Dramatik, als wenn man einem Familienhaus kündigt.
Ganz behält man seine Kommens- und Gehensfreiheit nicht, wenn man eine Freundschaft geschlossen hat. Man ist zwar in einer guten Freundschaft nicht gefesselt, aber man ist in sie gebunden, wie die Nähe zu Menschen uns immer bindet. Freundschaften verlangen Treue, Nähe, Entschiedenheit. Die Freundschaften, die wir schließen und die ihren Namen verdienen, schließen uns ein und nehmen uns die Willkür des Kommens und Gehens – die andere Bedeutung des »Schließens«. Freundschaften sind nicht unser Kerker, aber sie setzen unserer Beliebigkeit Grenzen. Man kann die Freundschaft »verraten«, wenn man diese Grenzen missachtet.
Ein drittes Moment des Wortpaares »Freundschaft schließen«: Die Freundschaft zu einigen Menschen schließt die Freundschaft zu anderen aus. In den Klöstern wurde lange besonderen Freundschaften und Nähen zwischen einzelnen Menschen misstraut; als »Privatfreundschaften« waren sie suspekt, eben wegen der Ausschließlichkeit jener Beziehungen. Jeder, der schon einmal in Gruppen gearbeitet hat, kennt das Misstrauen gegen den »inneren Kern« der Gruppe; gegen jene in der Gruppe, die durch besondere Nähe miteinander verbunden waren. Nähen ziehen Grenzen. Diese Grenzen müssen nicht feindlich sein. Es gibt kein Leben und keine Intensität ohne solche Grenzen. Man lernt durch sie, wer man ist, indem man lernt, wer man nicht ist.
Ich suche einige Stellen solcher Freundschaft auf und nenne als erste die Freundschaft mit Büchern. Ich habe acht oder zehn Bücher, die meine besonderen Freunde sind. In sie mache ich zum Beispiel keine Eselsohren, aber ihr Text ist mit vielen Unterstreichungen und Anmerkungen versehen. Sie stehen an bevorzugter Stelle in meinem Regal, und ich leihe sie nur ungern aus. Es sind übrigens kaum Bücher, die unmittelbar zu dem Fach gehören, das ich zu bearbeiten habe. Wenn ich etwas zu schreiben habe, befrage ich sie zuerst, blättere in ihnen herum, gehe zu ihnen wie zu einem Lehrer, dem ich in besonderer Weise vertraue, auch wenn er zu dem Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige, nicht sehr viel zu sagen hat. Es sind übrigens meistens Bücher von Autoren und Autorinnen, die eine gute Sprache haben. Solche findet man bekanntlich nicht an jeder literarischen Straßenecke. Geist vermute ich immer bei guter Sprache. Ein solcher Buch-Freund ist für mich zum Beispiel Leon Wieseltier mit seinem »Kaddisch«. Das Buch ist nicht für alles zuständig, aber da ich das Buch zu meinem Freund gemacht habe, vermute ich es für vieles zuständig (über Freundschaft habe ich übrigens wenig in ihm gefunden). Ich gebe diesem Buch also einen Vorschuss vor anderen Büchern und lese manchmal mehr in es hinein als aus ihm heraus. So macht man es ja auch bei Menschenfreunden. Vielleicht gibt es schönere, weisere und zutreffendere Bücher. Aber diese sind nun einmal nicht in gleicher Weise meine Freunde. Ich finde etwas in meinen Freundschaftsbüchern, weil ich etwas suche. Es ist also eine Sache des Vertrauens und der Liebe, die mich mehr finden lässt, als das Buch reich ist. So ist das auch mit Menschenfreundschaften.
Übrigens bin ich nicht in gleicher Weise mit der Bibel befreundet. Sie ist mehr »Familie«. Sie gehört enger und unausweichlicher zu mir als die Freundschaftsbücher, und es ist mir nicht möglich, ihr zu kündigen wie jenen Büchern. Ihr bin ich anders verpflichtet, und sie setzt mich anders gefangen als die Bücher, vor denen ich die Wahl habe. Auf die Bibel muss ich hören, auf die Freundschaftsbücher darf ich hören. Natürlich erlaube ich auch der Bibel nicht, mich einzukerkern. Aber sie hat eine andere Autorität als die, die ich den Freundschaftsbüchern verliehen habe. In dieser Bibel treiben sich auch Ideen, geistige Figuren herum, die mich gelegentlich ärgern, die ich aber ebenso wenig loswerde, wie man Familienmitglieder loswird. Übrigens auch da gleicht das Verhalten dem, was man zu Familienmitgliedern hat: Man verschweigt vor anderen ihre Schwächen und beschönigt sie. Ein Glück, dass es nicht nur die Bibel gibt; ein Glück, dass es nicht nur die Familie gibt!
In ähnlicher Weise kann ich mich mit Orten befreunden. Ich wohne am Vierwaldstätter See in der Schweiz und liebe einen Berg besonders, den Fronalpstock, lieber als den Pilatus, ebenfalls in der Nähe des Sees. Warum? Ich kann es nicht sagen, wie man in der Liebe und in der Freundschaft nie ganz erklären kann, warum man eben diese Wahl getroffen hat. Ich finde es charmant, dass es Stellen gibt, an denen man sich selbst nicht ganz entschlüsseln und durchschauen kann. Der Pilatus ist vermutlich nicht weniger schön als mein Fronalpstock. Aber er ist nicht in gleicher Weise mein Berg. Ich »finde« meinen Berg schöner, weil ich seine Schönheit intensiver gesucht und sie in ihn hineingelesen habe. Übrigens verlangt der Fronalpstock wie ein Menschenfreund Treue. Er verlangt meinen gelegentlichen Besuch, sonst könnte seine Schönheit in meinen Augen verblassen. Die Welt wird freundlicher, bekannter und vertrauter, wenn man Orte des Vertrauens hat. Es gibt eine Weise des Flanierens durch die Welten; eine Art Donjuanismus, in dem alles gleichgültig bleibt, weil man viel genossen, aber keine Wahlen getroffen hat. Wenn man die Welt nicht durch Freundschaften besiedelt, bleibt man unbehauster Weltbürger. Es gibt andere Orte der Freundschaft, Kirchen zum Beispiel; die Katharinenkirche in Hamburg oder die Franziskanerkirche in Luzern. Mit einem Ort befreundet zu sein, bedeutet zwangsweise, andere Orte weniger zu lieben oder sie gar zu verschmähen, obwohl ich ihnen damit vielleicht Unrecht tue. So meide ich diese Orte, etwa den Hamburger Michel, den Kölner Dom oder – meinen Feind – den Petersdom in Rom. Liebe bevorzugt, und einem Stück Ungerechtigkeit kann man dabei nicht entkommen (beim Petersdom allerdings habe ich kein Unrechtsbewusstsein).
Freundschaft zu Dingen und Orten lebt nach ähnlichen Gesetzen wie die Freundschaft unter Menschen. Auf diese will ich nun mit einem Gedanken eingehen: Was unterscheidet sie von der reinen Genossenschaft? Ist Freundschaft immer eine Sache der Herzen, und besteht sie nur aus den Herzen, die einander zugeneigt sind? Es gibt offensichtlich Nähen von Menschen zueinander, die nicht zuerst aus unmittelbarer Herzlichkeit bestehen. Die Quäker, jene christliche Gruppierung, die im 17. Jahrhundert in England entstanden ist und die sich dem Frieden und der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet weiß, nennen sich »Gesellschaft der Freunde«. Freunde und Freundinnen sind diese Menschen nicht, weil sie sich alle mögen. Freunde sind sie, weil sie eine Sache vereinigt; etwa ihr Gottesdienst, der in großen Teilen aus Schweigen besteht. Freundschaftlich verbunden sind sie in der gemeinsamen Arbeit am Frieden und am Recht. Es gibt also menschliche Nähen, deren Autor nicht das Herz ist, sondern die gemeinsam geglaubte und vertretene Sache. Die Parteifreunde verbindet die oft kühle Gemeinsamkeit eines Programms. Die Christen, die sich Brüder und Schwestern nennen, verbindet die Gemeinsamkeit ihres Glaubens. Oft ist das Herz recht unbeteiligt an solchen Freundschaften und Geschwisterschaften. Man fühlt sich zusammengehörig und muss sich dabei nicht unbedingt mögen. Ich war kürzlich auf einer Konferenz von Christen, die hart miteinander stritten. Ein Bischof wollte den Streit mildern und redete einen Teilnehmer des Streites mit »Bruder« an. Dieser empört: »Ich bin nicht Ihr Bruder!« Dann sagte er mit grimmigem Humor: »Also meinetwegen ›Bruder‹, es bleibt mir ja nichts anderes übrig.« Es blieb ihm nichts anderes übrig, weil etwas vorlag, das größer war als ihr Dissens. Die Herzen sprachen gegeneinander, aber eine gemeinsame Sache verband sie.
Nicht immer, aber oft schafft die gemeinsame Sache auch eine persönliche Nähe. Wenn ich in einer fremden Stadt in einen Gottesdienst gehe und neben wildfremden Menschen sitze, bin ich nicht neben ihnen, wie ich im Wartesaal eines Bahnhofs neben meinem Nachbarn sitze. Es ist ein Vorschuss an Nähe da, den die Einzelnen nicht erarbeitet haben und der aus der gemeinsamen Lebensoption besteht. Menschen blicken sich freundlich an, sagen ein Wort zueinander, obwohl sie wenig voneinander wissen und wenig miteinander zu tun haben. Diese Gemeinsamkeit erzeugt Lebenswärme, also Freundschaft. In einem wichtigen Ziel verbunden zu sein, dem man freiwillig zugestimmt hat, erzeugt mehr als eine reine zweckorientierte Genossenschaft. Man ist sich wenigstens in diesem Ziel einig, oft bei herzlicher Uneinigkeit.
Vielleicht braucht jede Freundschaft im ursprünglichen Sinn des Wortes, um intensiv und langfristig zu bleiben, zumindest eine gewisse Gemeinsamkeit in einem Dritten, in einer gemeinsamen Arbeit, in einem zusammen verfolgten Ziel oder in einer gemeinsamen Lebenssicht. Jeder hat es schon einmal erlebt, wie Freundschaften blass werden oder gar zerbrechen, wenn die Lebensziele auseinanderdriften. Die Freundschaft des Kriegsgegners und des Aufrüstungsbefürworters hat es nicht leicht. Eine Ehe eines religiösen Menschen mit einem Religionsverächter bleibt bedroht. Das Herz ist oft zu klein, wenn ihm nicht geholfen wird von einer gemeinsam vertretenen Sache, von einer gemeinsamen Arbeit und einem geteilten Lebensglauben. Freundschaft ist eine Grundform der Liebe. Liebe aber braucht, damit sie bestehen kann, Kinder. Es müssen nicht immer leibliche Kinder sein. Es können gemeinsame Interessen sein, gemeinsame Arbeiten oder Lebensziele, für die man zusammen kämpft. Man findet sie im gemeinsamen Dritten. Nach alter katholischer Ehelehre kommt eine Ehe erst zustande, wenn beide Partner Kinder wollen. Die krude Wörtlichkeit einer solchen Auffassung ist problematisch, aber wahr ist ihr Geist. Unmittelbarkeit kann nur gelingen, jedenfalls auf Dauer nur gelingen, wenn sich ein Drittes einstellt, ein »Kind«, ein gemeinsames Anliegen; wenn die Zuneigung sich verfremden und Gestalt gewinnen kann in wichtigen Themen und Arbeiten. Oft ist es so, dass das gemeinsame Dritte in einer Freundschaft oder einer Ehe Menschen zusammenhält, wo der unmittelbare Zugang zueinander schon schwer geworden ist. Menschen, die sich darin erschöpfen, sich in die Augen zu sehen, werden füreinander blind. Dagegen wachsen Menschen in ihrer Freundschaft und Zuneigung, wo man sich einig ist in einer gemeinsamen Sache. Freunde oder Liebende, die kein anderes Thema haben als sich selber, verholzen in ihrer Beziehung, denn weltlose Beziehungen werden auf Dauer langweilig. Die Konflikte werden schärfer und unlösbarer, wo sie nicht die gemeinsame Sorge um ein Drittes mildert. Zwei Menschen, die nicht mehr haben als sich selber und die sich selber immer das Wichtigste auf der Welt sind, sind sich auf Dauer nicht genug. Wir sind endlich, auch in unserer personalen Zuneigung. Aber die Grenzen werden weiter, und Menschen brechen ihre eigene Enge auf, wo sie voneinander abzusehen vermögen im Blick auf das gemeinsame Dritte. Freundschaften finden dort ihre Fülle, wo sie zugleich Arbeitsgemeinschaften sind; wo die Freunde zugleich Genossen sind.
Hermann Glaser