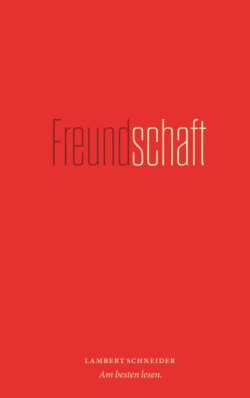Читать книгу Freundschaft - Helm Stierlin - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Freundschaft – sprachgebräuchlich und sprichwörtlich bestätigt
ОглавлениеDie uns wichtigsten Freundschaften binden Menschen in sehr kleinen Gruppen zusammen – zu freundschaftlich verbundenen Nachbarschaften zum Beispiel oder in altbewährtem, verlässlich gewordenem Austausch von Diensten zwischen ähnlich Hilfsbedürftigen. Enge Freundschaft bleibt zumeist ein Bund zweier Freunde – nicht selten dauerhaft von der Schulzeit bis ins hohe Alter und damit sogar mehr Lebenszeit umfassend als beständige Ehen.
Demgegenüber wird in der Politik massenmedial Freundschaft bekundet, die über Räume von kontinentaler Weite hinweg Völker verbände. Für Solidarität zur Rettung aus Überschuldungsnotständen, die im eigenen Land Steuererhöhungen erzwänge, lässt sich tatsächlich nicht in der entemotionalisierten Sprache völkerrechtlich sanktionierter Diplomatie werben. Das verlangt bewegende Anrufung informeller moralischer Pflichten. Und so ist dann plötzlich in TV-Résumés von einschlägigen EU-Ratsbeschlüssen von unseren zypriotischen oder portugiesischen Freunden die Rede, denen zu helfen sei und die ihrerseits sich bemühten, die benötigten Hilfen zu minimieren.
Die moderne europäische Kultur ist, spätestens seit Rousseau, eine kulturkritisch gestimmte Kultur, und es liegt nahe zu finden, es müsse unseren Begriff von der »Freundschaft« genannten Einzigartigkeit enger zwischenmenschlicher Bindung beschädigen, wenn wir nun sogar potentielle Billionentransfers zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit souveräner Staaten mit Einschluss des handelstechnischen Ausgleichs von Targetsalden zu fälligen Freundschaftsdiensten erhöben.
Das trifft wohl zu. Gleichwohl gehört die Dehnbarkeit des Fortschrittsbegriffs zur Sache und es hat gute Gründe, die uns das Wort »Freundschaft« weitläufig gebrauchen lassen – von der Anrede im Mail-Austausch mit Service-Club-Mitgliedern in Kanada oder Neuseeland bis zur Kennzeichnung von Friedrich Schillers großer Dichtung »Die Bürgschaft« als »Hohes Lied der Freundschaft«.
Freundschaften – dazu gehören eben Beziehungen, die, schon im Volksschulalter bewährt, sogar noch im Seniorenheim dauern, aber auch Gastfreundschaft gegenüber ständig wechselnden Gästen, Vereinsfreundschaften aus organisiertem Engagement für die Förderung nützlicher Zwecke und Freundschaft als glückhaft verbliebene Beziehung nach einer gescheiterten Liebe auch noch.
So will es im Gebrauch des Wortes »Freundschaft« anstandslos unsere Sprache. Dieser Gebrauch also ist weitgespannt und gleichwohl nicht regellos. Man sieht es im Vergleich mit anderen Beziehungen zwischen Menschen, die gleichfalls, wie die Freundschaft, für ein gutes Leben nötig sind, ja konstitutiv und dennoch ganz anders konstituiert. Für unsere familiären Bindungen und speziell für die Ehe gilt das vor allem. Im Unterschied zur Freundschaft sind ja familiäre Beziehungen förmlich konstituiert – gesetzlich nämlich und damit vom Familienrecht bis zum Erbrecht verbindlich gemacht. Freundschaftsfrei, gewiss, wäre ein gutes Leben nicht möglich. Gleichwohl sind Freundschaften, anders als Kindschafts- oder Geschwisterverhältnisse, nicht unaufkündbar, und komplementär dazu wäre es lebenssinnfremd, Freundschaftsverhältnisse wie die grundlegenden Beziehungen zwischen Eltern und Kindern rechtlich verpflichtend machen zu wollen.
Gewiss: Auch unter Freunden gibt es freundschaftsbestätigende Riten – von den Blutsbrüderschaftsschlüssen unter Schulkindern im Alter von Karl-May-Lesern bis zur wechselseitigen Einsetzung in die Rolle von Nachlasshütern. Aber das alles ist im Prinzip formlos kündbar – Vaterschaft oder Mutterschaft hingegen nie, und selbst noch sogenannten enterbten Kindern bleibt ihr Pflichtteil gesetzlich gesichert.
Zusammenfassend gesagt: Freundschaften sind in der Fülle der Verbindungen zwischen Menschen – familiär oder verwandtschaftlich, bürgerlich oder geschäftlich, beruflich oder politisch – die Beziehungen der rechtsfreien und zugleich rechtsunbedürftigen Art und eben kraft dieser institutionellen Uneinholbarkeit frei und somit von lebenslang verbundenen Freundschaftspaaren bis hin zu Parteifreundesrunden unübersehbar vielfältig lebbar.
Unbeschadet dieser freien Vielfältigkeit freundschaftlicher Lebensverhältnisse halten sie stets den Unterschied deutlich, den es macht, ihnen zuzugehören oder eben auch nicht. Freundschaften lassen sich nicht universalisieren. Freunde gibt es nur, weil es stets auch diejenigen gibt, die es nicht sind. Selbst noch und gerade auch im politischen Lebenszusammenhang bringt sich das zur Evidenz. »Alle Menschen werden Brüder« – so lautet bekanntlich Schillers Verheißung für eine freudeerfüllte zukünftige humane Lebensverfassung, und in Feiern von Friedensschlüssen und völkerrechtsverbindlichen Verkündigungen universell geltender Menschenrechte ist das erlebbar gewesen.
Die Ankündigung »Alle Menschen werden Freunde« hingegen hätte keine Verheißung, und so kommt sie im öffentlichen Leben auch gar nicht vor. Wieso nicht? Bruder, Schwester – das sind wir kraft unaufkündbaren, nämlich natural indisponiblen Vorgegebenheiten unserer sozialen und kulturellen Lebenswelt, und auch noch, ja gerade in zerrütteten Geschwisterverhältnissen erfahren wir das. Eben solche Vorgegebenheiten aus der naturalen Einheit unserer Spezies sind es auch, die die verbreitete Metaphorik von der »Family of Men« sinnvoll machen und damit zugleich im Blick auf die Unglücksgeschichte von Gewalt oder Gleichgültigkeiten Hoffnung auf ein Zusammenleben wie unter Schwestern und Brüdern erwecken, die gelernt haben zu sein, was sie einander weniger gut ohnehin fortdauernd bleiben müssten. Entsprechend tief erschreckt uns die Idee, auch noch naturhistorische Vorgegebenheiten menschlicher Verbundenheit moralisch disponibel machen zu wollen – wie in der »Zauberflöte« Sarastro mit seiner Vorabverurteilung aller gegenüber heiligen Lehren Verstockten, die nicht verdienten, »Mensch zu sein«.
Es hat seine Evidenz: Wider solche Androhung eines Zugehörigkeitsausschlusses hilft einzig das Recht, und komplementär dazu erscheint Freundschaft als überaus vielfältige Verbindung zwischen Menschen, auf die Ansprüche nicht konstituiert sind, die somit niemand einklagen kann und die in den Bedingungen ihres Glücks sowie ihrer Dauer eines Rechtsschutzes weder fähig noch bedürftig sind.
Das freilich hat Freundschaft mit Liebe gemein und es ist eine alte Frage, wie Freundschaft und Liebe zusammenpassen oder auch nicht. Noch einmal sei an die Freundschaftsverhältnisse erinnert, die, weit gespannt und überdies nach Dauer und verbindenden Zwecken wechselnd, nach den wohlbegründeten Üblichkeiten unserer Sprache tatsächlich »Freundschaften« heißen und gleichwohl in keinerlei Bedeutung dieses Wortes zugleich Liebesverhältnisse wären – von den Vereinsfreundschaften bis zu den freundschaftlich verbundenen Völkern und näherhin auch ihrer politischen Repräsentanten.
Eben das stellt sich in Verhältnissen enger Freundschaft anders dar. Aus zahllosen Kinderfreundschaften sind schließlich Ehen geworden, dauerhafte sogar. Freunde verstorbener Ehepartner traten in neuer Ehe an deren Stelle. Partner gescheiterter Liebesverhältnisse blieben Freunde, in anderen Fällen aber gerade nicht. Dass enge und verlässliche Freundschaft eo ipso auch die Gewähr für eine gute Ehe böte, hat sich oft schon als Irrtum erwiesen, nämlich in jungen Jahren. Im Alter hingegen ist die Besiegelung alter Freundschaft durch einen Eheschluss häufig – oft auch in der lebensklugen pragmatischen Absicht, die rechtlichen Privilegien der Ehe dem Freundschaftspartner in Abwehr von Ansprüchen ferngerückter Familienangehöriger zu sichern.
So liesse sich lange fortfahren – vom häufigen und wichtigen Fall der Freundschaft zwischen Ehepaaren, wo sich die Freundschaft zugleich als das Medium des Respekts vor der Exklusivität der Ehebeziehung bewährt, bis zur Aufnahme allein gebliebener Freunde eines Ehepartners in den Freundeskreis beider. Man erfährt: Liebe konkurriert nicht mit Freundschaft, ist vielmehr der Grund der wichtigsten aller Beziehungen, die ohne Freundschaft gar nicht lebbar wären. Die Verlässlichkeit dieser Beziehung, in der schließlich auch unabdingbare Ansprüche Dritter, der Kinder zum Beispiel, gewährleistet sein wollen, sichert aber das Recht. Freundschaft, gewiss, gewährt, was das Recht zu sichern hat, ohnehin. Aber das Recht hält es über alle Zweifel hinweg einklagbar.
Gute Freundschaft bannt ihrerseits solche Zweifel, so dass Aristoteles im Freundschaftskapitel seiner »Ethik« sagen konnte, »das höchste Recht« werde »unter Freunden angetroffen«. Gleich im Auftakt dieses Kapitels sagt Aristoteles zusammenfassend, die Freundschaft sei »fürs Leben das Notwendigste«. Das passt zum erläuterten und auch durch die Sprache gedeckten Bestand, dass Freundschaft weit über enge Lebensfreundschaften hinaus über die ganze Breite menschlicher Lebensbeziehungen hinweg bis in die Politik hinein ineins reicher und leichter macht, was einzig gemeinschaftlich getan werden kann. Wohlwollen, Verlässlichkeit und Neigung sogar über das hinaus noch zu leisten, wozu wir gegebenenfalls rechtlich ohnehin schon verpflichtet wären – darin erkennen sich Freunde. Man braucht nicht Ethik zu studieren, um das zu wissen. Soweit wir zu neuerlicher Vergegenwärtigung dieses Wissens klassische Ethik-Texte zum Thema »Freundschaft« wieder einmal lesen möchten, blieben Ethiken aristotelischer Tradition wichtiger als diejenige Kants.
So oder so: Ethiken thematisieren insoweit nur, was ohnehin allbekannt ist, und verteidigen es nach Fälligkeit gegen intellektuellen und ideologisch-politischen Unverstand – gegen die Irrlehre zum Beispiel, die Überschreitung von Glaubens-, Klassen- oder Rassengrenzen seien der Freundschaft weder erlaubt noch perversionsfrei möglich. In diesem Sinn ist Freundschaft somit tatsächlich universell, aber anders als Menschenrechte nie allumfassend. Der Missverstand, sie sei es, verletzt nicht Freundschaftsgebote, vielmehr das Verbot der Selbstschädigung durch Mangel an Selbstliebe.
Das alles und mehr noch ist also wohlbekannt, soweit der Common Sense Geltung hat. Manifest ist das in der einschlägigen Weisheit der Sprichwörter, wie sie auch Aristoteles schon gesammelt hat. Sprichwörter deutscher Sprache gibt es zum Thema »Freundschaft« über hundert. »Alte Freundschaft« sei »die beste« – so heißt es erfahrungsgesättigt. »Freundschaft geht über Verwandtschaft.« Wieso? Wir wissen es schon: Weil sie eines Schutzes durch zwingendes Recht weder bedürftig noch fähig ist. Am nächsten kommt die Freundschaft noch der Liebe – das aber ohne Verführbarkeit durch unkluge Leidenschaft, so dass sich abschließend sagen lässt: »Freundschaft ist Liebe mit Verstand.«
Verena Kast