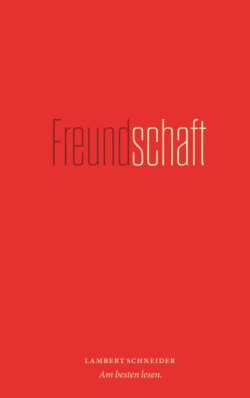Читать книгу Freundschaft - Helm Stierlin - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Freundschaft – und eine Menge Fragen
ОглавлениеAls ob das Wort Freundschaft nicht für sich alleine stehen könnte. Wir ziehen stattdessen alle möglichen Vergleiche und Verstärkungen zu seinem Verständnis heran. Sie sollen das offenbar Ungewöhnliche vermitteln, das sich mit dem keineswegs gewöhnlichen Wort verbindet: ewige Freundschaft, feste Freundschaft, innige Freundschaft, treue Freundschaft, unverbrüchliche Freundschaft, wahre Freundschaft, aber auch Kameradschaft, Männerfreundschaft, Kumpanei – ja auch Kumpanei. Und um klarzumachen, in welchem Zusammenhang man Freundschaft nicht erwarten sollte, werden Felder und Bereiche aufgeführt: die Politik zum Beispiel (Doch da auf keinen Fall), der Leistungssport (Wo kämen wir da hin), die Vorstandsetagen (Wie soll das funktionieren), die Frauenfreundschaft (Na ja, meinetwegen bei kleinen Mädchen). Man hört bei jedem der Begriffe schon förmlich den spöttischen Unterton mit.
Echte Freundschaft, das hat doch – folgt man gewissen »Mythologien« – mit außergewöhnlichen Mutproben, mit dem gemeinsamen Verspeisen eines Regenwurms oder mit Blutsbrüderschaft zu tun. Für Mädchen freilich gilt das nicht – oder bestenfalls höchst ausnahmsweise. Wer würde es aber schon wagen, sich in der realen Welt über eine »ewigwährende« Männerfreundschaft zu mokieren oder sie gar kabarettreif durch den Kakao zu ziehen? Selbst dann nicht, fürchte ich, wenn sie auf eine bierselige Runde zurückgeht. Mehr noch. Wer fragt sich nicht stillschweigend, ob ein kräftiger oder lässiger Schlag auf die Schulter eines so genannten »Freundes« wirklich Ausdruck einer echten Freundschaft ist und nicht vielmehr Geste einer vermeintlichen Überlegenheit? Und wer bei einem langgedehnten, betulichen Satz wie »Das will ich Ihnen aber mal sagen, mein lieber Freund« nicht rechtzeitig Reißaus nimmt, der hat entweder wirklich nur gute Freunde – oder schlichtweg gute Nerven.
Viele Freundschaften – so jedenfalls eine Theorie vom Austausch menschlicher Beziehungen – gründen in einer Art von wechselseitig nachrechenbarem »Austausch« auf emotionaler Ebene. Nicht selten tragen sie dazu bei, die Balance im eigenen Leben wiederherzustellen, Einfluss zu gewinnen oder auch Verstecke und Zufluchtsorte zu finden, falls es zu Konflikten kommt. Meistens pflegt man auch solche Freundschaften – meistens freilich nur so lange, solange man sie braucht.
Vielleicht aber, frage ich mich, verlangen wir, bewusst oder unbewusst, tatsächlich zu viel von Freundschaft. Offenbar möchten wir uns in Sicherheit wiegen, wenn wir und weil wir die Erfahrung machen, dass die Inanspruchnahme von Freundschaft und von freundschaftlichen Hilfen keine unguten Gefühle hinterlässt. Diese emotionale »Buchhaltung« kann auf Dauer allerdings mehr oder weniger stark belasten. Denn wir wollen – selbst in einer noch so guten Freundschaft – im Grunde auch unsere innere Ruhe behalten. Wir wollen, mit anderen Worten, nicht abhängig werden, nur weil uns jemand da und dort oder öfters mal geholfen hat.
Empfindungen dieser Art haben mitunter tiefe, ja archaische Wurzeln, wie sie nicht selten auch indianische Bräuche und deutsche Geschichtsbücher, englische Dramen und selbst klassische Gedichte widerspiegeln, die wir früher in der Schule zu lernen hatten. In derlei Überlieferungen musste sich beispielsweise ein junger Mann für seinen Freund aufopfern und umbringen lassen, weil es die Familienehre, dynastischer Zwang oder eine unbeglichene Schuld verlangt hat. Ein weites Feld, sollte man meinen. Eine tiefgreifende Frage auch: Ob sich, um seine Freundschaft zu beweisen, überhaupt ein Freund für den Freund mit seinem Leben »aufopfern« soll – ob oder ob nicht, wann und wann nicht, warum beziehungsweise warum nicht?
Doch zum Schluss eine Schlussfolgerung, die nochmals zur Frage der Abhängigkeit zurückkehrt: Sollen eine Freundschaft und die Erfahrung freundschaftlichen Dienstes nicht auf Dauer zur Last werden, müssen wir uns dessen sehr wohl eingedenk sein, dass jede Freundschaft (wirklich jede Freundschaft) und die Akzeptanz von freundschaftlicher Hilfe uns in gewisser, mitunter sehr subtiler Weise von dem Anderen »abhängig« machen, gelegentlich sogar für ein ganze Leben. Wie das im Einzelnen aussieht, kann hier offenbleiben. Aber »Abhängigkeit« muss keineswegs in jedem Fall das Aufgeben eigener Souveränität und den Verzicht auf eigenes Selbstbewusstsein bedeuten – es sei denn, sie geschieht aus dem Motiv von Macht und unbedingter Überlegenheit heraus. Wäre dem so, dann wäre bereits jedes kleine Geschenk unter Freunden dem Verdacht ausgesetzt, auch und gerade auf diese Weise sich den Anderen – den Freund oder die Freundin – unterwerfen zu wollen. Wahre Freundschaft aber bedeutet Partnerschaft auf Augenhöhe. Und ihr Antrieb besteht letztlich in der Anerkennung, der Wertschätzung und dem Respekt vor der Souveränität und der Würde des Anderen. Wird man jedoch auf Dauer das Gefühl nicht los, dass man dem Anderen immer noch und immer wieder etwas schuldig bleibt, dann gerät man unversehens – bewusst und unbewusst – an einen Punkt, an dem man auf die eine oder andere Weise etwas »wettmachen« und das eine oder andere »wiedergutmachen« will – an einen Punkt demnach, an dem und ab dem die Freundschaft den Charakter einer Leistung annimmt und damit ihren urtümlichen Charme verliert. Ob eine solche »Freundschaft« aber am Ende wirklich noch eine Freundschaft ist, wie wir sie uns eigentlich wünschen und sie uns oft genug ohne Hintergedanken und aus Herzensgrund sogar ersehnen?
Hermann Lübbe