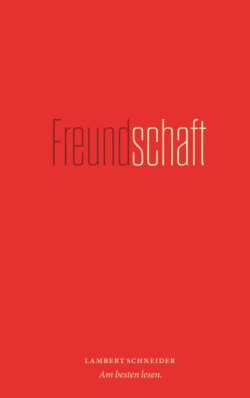Читать книгу Freundschaft - Helm Stierlin - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»O Freunde, es gibt keinen Freund!« Philosophische Einsichten und Ansichten
ОглавлениеDer Schein trügt – auch in Sachen Freundschaft. Ihn zu entlarven und als das zu erweisen, was er ist, ist Sache der Philosophie seit den Tagen des Sokrates. Der Philosoph als »Freund der Weisheit« – wird er Antwort geben können auf das Fragen nach dem Grund, dem Wert und den Formen von Freundschaft? Antworten, die nicht trügen, sondern anregen und vielleicht ein wenig Orientierung bieten?
∗
Die gedankliche Beschäftigung mit dem Thema Freundschaft reicht weiter zurück als bis zu den Griechen, und sie reicht weit über das Mittelmeer hinaus. Man mag ins alte China schauen oder ins alte Indien, man mag ganz tief in den Brunnen der Vergangenheit hinabsteigen und sich mit der altägyptischen Lebenswelt befassen, immer wird man feststellen, dass es Texte gibt, die der Freundschaft gewidmet sind und ihr hohes Lied singen. Freundschaft, so viel wird schnell deutlich, ist in all ihren Formen unbestreitbar ein universales Thema der Menschheit. Sosehr ihre Formen und Ausgestaltungen durch den »Geist der Zeiten« und spezifische mentale und kulturelle Prägungen bestimmt sind, so sehr zeigt die angedeutete geographische Reichweite und historische Tiefe zugleich, wie dicht das Phänomen »Freundschaft« mit dem Kern unseres anthropologischen Substrats verbunden ist.
∗
Für Europa sind die Kernbestände des philosophischen Freundschaftsdiskurses bis auf den heutigen Tag in der Welt der Antike durch die Griechen und ihre römischen Erben formuliert worden. Ihren Anfang nahm diese Entwicklung in der Zeit des frühen Griechentums, wo sich allmählich eine Vorstellung vom Wert des Einmaligen, Individuellen entwickelte, wo die Erfindung des Individuums in diesem neuen Sinn sich verband mit einer sich öffnenden politischen Situation, die unter der Leitidee des Demokratischen die bis dahin gesellschaftlich dominierenden Verwandtschaftsbande zurückdrängte zugunsten jener Wahlverwandtschaften, die auf gemeinsamen Überzeugungen und Zielen beruhen. Man könnte in diesem Kontext geradezu von einer Emanzipation der Freundschaft im Kontext des Politischen sprechen: Je offener die politische und gesellschaftliche Lage sich darstellte, je weniger Verlass demnach auf Traditionelles und Althergebrachtes war, desto dringlicher wurde die Frage nach dem, was einen Freund ausmachen kann, desto nachdrücklicher entwickelte sich ein Verlangen nach Wissen über das Wesen der Freundschaft. Dass angesichts dieses Ursprungs zugleich für lange Zeit die Rolle der Frau als Freundin und geistiger Gefährtin ins Abseits gedrängt wurde, weil ihre gesellschaftliche Stellung sie damals aus dem erwachenden Freundschaftsdiskurs ausschloss, gehört zu den Schattenseiten einer antiken Konstellation, die erst heute langsam korrigiert werden können.
∗
Es war dann – natürlich – Platon, der nach früheren naturphilosophischen Versuchen, die philía (Liebe und Freundschaft) als kosmogonische und kosmosverbindende Kraft zu begreifen, in seinen Dialogen Lysis und Phaidros versucht hat, eine neuartige begriffliche Klarheit zu gewinnen über das Wesen der Freundschaft als zwischenmenschlicher Beziehung: Sind es die Gegensätze, die sich bei einer Freundschaft anziehen, oder setzt Freundschaft eine gewisse Gleichgestimmtheit der Seelen voraus? Kann Freundschaft funktionieren, wenn sie einseitig ist, oder verdient sie nur, wenn sie auf Gegenseitigkeit beruht, diese Bezeichnung? Und schließlich: Was gibt einer Freundschaft jene Stabilität, die ihr Dauer verleiht? Bei Platon wird zum ersten Mal im europäischen Freundschaftsdiskurs deutlich, dass Freundschaft nur dann in einem gewissen höheren Sinne gültig und dadurch von Dauer sein kann, wenn sie in jener höheren geistigen Wirklichkeit beheimatet ist, die in seiner Philosophie als Reich der Ideen beschrieben wird.
∗
Wirkmächtiger als sein Lehrer Platon hat danach Aristoteles, die Fragen des Älteren aufnehmend und ausbauend, dem Thema Freundschaft in seinen Schriften zur Ethik einen breiten Raum gegeben. Wenn von Platon die grundlegenden Fragen geblieben sind, so sind es bei Aristoteles in seiner stärker empirisch-phänomenal arbeitenden Betrachtungsweise einige exemplarisch gültige Differenzierungen und Einzelbeobachtungen, die wir bis heute – bewusst oder unbewusst, mit oder ohne Wissen um ihre Herkunft – verwenden. Seine Unterscheidung von der Nutzenfreundschaft, die nur so lange hält, wie der Nutzen erkennbar ist, den man sich von ihr verspricht, der Lustfreundschaft, deren Grundlagen in ähnlicher Weise wandelbar und damit prekär sind, und schließlich der wahren philosophischen Freundschaft, deren gemeinsame Triebfeder das Streben nach einer alle bloß individuellen Interessen transzendierenden Tugend bildet, basiert auf Platons ontologischer Unterscheidung, differenziert sie aber aus zu einer phänomenalen Beschreibung der Vielfalt von Freundschaften als Voraussetzung für ein gelingendes Leben. Das ihm zugeschriebene, zunächst paradox erscheinende Diktum »O Freunde, es gibt keinen Freund!« zeigt den neu erhobenen Anspruch an eine wahre und auf Dauer gestellte Freundschaft ebenso wie die pragmatische Akzeptanz von Freundschaften, die vorhanden sind, auch wenn sie dem hohen Leitbild noch nicht entsprechen. Denn dass Freundschaften wachsen müssen, dass Vertrauen Zeit braucht, sich zu bilden, dass die Gesellschaft in ihrem Streben nach einer gerechten Ordnung dauerhaft angewiesen bleibt auf freundschaftliche Beziehungen zwischen einzelnen ihrer Mitglieder, deren geistiger und zugleich emotionaler Zusammenhalt sich wie ein stabilisierender Kitt auf das große Ganze auswirkt, all das wurde von Aristoteles ebenso klar registriert und beschrieben, wie er auch vom Subjekt die grundsätzliche Voraussetzung dafür erfasst hat, dass sich echte Freundschaften überhaupt bilden können: Ohne eine natürliche (nicht übersteigerte!) Eigenliebe kann es auch keine wahre Liebe und Freundschaft zu einem anderen Menschen geben! Und diese wahre Liebe und Freundschaft, eine Freundschaft, die auch Kritik verträgt und die man als »sichtbares gegenseitiges Wohlwollen, verbunden mit Zuneigung und Liebe« definieren kann, bleibt ein höchst seltenes Phänomen: Nur schwer möglich erscheint es, mit vielen Menschen, schier unmöglich, mit allen Menschen befreundet zu sein.
∗
Die Grundlinien dieses aristotelischen Freundschaftskonzepts kehren – bei aller sonstigen Verschiedenheit – im antiken Raum auch bei den Stoikern und Epikureern wieder; beide Schulen schätzten die Freundschaft hoch und haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Antike bis heute das Gravitationszentrum des Freundschaftsdiskurses geblieben ist. Die entsprechenden Schriften wie Ciceros »Laelius oder über die Freundschaft«, Senecas Ausführungen in den »Epistulae morales« oder Plutarchs Abhandlungen zum Thema werden auch von heutigen Lesern noch gerne wahrgenommen. Dabei dürfte wohl mit eine Rolle spielen, dass der in der Spätantike einsetzende christliche Freundschaftsdiskurs zwar auf breiter Front die antiken Voraussetzungen in sich aufnimmt, sie aber eben auch theologisch überhöht in einer Weise, die nicht mehr allen Menschen des 21. Jahrhunderts unmittelbar zugänglich ist: Für Autoren wie Ambrosius oder Augustinus ist Gott, mit dem wir durch seine Liebe und Gnade verbunden sind, die letzte Quelle und das Ziel der Freundschaft.
∗
Erst im Humanismus der beginnenden Neuzeit löst sich der Freundschaftsbegriff wieder von der Beziehung zu Gott und wird diesseitig zwischenmenschlich verstanden; die christlichen Züge treten gegenüber den aristotelischen zurück. In diesem Sinne nachhaltig gewirkt hat vor allem Montaigne mit seinem Essay über die Freundschaft. Seine Definition des Freundes als des »alter ego«, des zweiten Ich, schließt wörtlich und unmittelbar an Aristoteles an. Doch während Aristoteles den gesellschaftlich-politischen Kontext stark mitbedacht hat, tritt dieser Aspekt bei Montaigne ganz in den Hintergrund. Beseelt von seiner Ausnahme-Freundschaft mit Étienne de la Boétie rückt nun ein stark individualistisches Verständnis von Freundschaft in den Vordergrund: »Es ist kein kleines Wunder, sich zu verdoppeln.« Der Freund wird zur höchsten Form der Selbstverwirklichung. Die Herzensfreundschaft, die durch freie Wahl ohne Zwang entsteht, überragt an Intensität und Dauer auch jegliche familiäre Bindung und steht weit über der flüchtigen Leidenschaft der Liebe. Diese Art Freundschaft ist nicht rational zu erfassen, sondern ein Geschenk, das in der irgendwie zu einander passenden Besonderheit der Individuen ihren letzten Grund hat, wie er es im Hinblick auf La Boétie abschließend formuliert hat in dem Satz, sie seien Freunde gewesen, »weil er er, weil ich ich war«.
∗
In den folgenden Jahrhunderten der neuzeitlichen Philosophie verschieben sich die Gewichte der Freundschaftstheorien mal mehr zur Seite der Vernunft, dann wieder zur Seite der Betonung des Gefühls. Während im Rationalismus das Vernunftgemäße der Freundschaft gegenüber dem Affekt der leidenschaftlichen Liebe betont wird, setzen die Autoren des Sturm und Drang die Welt des Affektiven wieder in ihr Recht ein, wird die Bedeutung der gefühlsmäßigen Verwandtschaft und Verbundenheit der Seelen für die Freundschaft hervorgehoben. Während Kant es kaum ertragen kann, dass der Freund zuerst den Freund retten würde beim Untergang, und die Freundschaft rigoros an das für alle gleiche, wechselseitige Liebe und Achtung heischende Sittengesetz gebunden wissen will, das niemanden privilegiert, steigert die Romantik etwa bei Jean Paul die Idee der Freundschaft bis hin zur Vorstellung einer »Zwei-Einigkeit«, die Freundschaft subjektiviert und mystifiziert als Feier des Göttlichen im anderen.
∗
Noch stärker eingebunden in die jeweilige Philosophie und nur aus deren jeweiligem Kontext angemessen verstehbar erscheinen die Freundschaftskonzepte dann bei Kierkegaard, Schopenhauer oder Nietzsche. Ohne darauf hier näher eingehen zu wollen, wirft diese Tatsache selbst schon ein erhellendes und bestätigendes Licht auf die späteren soziologischen Analysen von Georg Simmel zur Freundschaft, nach der analog zur Differenzierung unserer Lebensverhältnisse auch die Muster von Freundschaft vielfältiger werden, dabei aber zeitlich und sachlich gebundener an bestimmte Umstände und Funktionen; Patchwork-Freundschaften sozusagen, Lebensabschnittsbeziehungen. Freundschaften, die auf die ganze Person und auf Dauer zielen, scheinen sich gesamtgesellschaftlich unter den lebensweltlichen Bedingungen der Moderne und Postmoderne im 21. Jahrhundert eher im Sinkflug zu befinden …
∗
Wird es also schon bald keine Freundschaft mehr geben? Oder zumindest keine wahre, echte, tiefe Freundschaft? Weil sich die Bedingungen der Zeit dagegen verschworen zu haben scheinen? Und wollen wir das? Und werden wir das zulassen?
∗
»O Freunde, es gibt keinen Freund!« – Der Aristoteles zugeschriebene Satz zeigt, dass es mit der Freundschaft noch nie so einfach war und dass es immer schon verschiedene Formen und Grade von Freundschaft gab. Die historische Selbstvergewisserung philosophiegeschichtlicher Positionen kann dabei helfen, mit mehr Abstand und hellerer Kritik die Zumutungen und Chancen der eigenen Zeit zu reflektieren – und sie kann so das Spiel neu eröffnen und den Diskurs konstruktiv fortsetzen. Wenn heute Derrida in seinem Werk über die »Politik der Freundschaft« die in der frühen Neuzeit in den Hintergrund getretene soziale Dimension des Freundschaftsdiskurses im Anschluss an Aristoteles wieder einholt, oder wenn Wilhelm Schmid in seinem Philosophie als »ars vitae« rehabilitierenden Buch »Mit sich selbst befreundet sein« die Bedeutung der angemessenen Eigenliebe unter den Bedingungen der Moderne wieder neu entdeckt und durchdekliniert, dann wird man vor dem Hintergrund solcher Entwürfe ermutigt sagen können, dass die Philosophie immer noch die Kraft hat, jene Diskurse aufzugreifen und neu anzustoßen, die das, was ist, unterscheiden möchten von dem, was nur zu sein scheint.
∗
Natürlich entfaltet ein gelungener Diskurs noch nicht – gleichsam wie von selbst – eine gelingende Freundschaft. Aber er kann mit seinen Differenzierungen vielleicht dazu beitragen, etwas mehr Klarheit zu gewinnen in den und für die Situationen, in denen wir mit unseren Entscheidungen über die Wahl der Freunde zugleich unser Leben gestalten …