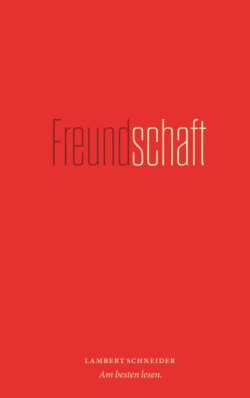Читать книгу Freundschaft - Helm Stierlin - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Feind und Freund. Freund und Feind Redensarten als Ratschläge
ОглавлениеAus der Völkerwanderungszeit stammen für unseren Kultur- und Sprachraum die ersten Ratschläge, die dazu auffordern, das jeweilige Gegenüber zu prüfen, ob in ihm nicht ein Feind bedrohlich lauere:
»Nach allen Türen, eh man eintritt/ soll sorglich man sehen,/soll scharf man schau’n:/ Nicht weißt du gewiss, ob nicht weilt ein Feind/ auf der Diele vor dir.« – »Von seinen Waffen/weiche der Mann/ keinen Fuß auf dem Feld,/denn er weiß nicht genau,/ wann auf den Wegen/des Speers er draußen bedarf.« – »Mit dem Gere nehme man Gaben entgegen, Spitze gegen Spitze.« Aus dem Misstrauen erwächst dann die Hoffnung auf Vertrauen, die Sehnsucht nach einem Freund, der schützend zur Seite steht. »Jung war ich einst,/einsam zog ich,/da ward wirr mein Weg;/ glücklich war ich,/als den Begleiter ich fand,/ den Menschen freut der Mensch.« (Aus der »Edda«)
Die polare Konstellation von Menschen ist, anthropologisch gesehen, archetypisch: Von der menschlichen Frühzeit bis zur Facebook-Epoche ist ein Urbild im Unterbewusstsein und Bewusstsein: die Erwartung, einen die Widrigkeiten des Lebens mittragenden Gefährten zu finden. Dessen Ausprägung wechselt; die Etymologie des Wortes »Freund« zeigt dies: Es gehört zum gotischen Verb »frijon« (lieben), steht auch für Verwandter, LiebhaberIn, Vertrauter. Die Definition, die übergreifend den »Freund« charakterisiert, meint eine Person, die man liebt, deren Bestes man zu befördern sucht – ohne Rücksicht auf das Geschlecht. Die lexikalischen Belege, die etwa in Hermann Pauls »Deutschem Wörterbuch« zum Gebrauch des Wortes »Freund« herangezogen werden, zeigen ein weites Spektrum. »Mein Freund ist mir ein büschel Myrrhen, dazwischen meinen Brüsten hanget« (Martin Luther im »Hohenlied«) weist auf die erotische Komponente; das Sprichwort »Freunde in der Not/gehen tausend auf ein Lot« zeigt auf die Wankelmütigkeit von Freundschaft. »Freunde des Stadttheaters« meinen die Verbundenheit mit einer »Sache« (hier einer Einrichtung). Wenn Goethe aufklärt: »Grau, teurer Freund, ist alle Theorie«, sucht er mit solcher Anrede aufgeschlossene Proselyten.
Ich versuche mit diesem knappen kursorischen Streifzug durch Definitionen, Redensarten und »geflügelten Worten« meine Unsicherheit, bei wem und wann ich von einem Freund oder einer Freundin sprechen kann, etwas abzubauen, mit der Hoffnung, dass ich dadurch auch anderen eine Verständigungshilfe geben kann.
So unbestritten es üblicherweise ist, dass der Feind kein Freund ist, so wird doch mit dem biblischen »Liebet eure Feinde« und »So nun dein Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so tränkt ihn« die trennende Wand zu Mitmenschen durchbrochen. Was sich hier als eine irrational-humane Botschaft erweist, wird pragmatisch zum Rezept der Klugheit beim Umgang mit Feinden reduziert, wenn etwa Friedrich Schiller in den »Votivtafeln« rät: »Zeigt mir der Freund, was ich kann, lehrt mich der Feind, was ich soll« und ähnlich Magnus Gottfried Lichtwer: »Nützlich ist uns oft ein Feind. Er dient, wenn er zu schaden meint.« Also, so Georg Rollenhagen: »Ein Narr, der seinen Feind verachtet.« Und ähnlich das Sprichwort: »Wenn du einen Feind nicht besiegen kannst, mach ihn dir zum Freund.«
Während gerade auch politische Klugheit dazu rät, einem fliehenden Feind goldene Brücken zu bauen, ist eine Aussage von Jean Racine, jenseits jeder mitleidigen Regung, charakteristisch für die Wirklichkeit: »Ans Herz drück ich den Feind, doch um ihn zu ersticken.« Verschränkt sind Feind und Freund in Arthur Schopenhauers bissiger, aus dem Arabischen übernommenen Maxime: »Was dein Feind nicht wissen soll,/das sage deinem Freund nicht.« Sie nimmt unsere heutige Medienwirklichkeit mit ihren Indiskretionen vorweg.
Bei aller Skepsis dem Verhalten und der Mentalität sogenannter Freunde gegenüber, auch angesichts der fließenden Übergänge vom Freund zum Feind und Feind zum Freund (mit vielen schmerzlichen und auch ermutigenden Erfahrungen – je nach »Richtung« des Wandels) –, überwiegt doch die Überzeugung, dass es den guten Freund gibt, der bedingungslos zu einem hält. Er wird entsprechend von den Dichtern rhapsodisch besungen (etwa in Friedrich Schillers »Bürgschaft«). Lieder der Freundschaft sind eine ergreifende Quelle für die Stärkung der Gewissheit, dass im Freund Treue zur Person geworden ist, eine Person, die Halt bei Kummer, Schmerz und Trauer gibt, mit der man aber auch gemeinsam die Freuden des Lebens genießen kann.
| »Was kann die Freude machen, die Einsamkeit verhehlt? Das gibt ein doppelt Lachen, was Freunden wird erzählt; | der kann sein Leid vergessen, der es von Herzen sagt; der muss sich selbst auffressen, der in geheim sich nagt.« (Simon Dach) |
Erschreckend ist, dass oft am Verlust des Freundes menschliche Aggressivität schuld ist, ein Feind ihn uns von der Seite reißt. »Ich hatt’ einen Kameraden,/einen bessern findst du nit …« Es bleiben dann nur Schmerz und Trauer.
Freundschaft, das bedeutet Seelenverwandtschaft. »Amicum esse unam animam in duobus corporibus« lautet die lateinische Übersetzung eines Wortes von Aristoteles (»Ein Freund sei eine Seele in zwei Körpern«). Dies schließt ein, dass man, wenn man zum Freund gut ist, auch mit sich selbst im Reinen sein muss und nicht vom Freund erwartet, dass er Zerrissenheit kitten soll. Man darf nicht auf den Freund abladen, was man selbst tragen und (wie man heute sagt) »schultern« sollte.
»Wer nicht sein eigener Freund, dein Freund kann er nicht sein./auch der nicht, wer nur ist sein eigner Freund allein.« (Friedrich Rückert)
Aber William Shakespeares Aufforderung (in »Julius Cäsar«): »Es soll ein Freund des Freundes Schwächen tragen« ist, wenn es beachtet wird, ein Glücksfall.
Heutzutage, in einer Zeit und Welt der schnellen und vielen Kontakte, der eiligen Verbindungen (und der ebenfalls raschen Auflösungen), der hektischen Suche nach massenhaftem Miteinander, der warenästhetisch auf deodorantes Frischwärts getrimmten Libido und all der besonders durch die Medien bewirkten inflationären Kommunikationsmöglichkeiten, ist der Spruch »Wer jedes Freund sein will, ist niemandes Freund« oder die Variante dazu: »Aller Menschen Freund ist nicht mein Freund«, sehr ernst zu nehmen – und nicht nur von Facebook-Partnern und – Partnerinnen zu berücksichtigen. Und auch die biblische Weisheit, dass ein treuer Freund mit keinem Geld noch Gut zu bezahlen ist, hat angesichts des dominanten Kapitalismus, Materialismus, Mammonismus ganz neue Aktualität erhalten.
Es prüfe, wer sich bindet: Auch wenn wir hier nur eine kleine Auswahl von Spruchweisheiten zitieren und kommentieren konnten – klopft man sie auf ihren inneren Gehalt hin ab, so können sie doch helfen, meine ich, sorgfältig und »bedenklich«, d.h. seinem Kopf und Herzen zwar folgend, aber nicht ungestüm und unbeherrscht, verlässliche Freundesbande zu knüpfen – eingedenk der Feststellung von Dante Alighieri: Dass wir ohne Freunde kein vollkommenes Leben haben können.
Heide Simonis