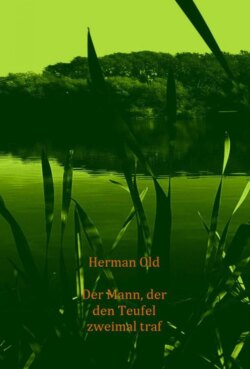Читать книгу Der Mann, der den Teufel zweimal traf - Herman Old - Страница 4
Ostpreußen Januar 1936
ОглавлениеEs war ein typischer, eiskalter Morgen, am 4. Januar 1936, wenige Jahre nach Adolf Hitlers Machtergreifung. Elisabeth Stephan lag in ihrem Bett und es zerriss sie fast vor Schmerzen. Um kurz vor sechs Uhr hatten die Wehen bei ihr eingesetzt. Ihr Mann Andreas war zu dieser Zeit schon lange zu Fuß auf dem Weg zur Seilerei nach Neukuhren. Er hätte auch den Pferdewagen nehmen können, aber er bewegte sich ganz gern. Die Ortschaft lag immerhin fast fünf Kilometer entfernt, da musste er sich schon früh auf den Weg machen, um nicht zu spät zu erscheinen. Der alte Seilermeister Pahlke nahm es schon ziemlich genau mit den Arbeitszeiten. Dafür stimmten aber das Klima in der Firma und vor allem die Bezahlung. Er war als Chef ungemein beliebt, und wer hier seiner Arbeit nachkam, der fand stets ein offenes Ohr bei ihm. Wenn die Qualität seiner Waren stimmte, dann ließ er alle seine Mitarbeiter durch gelegentliche Belohnungen daran teilhaben. Den ausscheidenden Alten, zahlte er sogar freiwillig eine kleine Rente bis an ihr Lebensende. Er wollte nur nicht, dass darüber geredet wurde. Der alte Pahlke war kein Unbekannter. Die Seilerei belieferte die gesamte Küste Ostpreußens mit ihren Seilen, Tauen, Strickleitern, Hängematten, Schnüren und Netzen jeder Art, und Andreas war der Vorarbeiter unter den Seilmachern. Deswegen wollte er stets vor allen anderen in der Seilerei sein. Der Arzt in Cranz hatte die Geburt Andreas dritten Kindes für diese Tage angekündigt, und deshalb war er in Sorge, ob zuhause alles ruhig ablief, ohne ihn. Seine Schwägerin war aber immer in der Nähe seiner Frau, also sollte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn nicht alles wie immer vor sich ging. Trotzdem, ein Vater, auch ein zweifacher wie er schon war, machte sich eben seine Gedanken zum ankommenden Kind. Elisabeths Schwester Lene war bereits seit einer halben Stunde unterwegs ans andere Ende vom Ostseebad Cranz, um die alte Hebamme Ilse Streiter zu holen. Frau Streiter hatte schon den beiden Stephans und später den anderen Kindern der Stephans auf die Welt geholfen. Erich und Lieselotte waren jetzt mit ihren fünf und drei Jahren immer noch klein, und jetzt kam das dritte Kind in den Schoss der Familie. Zum Glück waren die beiden anderen bei den Großeltern in Palmnicken. Kurz vor Weihnachten 35, also vor etwas mehr als einer Woche war Elisabeth noch mit den beiden kleinen allein am kalten Strand der kurischen Nehrung auf der Ostseeseite um spazieren zu gehen und ein paar kleine Bernsteine zum Basteln zu sammeln. Die Kinder hatten den höchsten Spaß beim Suchen zwischen Tang, Steinen und Muscheln. Auf einmal kam Liesel mit einem kopfgroßen Bernstein daher, den sie kaum schleppen konnte. Ihr großer Bruder half ihr schließlich dabei, und zu zweit gelang es ihnen, den Brocken zur Mutter zu tragen. Stolz wie die Schneekönige, standen sie vor diesem gewaltigen Stein, der eigentlich gar keiner war, und strahlten um die Wette. Die Mutter wusste, dass sie diesen großen Bernstein bei der Ortskommandantur abliefern müsste, aber das war ihr in ihrem Zustand jetzt absolut zu viel. Alles was größer war als eine normale Faust, wollte der Polizei Kommandant angezeigt und abgegeben wissen, es galt als Reichseigentum. Empfindliche Strafen zog es nach sich, wenn man mit einem großen Bernstein erwischt wurde, die bis zum Gefängnisaufenthalt gingen. Deswegen hob sie ihn ächzend auf und ließ ihn zwischen einige Felsen gleiten, an denen sie lehnte. Mit einem „Klong“ landete der Bernstein auf seinem neuen Platz. Sie sagte den Kleinen, dass sie ihn später abholen würden. Sollte doch bitte schön, jemand anderes diesen Klumpen finden und sich damit auf den Weg zurück nach Cranz machen. Sie hatte weder etwas gesehen noch gefunden. Doch heute war der Geburtstag ihres dritten Kindes, und um kurz vor sieben Uhr war es soweit. Die Hebamme war vor Ort, alle Anwesenden halfen mit, und der kleine Werner Stephan tat seinen ersten Atemzug in diesem Leben und verkündete der Welt mit kräftigem Geschrei, dass er jetzt gerade geboren sei. Die Hebamme sagte. „Dat is a Kerlche, ein Frühaufsteher, aus dem wird mal was besonderes.“ Am späten Nachmittag kam der Vater eiligst und neugierig nach Hause, sah die grinsenden Gesichter seiner Kleinen, eilte zu seiner Frau Elisabeth, küsste sie dankbar und schloss seinen Werner glücklich strahlend, liebevoll in die Arme. Der kleine Werner wuchs heran in einer Zeit, in der die Welt den Atem anhielt. Der Erste Weltkrieg war noch nicht lange genug vorbei, als das die Menschen ihn schon vergessen hätten. Das Damoklesschwert eines weiteren großen Krieges, der vielleicht sogar ausufern und zu einem Weltbrand gedeihen konnte, lag in der Luft. Seit 1920 war von Frieden in Europa nicht viel zu sehen. Ständige Grenzverletzungen, kleinere Angriffskriege geschahen am laufenden Band. Bis Hitler dann den für die Welt verhängnisvollen Satz sprach. „Seit fünf Uhr fünfundvierzig wird jetzt zurückgeschossen.“ Das war das Ende aller Träume von Frieden in Europa, und in vielen anderen Teilen der Welt. Bis zu seinem fünften Lebensjahr konnte Werner eine unbeschwerte Kindheit genießen, wie viele Kinder überall auf der Welt auch. Er ging mit seinen Eltern am Wochenende an das kurische Haff zum Baden, manchmal fuhren sie auch mit einem kleinen Ruderboot zum Zander Angeln raus, suchten Bernstein mit der ganzen Familie an der Ostseeseite, und oft waren sie in Palmnicken bei den Großeltern, wo der Opa früher im Beinsternbergwerk gearbeitet hatte, über das ganze Wochenende. Sein Bruder Erich und Klein Werner schlichen manches Mal mit Pfeil und Bogen bewaffnet, wie die Indianer durch den Wald, auf der Jagd nach Kaninchen und Fasanen. Dem Kleinwild fiel natürlich Besseres ein, als sich von den beiden Kindern erwischen zu lassen. Einmal trafen sie dabei allerdings wahrhaftig auf ein Kaninchen. Es hing gefangen in einer Schlinge, die jemand ausgelegt hatte, der vom Wildern etwas verstand. Das arme Tier zappelte so heftig, als es die beiden sah, das sich beide erschrocken umdrehten und wegliefen so schnell sie konnten. Diese Stelle mieden sie in Zukunft wie die Pest. Am Abend erzählte Erich dann seiner Mutter, dass er heute tatsächlich beinahe ein Kaninchen geschossen hätte. Das waren die schönsten Jahre seiner Kindheit. Unbeschwert und leicht, wie eine Kindheit sein sollte. Dann begann der Krieg. In den kommenden sechs Jahren sollten sechzig Millionen Menschen ihr Leben verlieren. Weitere Millionen verloren ihre Familien, ihre Heimat oder wurden deportiert. Die Schlange des Krieges langte ordentlich zu, und verschlang jeden und alles, dessen sie habhaft werden konnte. Der Krieg tobte die ersten Jahre an Fronten, die weit, weit weg von Ostpreußen lagen, und die teilweise niemand in Cranz kannte. Ungarn, Rumänien, Griechenland, Belgien, Schweiz, Luxemburg, Teile Afrikas, Frankreich, Norwegen. Überall schien der deutsche Soldat ohne großen Widerstand Siege zu erringen. Das klang natürlich in den Ohren der deutschen Bevölkerung verlockend. Solange sich der Krieg nicht vor der eigenen Tür abspielte, war er vertretbar. Außerdem war immer die Rede vom Endsieg, also musste der Krieg ja auch bald mal zu Ende sein. Man wollte ja nicht auf ewig im Kriegszustand sein. Aber die Alten, die hatten kein gutes Gefühl dabei. Der alte Seilermeister Pahlke sagte manches Mal mit Sorgenfalten auf der Stirn. „Nee, nee, Kinners,wenn das mal jut geht. Nich das wir eines Tages mal den Iwan vor der Tür haben. Ihr kennt den Iwan nich. Nee, das wünschen wir uns mal besser nich, Kinners.“ Werners Vater war von Kriegsbeginn an irgendwo als Soldat eingesetzt. Keiner wusste genau, wo er für Führer, Volk und Vaterland diente. Er war mit tausenden anderen, schon älteren, nach Russland marschiert. Von irgendwo dort kam im Winter 43/44 noch ein einziges Mal eine Feldpostkarte von ihm. Dann blieb es stumm um ihn. Das war die letzte bekannte Tatsache von Andreas. Und die Kriegsjahre dauerten an, bis es im Sommer 44 geschah. Der Krieg hatte sich nach der Invasion in der Normandie schon eine Weile gegen Deutschland gewandt, und jetzt kam der russische Alptraum nach Ostpreußen. Unaufhaltsam rückte er näher. Frontverschiebung nach hinten, hieß es bei der Wehrmacht. Keine Front hielt ihm und den alliierten Waffen auf Dauer Stand. Der Krieg war verloren. Ostpreußen war verloren. Endgültig. Der Exodus begann. Tausende Menschen quälten sich Richtung Westen. Als Volksschädlinge, Feiglinge, ja sogar als Vaterlandsverräter titulierte man Frauen, Kinder und alte Leute, die nichts weiter als ihre Haut retten wollten. Im Winter, der mit bitteren Temperaturen aufwarten sollte, gingen planlos Zehntausende Menschen zur Massenflucht über. Ganze Familien, meist ohne die Männer, flohen zu Fuß bei einer Schneedecke von bis zu 20 Zentimeter und Temperaturen von unter 20 Grad Minus. Weg hier, nichts wie weg, war das Motto. Der Russe sitzt uns im Nacken. Und was der Russe mit ihnen anstellen würde, sollte er sie packen, daran gab es keinen Zweifel. Die Flugblätter, die deutschsprachige Juden verfasst hatten, sprachen eine deutliche, grausame Sprache. Kein Deutscher aus Ostpreußen sollte entkommen. Die Straßen und Feldwege waren von kaputten Fahrzeugen, Leichen und toten Pferden verstopft. Oft mussten große Umwege über Felder und Gräben in Kauf genommen werden. Dabei stürzten nicht selten Wagen um und alles flog durcheinander. Mensch und Tier schrien vor Schmerz, Hunger und in höchster Not. Geflucht, gejammert und gebetet wurde ohne Unterlass. Und viele Trecks wurden vom einbrechenden, nachsetzenden Russen zersprengt. In den Wäldern lauerten teils einzelne Trupps Soldaten, um vom Wege abgekommene Wagen oder Nachzügler abzupassen. Auch die ehemals der Heimat beraubten Polen, die sich bis dahin noch still verhielten, veranstalteten nun furchtbare Rachefeldzüge und Gemetzel an den Deutschen. Vielen Menschen gelang es nicht mehr, die relative Sicherheit im Westen zu erreichen. Die rettende alte Heimat war weit weg, und der Russe war da. Das Drama um Ostpreußen ging seinem Ende zu.