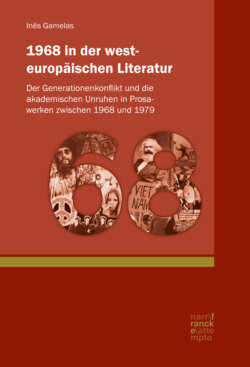Читать книгу 1968 in der westeuropäischen Literatur - Ines Gamelas - Страница 10
1.4 Die italienische 1968er-Bewegung: ein langer und heftiger Frühling
ОглавлениеAm Ende der 1960er-Jahre war Italien ein weiteres demokratisches Land in Europa, in dem die junge Generation gegen die herrschenden Sitten rebellierte und heftig bis kämpferisch versuchte, das Signal zu einem politischen, sozialen und kulturellen Aufbruch zu geben. Die Studentenunruhen begannen 1967 in den Universitäten, verlagerten sich aber schon 1968 schnell auf die Straßen der Städte landesweit (vgl. Casilio, 2013: 130f.), wo sie bis Ende 1969 andauerten. Die italienische Protestbewegung fand in der Allianz von Studenten und Arbeitern die höchste Ausdrucksform eines gemeinsamen Willens, die autoritäre, stark hierarchische, wenig offene und konservative Realität zu reformieren – eine Realität, die nicht dem Partisanentraum von Freiheit, Fortschritt und Demokratie entsprach, der die junge Republik Südeuropas nach dem Zweiten Weltkrieg bei ihrer Gründung angetrieben hatte.
Auf seinem langen Weg zur Demokratie kannte Italien große Fortschritte: Dank dem sogenannten »Wirtschaftswunder« am Ende der 1950er-Jahre und in der ersten Hälfte der 1960er und dem Wiedererstarken der Industrie beobachtete man eine Erhöhung der Kaufkraft und eine allgemeine Verbesserung der Lebensbedingungen sowie die Herausbildung einer modernen und urbanen Mittelschicht, die hauptsächlich freie Berufe ausübte und nicht so einem traditionellen Lebensstil folgte.1 Diese wirtschaftliche und industrielle Entwicklung führte jedoch keineswegs zu einer allgemeinen Liberalisierung der Gesellschaft (vgl. Azzellini, 2008: 173), die die Kritiker der traditionellen parlamentarischen Politik und die jungen Menschen für dringend erforderlich hielten, besonders wegen des Widerstrebens der politischen und akademischen Institutionen gegen jegliche Veränderung.
Neben den gewöhnlichen Krisen in den Regierungen war die Politik gekennzeichnet durch das Fehlen einer starken parlamentarischen Opposition im Parlament und durch Stagnation, Mangel an neuen Ideen und Vorschlägen.2 Als 1964 Aldo Moro an die Macht kam, wurde Italien von einer großen Koalition aus vier Mittelinksparteien regiert. Sie waren dennoch unfähig, sich über die Umsetzung struktureller Reformen zu einigen.3
Der Unmut der Studenten über die akademische Lage wuchs parallel mit der politischen Ziellosigkeit, dem Ansteigen der Arbeitslosenzahlen, den Streiks. In den Universitäten von Mailand, Rom, Pisa und Trient gab es erste Anzeichen einer Studentenbewegung, die sich ab 1965 verstärkten. Das war das Jahr, in dem im Parlament eine Reform des Hochschulsystems beraten wurde, deren Ziel es war, die Anzahl der Studienjahre zu reduzieren und die Bildung auf den Bedarf der Wirtschaft auszurichten (vgl. Frei, 2008: 166). Diesem Ansinnen widersetzten sich die Studenten und ergänzten die Liste der Kritikpunkte um die Starrheit des Curriculums und die zu geringe Anzahl an Dozenten, den Mangel an Kommunikation zwischen Professoren und Studierenden (vgl. ebd.) und das Fehlen einer demokratischen Entwicklung der akademischen Strukturen, die von der unhinterfragten Autorität der Professoren geprägt wurde. Über die akademische Realität in Italien am Ende der 1960er-Jahre schreibt Fred Halliday:
The Italian universities have a most authoritarian pedagogical tradition: professors teach courses from manuals they have themselves written, and both set and mark examinations themselves on these courses; this is clearly not a situation in which a critical approach to what the student is offered is advisable if he wishes to get good marks. (Halliday, 1969: 304)
1967 wurde zum ersten Jahr einer langen Periode von studentischer Mobilisierung (vgl. Flores/De Bernardi, 2003: 194). Die Studentenbewegung erlangte größere Ausdruckskraft, verstärkt durch die Protestinitiativen unterschiedlicher Spontangruppen, die an den Universitäten eine Vielzahl von Aktionen organisierten, welche lokalen wie internationalen Strömungen entsprachen.4 Nur um zwei Beispiele zu nennen: An der Universität von Trient war es die Debatte über den Vietnamkrieg, welche die Gemüter der Menschen befeuerte und die Revolte auslöste (vgl. Horn, 2007: 81). Dies führte zu den ersten Fakultätsbesetzungen und Streiks und verhinderte auch die fristgerechte und reguläre Eröffnung des akademischen Jahres 1967/1968.5 Und in Mailand fand das erste Sit-in im November 1967 in der Katholischen Universität statt. Dabei handelte es sich um eine Protestaktion, die gegen die Erhöhung der Studentengebühren organisiert wurde. Als die Anführer des Protestes exmatrikuliert wurden – unter ihnen der charismatische Führer der Studentenorganisation Movimento Studentesco (MS) [Studentenbewegung], Mario Capanna – brachte dies eine Welle der Solidarität unter den Studenten hervor.6 Ende 1967 und Anfang 1968 verbreiteten sich die Unruhen aus Trient und Mailand auf andere italienische Universitäten, wo unzählige Universitätsgebäude besetzt und Flugblätter verteilt wurden wie auch große Diskussionsveranstaltungen und Vorlesungs- und Prüfungsstreiks stattfanden.7
Am 1. März 1968 erfolgte jedoch eine Wendung der Studentenrevolte (vgl. Kurz/Tolomelli, 2008: 89): Die gewalttätigen Zusammenstöße von Studenten und Polizei vor den Toren der Architekturfakultät in Valle Giulia, in Rom, bedeuteten den Übergang zu den Straßenunruhen.8 Von diesem Tag an wurden Massendemonstrationen alltäglich und gewalttätig, die Städte wurden im Verlauf von 1968 zu großen Auditorien, in denen die Rufe nach einer radikalen Reform des Staates, nach Beendigung der Polizeirepression und gegen die konservative Presse lauter wurden.9 Die Annäherung von Studenten und Arbeitern wuchs ebenfalls ständig. Die Studenten solidarisierten sich mit der Arbeiterbewegung und verstärkten die Kampfesreihen des Proletariats bis 1970. Zum einen, dank der politischen und sozialen Bewusstwerdung, entschieden sich viele, »studenti-proletari« [Werkstudenten] zu werden, d.h. Studenten, die ihre Studien vor allem durch Fabrikarbeit finanzierten (vgl. Azzellini, 2008: 179). Zum anderen nahmen die jungen Menschen aktiv an den politischen Aktionen verschiedener Gruppen teil, die am Rande des Parlaments entstanden, und auch an den Streiks, die die Produktion in Unternehmen wie Pirelli oder Fiat während des Frühlings und des »autunno caldo« [heißen Herbsts] 1969 lahmlegten. So wird in Italien die Phase bezeichnet, in der die Arbeiterbewegung und der Kampf gegen den Autoritarismus auf allen Ebenen der Gesellschaft ihren Höhepunkt erreichten (vgl. Giachetti, 2012: 867).10
Schon vor der Phase des antiautoritären politischen Aktivismus des Jahres 1968 hatten die jungen Italiener in kultureller Hinsicht ihre Ablehnung gezeigt. Durch Rock’n’Roll und Anderssein – lange Haare, nachlässige Kleidung und Auszug von Zuhause (vgl. Casilio, 2013: 104f.) – markierte man in Italien die Entstehung einer Beatgeneration, mit Gruppen wie den »provos« [Provokateuren] und den »capelloni« [Langmähnigen], die die soziokulturelle Avantgarde am Ende der 1960er-Jahre bildete. Mithilfe eines Ausschnittes eines Flugblattes der Gruppe Provos stellen Marcello Flores und Alberto De Bernardi das neue Ethos der jungen Menschen in der Zeit der Gegenkultur dar:
Non siamo figli, né padri di nessuno […] siamo uomini che non vogliono credere in niente e a nessuno: senza dio, senza famiglia, senza patria, senza religione, senza legge, senza governo, senza stato, senza polizia […]. Ecco siamo dei bastardi. (zit. nach Flores/De Bernardi, 2003: 167)
[Wir sind weder die Kinder noch die Eltern von irgendjemandem […] wir sind Menschen, die an nichts und niemanden glauben wollen: ohne Gott, ohne Familie, ohne Heimat, ohne Religion, ohne Gesetz, ohne Regierung, ohne Staat, ohne Polizei […]. Das ist es, wir sind Bastarde.]
Es war diese junge Generation, die es in den Studentenversammlungen wagte, Themen wie Scheidung, voreheliche sexuelle Beziehungen, Pille und Abtreibung anzusprechen. Dies waren Themen, die die Gesellschaft provozierten und herausforderten – eine Gesellschaft, die zwischen Katholizismus und einem unumkehrbaren Modernisierungsprozess in einer stetig stärker industrialisierten und globaleren Welt stand.11
Der »Frühling« der italienischen Jugendrevolte war zweifelsohne einer der längsten und intensivsten im Rahmen der westeuropäischen Aufbruchsbewegungen. Der Kampf der jungen Generation gegen die Repression fing mit der antiautoritären Bewegung in den Universitäten an und setzte sich allmählich für den Wandel eines politischen Systems ein, das viele als ineffizient und wenig transparent betrachteten (vgl. Borgna, 2012: 113). Die Revolte war gleichzeitig durch die Solidarität mit der Arbeiterbewegung, durch ein Bewusstsein für die Probleme der sogenannten Dritten Welt und durch die öffentliche Debatte über die Gültigkeit der katholischen Werte gekennzeichnet, die die italienische Gesellschaft prägten. Zu diesem Widerspruch eines Italiens im wirtschaftlichen Aufschwung und dennoch im Stillstand, was die Demokratisierung ihrer Strukturen betrifft, schrieben Marcello Flores und Alberto De Bernardi: Die 1968er-Bewegung war »un esito imprevisto e traumatico di una frattura sempre più profonda tra giovani e società […]« (Flores/De Bernardi, 2003: 191) [ein unvorhergesehenes und traumatisches Ereignis eines ständig zunehmenden Bruches zwischen den jungen Menschen und der Gesellschaft […]].