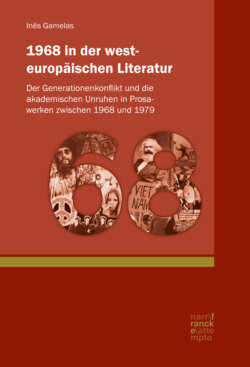Читать книгу 1968 in der westeuropäischen Literatur - Ines Gamelas - Страница 18
2.1.4 Liebe und Sexualität: die Revolution der Sitten
ОглавлениеDie kollektive Mobilisierung aus politischen Gründen ist entscheidend für das Bild der jungen Generation in Heißer Sommer und in Lenz, aber genauso relevant dafür ist die Rolle der sexuellen Revolution. Geleitet durch das Schlagwort »Das Private ist politisch!«, ließen sich die jungen Menschen aus dieser Zeit von der Liberalisierung der etablierten Sitten inspirieren (vgl. Kraushaar, 2000: 271). Und auch die jungen Figuren dieser zwei Werke der literarisierten Revolte sind bereit, das, was vorher privat war, öffentlich zu machen. Dabei lassen sie sich von dem Wunsch nach Bewusstseinsveränderung, nach einem bedingungslosen Ausleben von Liebesbeziehungen sowie nach dem kompromisslosen Ausdruck von Gefühlen leiten:
Die Bewegung von 1968 lässt sich […] als eine umfassende Kulturrevolte begreifen: Als Intellektuellenbewegung richtete sie sich allgemein gegen tradierte Formen des kulturellen Zusammenlebens und fokussierte sich [sic!] dabei sowohl politisch-ökonomische Ziele gegen Technisierung, Anonymisierung und Bürokratisierung als auch soziale hinsichtlich der Geschlechterrollenbeziehung und des Umgangs mit Sexualität und Sinnlichkeit. (Germer, 2012: 98f.)
Die bundesdeutsche Generation, die die 1968er-Bewegung erlebte, fand in hemmungslosem und provokativem sozialen Verhalten ihre Protestform und drückte im soziokulturellen Schock und in der Verbreitung der Alternativkultur ihre Unzufriedenheit mit dem konservativen und traditionellen Ethos ihrer Eltern aus. Als junge Menschen ihrer Zeit sind Ullrich und Lenz keine Ausnahme von der Regel. Die Veränderungen, die sich im soziokulturellen Bereich am Ende der 1960er-Jahre zeigen, sind auch für die individuellen Veränderungen der beiden bestimmend, und zwar sowohl auf der emotionalen wie auf der sexuellen Ebene.
Im Falle von Heißer Sommer werden die Liebesbeziehungen, die Ullrich im Verlauf des Romans hat, dargestellt. Von den längeren Beziehungen bis zu den kurzen Abenteuern tragen sie zur persönlichen Entwicklung des Protagonisten bei und verfolgen auch die allmähliche Entfernung der Studentengeneration vom soziokulturellen Status quo während der aufrührerischen Jahre der Revolte.
Zu Beginn der Handlung durchläuft Ullrich eine Krise, in der er sowohl über sein Studium als auch über sein Privatleben reflektiert. Dabei wird er von Zweifeln geplagt, die ihn über seine Beziehung zu Ingeborg nachdenken lassen. Mit dieser Studentin hatte er bis zum Sommer 1967 eine feste Beziehung. Im Laufe der Zeit ist der Protagonist mit der auf Treue und Verbindlichkeit gründenden Beziehung unzufrieden und verliert das Interesse – zwei Anzeichen, die als Symptome des Endes seiner Leidenschaft vorkommen. Der Drang, sich zu befreien, lässt Ullrich nach sexuellen Abenteuern suchen: Sowohl mit Gaby, einer Frau, die er eines Nachts in einer Bar kennenlernt, als auch mit anderen Frauen, zeigt er sich kühner und lässt sich von den momentanen Gefühlen mitreißen.1 Bewegt von dem Wunsch, sich zu amüsieren und neue unverbindliche Erfahrungen zu machen, scheint der Protagonist von Flirt zu Flirt mehr Vertrauen in den gewählten Weg zu bekommen – einen Weg, der von der Flucht vor der Routine der Traditionen und vor den guten Sitten, die ihn abstoßen und unterdrücken, geprägt ist.
Von den zufälligen Begegnungen, die im ersten Teil des Romans vorkommen, scheint Christa die einzige Ausnahme zu sein – eine Studentin aus der höheren Mittelschicht, die Ullrich am Ende des Sommers 1967 kennenlernt und mit der er die Entschiedenheit teilt, nach Hamburg umzuziehen: Dort will er sein Studium fortsetzen und sie die Ungewissheiten ihres Liebeslebens auflösen (vgl. HS: 98f.). Nach einem kurzen und angespannten Aufenthalt in Braunschweig, wo Ullrich mit seinem wenig verständnisvollen Vater über die Gründe seines Studienortswechsels diskutiert, versteckt Ullrich seinen Wunsch nicht, Christa in Hamburg weiter zu sehen und mit ihr zusammen zu sein, allerdings ohne Verpflichtung für beide Seiten.
In Hamburg wird Ullrich deutlich, dass das Lebensmodell der dortigen jungen Generation die Abwesenheit von Konventionen in den Liebesbeziehungen und der Wunsch, öffentlich die etablierten Sitten herauszufordern, zu sein scheint. Fasziniert von der offenen und kosmopolitischen Studentenatmosphäre dieser Stadt, lässt er sich von der Mode und von der alternativen Musik der Gegenkultur begeistern und kleidet sich wie ein junger Rebell der 1968er: Zum Klang der Rhythmen des Rock’n’Rolls trägt er Jeans, Parka und lange Haare, experimentiert mit den Drogen der Zeit und lebt die freie Liebe. Mehr noch: Je politisch aktiver Ullrich wird und je mehr sich sein Interesse für die vom SDS organisierten Protestaktionen verstärkt, desto ungehemmter wird er in Bezug auf Liebesbeziehungen, da Hemmungs- und Bindungslosigkeit der Schlüssel zum Erfolg bei den jungen Frauen zu sein scheinen. Zunächst in spontanen Begegnungen mit jungen Frauen in der Studentenkneipe Cosinus (vgl. HS: 142) und später nach dem Einzug in die Kommune mit Conny, Petersen und Erika gibt sich Ullrich dem sex, drugs & rock’n’roll hin und lernt die sexuelle Befreiung kennen.2 Im Zusammenleben von Männern und Frauen in gemischten WGs, in der freien Liebe ohne Tabus und in »Emanzipationsversuch[en; IG]« (ebd.: 155) wie Gruppensex, wollen Ullrich und sein Freundeskreis den herrschenden Sozialkodex von Liebesbeziehungen umstoßen. Sie machen aus ihren Erlebnissen Protestformen gegen das bürgerliche, traditionalistische und konservative Establishment ihrer Eltern.
Im dritten Teil des Romans markiert die Abkühlung des revolutionären Impetus des SDS bei Ullrich eine Phase wachsender Unzufriedenheit mit der Studentenbewegung. Diese zeigt sich nicht nur im politischen Bereich, sondern auch im Persönlichen, wo sein Einverständnis mit dem alternativen Lebensstil der roaring sixties allmählich abnimmt. Seine Erfahrung als Fabrikarbeiter und seine Entfernung vom Studentenmilieu geben ihm die Reife, über die flüchtigen und von ihm rein sexuell erlebten Beziehungen zu reflektieren sowie über die daraus entstehende Leere, die er empfindet (vgl. ebd.: 244). Außerdem schafft er es nicht, für das Leben ohne Verpflichtungen und Verantwortungen begeistert zu bleiben: Weder die Beziehung zu Renate – die Verfechterin der freien Liebe und der offenen Beziehungen (vgl. Weisz, 2009: 49) – noch das Zusammenleben mit Nottker und Christian in der neuen Wohngemeinschaft bringen ihm den früheren Enthusiasmus für den Lebensstil des peace & love. Ganz im Gegenteil: So wie er eine ausgewogene Haltung im Hinblick auf seine politischen Überzeugungen gefunden hat, scheint er auch emotional reifer geworden zu sein. Als am Ende des Romans sein Wunsch, nach München zurückzukehren und Lehrer zu werden, klarer wird, wird auch Ullrichs Entscheidung deutlich, sich von Renate und von seinen Freunden zu trennen (vgl. HS: 325). Dies bedeutet auch, sich von dem Hippieleben und dem Dogma der permissiven und emotionslosen Beziehungen zu entfernen.
Wie in Heißer Sommer kommen auch in Lenz durch die Liebesbeziehungen des Protagonisten unterschiedliche Züge der sexuellen Revolution vor. Dennoch, da die Handlung von Lenz in der Phase des Abflauens der 1968er-Unruhen spielt, gibt es weniger Zeichen der Begeisterung der jungen Generation beim Kampf gegen den Status quo. Anders als in Heißer Sommer tauchen kontroverse Themen wie die Abtreibung ebenso wie die Drogenerfahrungen in Lenz nicht auf. Und auch die Erlebnisse der freien Liebe scheinen einen geringeren Raum in dieser Erzählung einzunehmen (der Protagonist hat auch viel weniger Liebesbeziehungen als Ullrich Krause). Mehr als von den Zügen des sex, drugs & rock’n’roll wird Lenz von den Reflexionen des Protagonisten über seine Identitätskrise und den fehlenden Lebenssinn sowohl im Politischen als auch im Privaten geleitet.3
Seine Unsicherheit in politischer Hinsicht entsteht aus der Enttäuschung über die kollektiven Aktionen der Studentenbewegung. Der Grund für die Verunsicherung in emotionaler Hinsicht liegt aber vor allem im Scheitern der Beziehung mit L., einer jungen Frau mit der er zwei Jahre zusammen gelebt und von der er sich gerade getrennt hatte. Er ist unfähig, sich von der Obsession, die er noch für sie empfindet, zu befreien. Aufgrund dieser Obsession – die mehr von dem Zweifel erzeugt wird, ob er je wieder geliebt werden wird, als von der Trennung von L. (vgl. L: 25) – gerät Lenz immer mehr in eine depressive Verstimmung. Zum Teil sind der Freiheitswille und sein Wunsch, neue Erfahrungen zu machen, unvereinbar mit der von seiner ehemaligen Freundin eingeforderten Erfüllung ihrer Bedürfnisse nach Nähe und Liebe (vgl. ebd.: 56f.). Dieser Forderung kann Lenz nicht nachkommen, denn seine Erfahrung als intellektueller Aktivist und seine konsequente Politisierung im Verlauf der Studentenbewegung haben ihn seine emotionale Seite vernachlässigen lassen.4 Und nicht einmal die gelegentlichen und flüchtigen Beziehungen zu anderen Frauen befriedigen ihn in dieser ausweglosen Situation, die von dem Wunsch sowohl nach Unverbindlichkeit als auch nach liebevollen Beziehungen gekennzeichnet wird. Ein Beleg dafür ist Marina, mit der er sich sexuell einlässt. Sie ist an politischen Diskussionen und der Teilnahme an Aktionsgruppen interessiert und mit einer Beziehung ohne Zwänge und Ansprüche einverstanden. Wenige Tage später, nachdem Lenz Marina auf einem Fest gesehen hat, besucht er sie in ihrem Haus. Als sie anfängliche Zweifel überwunden hat, sich jemandem, den sie kaum kennt, hinzugeben, schlafen sie miteinander. Wie Lenz argumentiert: »Es gibt nur ein paar Arten, sich kennenzulernen, wenn man miteinander arbeitet, wenn man zusammen spinnt, wenn man sich anfaßt« (L: 12). Beim ersten Zusammentreffen wie bei den folgenden wird dennoch deutlich, wie unwohl sich Lenz in gefühlsarmen Beziehungen fühlt. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass die einzigen Momente, in denen er sich Marina nähert, diejenigen sind, in denen er sie zu seiner Vertrauten macht: Er öffnet sich ihr gegenüber, spricht von seinen Problemen mit L. und hört ihr zu, als sie von ihren Empfindungen und Wünschen erzählt.
Angetrieben von dem Willen, sein Liebesleben weiter zu entpolitisieren und eine Lösung für die Abwesenheit emotionaler Nähe zu denen, die um ihn sind, zu finden, beginnt Lenz, schon in Rom angekommen, ein Verhältnis mit Pierra. Die Spontaneität der Italienerin, ihre Fähigkeit, leicht mit allen in sozialen Kontakt zu treten und ohne Einschränkungen ihre Gefühle auszudrücken, faszinieren ihn. Dieses Verhalten und dieser Lebensstil waren ihm unbekannt.5 Trotz der Unvereinbarkeit zwischen dem nachdenklichen und introvertierten Lenz und dem impulsiven Charakter von Pierra kann er sich ihr gegenüber öffnen: Er spricht über seine vergangenen Erlebnisse, lernt, sich von der Angst, Gefühle zu äußern, zu befreien und findet in ihr eine »geschwisterliche Beziehung« (L: 86). Sie hilft ihm, seine Obsession zu L. zu überwinden und ein Gleichgewicht zwischen Denken und Fühlen, zwischen Rationalität und Emotionalität zu finden.
Die Zeit in Rom, in der er wichtige Fragen seiner Existenz verarbeiten konnte, ist entscheidend für den Fortgang im Leben des Protagonisten, der sich in emotionaler Hinsicht selbstsicherer fühlt. Dies wird besonders klar, als Lenz die Gelegenheit hat, sich in die Trientiner Studentenbewegung wieder zu integrieren. Dort lebt er täglich mit anderen Studenten zusammen, mit denen er nicht nur über Politik diskutiert, sondern auch Persönliches teilt in jener ersehnten Nähe, die er in den Betriebs- oder Freundesgruppen in Berlin nie erreicht hatte. Während dieser Monate versteckt er nicht seine Bewunderung für die Offenheit der italienischen Studenten, über verschiedene Angelegenheiten zu sprechen, seien sie politischer oder persönlicher Art. Nach der Zeit der Orientierungslosigkeit während der studentischen Unruhen in der Bundesrepublik scheint Lenz im Zusammenleben mit den jungen Italienern und deren Fähigkeit, den politischen Aktivismus mit dem Privatleben zu vereinen, den Schlüssel für sein emotionales Gleichgewicht gefunden zu haben. Diese Ausgeglichenheit gibt ihm bei seiner Rückkehr nach Berlin Vertrauen in sich selbst und lässt ihn mit gewissem Optimismus auf einen neuen Lebensabschnitt in der Bundesrepublik blicken.
Obwohl Heißer Sommer und Lenz in verschiedenen Phasen der Jugendproteste Ende der 1960er-Jahre ihren Schwerpunkt haben, zeigen beide in erster Linie die Probleme und Zweifel einer Generation, die sich zum Ziel setzte, mit den etablierten Werten und Sitten zu brechen. In Hamburg zeigen Ullrich und seine Freunde auf dem Gipfel der Studentenrevolte das intensive Erleben des sex, drugs & rock’n’roll und bringen dabei Themen wie die Abtreibung und das Experimentieren mit Drogen und mit der freien Liebe ins Spiel. Lenz ist introspektiver: Während er sich mit den Nachwirkungen dieser durch Exzesse geprägten Phase konfrontiert, versucht er, mit den persönlichen Auswirkungen der revolutionären Ideale umzugehen. Trotz dieser Unterschiede ist es wichtig festzuhalten, wie die Erfahrungen der sexuellen Revolution und des Wandels der Lebensweisen eine entscheidende Rolle spielen bei der individuellen Entwicklung und (Wieder-)Entdeckung der Identität jedes Protagonisten. Keiner von beiden lässt sich unkritisch von den Tendenzen der Gegenkultur oder vom sexuellen Befreiungsfieber als Phänomen der Emanzipation anstecken: Sowohl Ullrich als auch Lenz hinterfragen die Effekte der freien Liebe, besonders als sie das Flüchtige und die Gefühllosigkeit rein sexueller Beziehungen erkennen. Im Grunde ist es genau dieser Zugang zum Inneren der Protagonisten, zu ihren Wünschen, Beunruhigungen, Ängsten und Widersprüchen, der zu einem individualisierten Bild der von vielen Mitgliedern der jungen Generation erlebten Alternativkultur am Ende der 1960er-Jahre beiträgt.