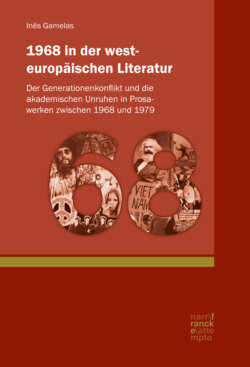Читать книгу 1968 in der westeuropäischen Literatur - Ines Gamelas - Страница 12
1.6 Portugal in den 1960er-Jahren: eine Bühne für Utopie
ОглавлениеÄhnlich wie Spanien erlebte Portugal während vier Dekaden eine lange Nacht der Diktatur und Unterdrückung. Der sogenannte Estado Novo [Neuer Staat] – die offizielle Bezeichnung des diktatorischen Regimes – wurde 1933 unter der Führung von António de Oliveira Salazar gegründet und orientierte sich an einer faschistischen, autoritären und repressiven Ideologie. Er durchdrang die portugiesische Gesellschaft der 1930er- und 1940er-Jahre, überlebte sowohl den Sturz der totalitären Regime von Hitler und Mussolini als auch die Auflösung der Kolonialreiche nach dem Zweiten Weltkrieg und hielt sich bis zur Nelkenrevolution am 25. April 1974. Während seiner langen Existenz gab es oft Opposition gegen die rückwärtsgewandte, unterdrückende und reaktionäre Politik des Regimes. Dabei waren es vor allem die PIDE (Geheimpolizei) und die Zensur, die unnachgiebig die Bevölkerung kontrollierten und die dunkle Seite des Salazarismus verewigten. Dennoch wurde die Diktatur niemals so sehr erschüttert durch Unruhen, Widerstand und den Willen zur Veränderung wie während der 1960er-Jahre: Dank einer Reihe nationaler und internationaler historischer Ereignisse erlebte Portugal in dieser Zeit wichtige soziokulturelle Erneuerungen.
Am Vorabend der 1960er-Jahre begannen verschiedene Maßnahmen Früchte zu tragen: die Eingliederung Portugals in die Europäische Freihandelszone (EFTA), die Wanderung vom Land in die Städte und die Industrialisierung. Darüber hinaus trugen ein bemerkenswerter wirtschaftlicher Entwicklungsschub, das Anwachsen der Mittelschicht und die Erhöhung des Wohlstandes zu einer zunehmenden Modernisierung der Lebensumstände der Portugiesen bei. Besonders bei den bürgerlichen Eliten in den Großstädten, die gebildeter und mit mehr Kaufkraft ausgestattet waren, zeigte sich diese Modernisierung sowohl in der Möglichkeit, touristische Reisen ins Ausland machen zu können, als auch in der Vergesellschaftung in Cafés und Restaurants. Beide zeigten das Verlangen der Portugiesen, sich dem entwickelteren Europa anzunähern, und die Verbürgerlichung der portugiesischen Gesellschaft, in der sich Nachahmungen von importierten Moden, der Wunsch nach als unsittlich betrachteten Lesetexten und Lust auf abweichende Konsumgüter fanden (vgl. Mónica, 1996: 221).1
Neben dieser allmählichen soziokulturellen Öffnung muss die wichtige Rolle der Medien für das Durchbrechen der Isolierung gegenüber der Wirklichkeit auf der anderen Seite der Pyrenäen hervorgehoben werden: Trotz der Einschränkungen durch die Zensur leisteten die britischen, amerikanischen und französischen Musiksendungen im Radio und die täglichen Sendungen der Rundfunkanstalt Portugals (RTP), die die modernen Tendenzen der Musik, der Mode, des Sports und sogar der Werbung übertrugen, einen entscheidenden Beitrag zu einer Liberalisierung der Verhaltensweisen.2
Die Avantgarde dieser Liberalisierung waren die jungen Menschen, die sich, indem sie eine alternative Sicht auf das Alltagsleben annahmen, der europäischen jungen Generation durch die Kultur des Rock, Twist und yéyé so weit wie möglich annäherten. Außerdem schlossen sie sich den Trends des langen Haarschnitts, der Jeans und der Miniröcke an.3 Bei den einkommensstärksten und intellektuelleren Familien war der Generationsbruch deutlicher, da viele junge Portugiesen die Einflüsse der Unterhaltungsindustrie überwiegend mit ihrer Universitätserziehung verbanden, um die Autorität der Eltern in Frage zu stellen. Dort begann auch das (in)direkte Bekämpfen des geschlossenen Regimes, das seinem offiziellen Motto »Deus, Pátria e Família« [Gott, Vaterland und Familie] und den entsprechenden Werten des Katholizismus, eines totalitären Staates und traditioneller, konservativer Erziehung treu blieb.
Die provozierende Haltung vieler junger Menschen zu den etablierten Familienwerten und die Weltoffenheit der oberen Mittelschicht führten auch zu einer vorsichtigen, eher symbolischen Emanzipationsbewegung. Diese wurde besonders von gebildeten Frauen befürwortet, die sich in der patriarchalischen Gesellschaft des Estado Novo eingesperrt fühlten. Trotz des tief verwurzelten Konservativismus wuchs in den 1960er-Jahren die Zahl der Arbeitsmöglichkeiten für Frauen (vgl. Vieira, 2000: 26). Ebenso wuchs die Zahl der aus der Oberschicht stammenden jungen Frauen, die die Universität besuchten. Diese jungen Frauen hatten zum ersten Mal die Chance, sich intellektuell zu bilden, freie Berufe in der Anwaltschaft oder in der Medizin auszuüben und sich so von der traditionell einschränkenden Rolle der Ehefrau, Mutter und Hausfrau, die von den Vertretern des Regimes bevorzugt wurde, zu befreien (vgl. Mónica, 1978: 275f.). Neben diesen Aspekten muss auch die Verfügbarkeit der Anti-Baby-Pille ab 1962 als ein Meilenstein der Portugiesinnen auf dem Weg der Emanzipation erwähnt werden. Dadurch konnten sie ihr Verhalten in Richtung sexueller Revolution und größerer Unabhängigkeit vom Ehemann weiter profilieren.4
Parallel zu diesen Veränderungen im soziokulturellen Bereich konnten auch in der Politik Neuerungsversuche beobachtet werden. Angetrieben von der zunehmenden Modernisierung des Landes und dem Willen, Portugal aus der Diktatur zu befreien, war es einmal mehr die junge Generation von Intellektuellen, angeführt von den Studenten der Universitäten in Lissabon, Porto und Coimbra, die den Widerstand vorantrieb. Sie deckte während der 1960er-Jahre auf, dass das akademische System auf eine rückständige Weise funktionierte (vgl. Caiado, 1990: 74), und stand gegen die Repression des Estado Novo auf. 1962 führte das staatliche Verbot, den Tag der Studenten zu begehen, zu unerwarteten Reaktionen und entfesselte eine Reihe von Protesten wie u.a. Vorlesungsstreiks und Demonstrationen, die die erste sogenannte »akademische Krise« auslösten. Sie war ein Meilenstein für den Ausbruch dieser Generation, indem sie den Rahmen für die politische Bewusstwerdung dieser jungen Menschen bildete, die in den folgenden Jahren zu einem der kämpferischsten Teile des Widerstands wurden (vgl. Rosas, 1994: 539). Drei Jahre später, als innerhalb der Studentenorganisationen eine Phase der zunehmenden Politisierung der Jungen begann, wiederholten sich die Proteste mit starker Intensität. Marta Benamor Duarte charakterisiert die Studentenproteste ab 1965 und den Studentenkampf für eine Erneuerung der portugiesischen Hochschulinstitutionen folgendermaßen:
As possibilidades de agitação visível para fora da faculdade estavam seriamente limitadas pela violência policial; lá dentro vivia-se numa instituição caduca e incompatível com o processo desenvolvimentista do país. Assim, havia que continuar a contestar, mas a contestar a própria universidade e o que ela representava na realidade – a perpetuação do fabrico de ideólogos de um regime autoritário, insensível às necessidades da população em geral. E contestar a universidade era indagar da validade do que se ensinava nas salas de aula e da legitimidade de quem ensinava. Nascia a contestação pedagógica e robustecia-se a crítica de fundo ao regime. (Benamor Duarte, 1996: 644)
[Die Möglichkeiten eines in der Öffentlichkeit sichtbaren Protestes waren durch die Polizeigewalt stark eingeschränkt; innerhalb der Fakultät lebte man in einer überalterten und insofern mit dem Entwicklungsprozess des Landes nicht mehr übereinstimmenden Institution. So musste weiterhin protestiert werden, und zwar protestiert gegen die Universität selbst und gegen das, was sie repräsentierte: die ewige Produktion von Ideologen eines autoritären Systems, unsensibel gegenüber den allgemeinen Bedürfnissen der Bevölkerung. Der Protest gegen die Universität umfasste das Überprüfen des Wahrheitsgehalts der Dinge, die in den Seminarräumen gelehrt wurden, und auch die Legitimation derjenigen, die lehrten, stand auf dem Prüfstand. Es kam zu pädagogischem Widerstand und die Kritik am Regime wurde stärker.]
1969 lernte jedoch das Regime, von Coimbra ausgehend, die größte »akademische Krise« kennen: Examensboykotte, Aussperrungen aus den Fakultäten und Massendemonstrationen richteten sich nicht nur gegen die elitären Strukturen der Hochschulen, sondern auch gegen die autoritäre Politik des Staats und den Kolonialkrieg (vgl. Caiado, 1990: 194).5
Der Kampf gegen den Kolonialkrieg spaltete die portugiesische Gesellschaft während der Diktatur und war immer ein drängendes Anliegen der Studentenbewegung und der »akademischen Krisen« der 1960er-Jahre (vgl. ebd.: 132). Viele Mitglieder der intellektuellen und gebildeten jungen Generation empörten sich über die militärischen Anstrengungen, die in ihren Augen typisch für die Imperialisten und Kolonialvertreter waren.6 Sie sollten sich für eine hoffnungslose Ideologie verpflichtend einsetzen. Aus diesem Grund setzten sich viele junge Menschen für ein Ende dieses Krieges ein, der tausende Opfer kostete, und kritisierten die Unnachgiebigkeit des Diktators, der das koloniale Imperium unbedingt beibehalten wollte (vgl. Vieira, 2000: 24). Trotz der Strafmaßnahmen des Regimes wie Gefängnis, Folter, Exil oder Zwangsverpflichtung bei den überseeischen Kampfeinheiten waren diese Jungen entschlossen, die Gesellschaft zu liberalisieren. So schufen sie einen unüberwindlichen Abgrund zwischen sich und dem Salazarismus.7
Obwohl das Regime gegenüber Veränderungen feindselig und hartnäckig war, konnte es die zunehmende Neigung zur Öffnung, Freiheit und Emanzipation keineswegs aufhalten.8 Ermutigt durch den ökonomischen Fortschritt, die demographische Mobilität, die signifikanten Änderungen der Familienverhältnisse und die politischen Aktionen der jungen Generation gewinnt Portugal neue Hoffnung auf einen ersehnten Wandel. Ende der 1960er-Jahre nahm sie noch zu durch besondere politische Ereignisse.
Im Jahre 1968 bekam Portugal die Nachricht, dass – aufgrund einer schweren Erkrankung des Diktators – Salazar durch Marcelo Caetano als Oberster Führer der Nation ersetzt wurde. Caetano war vom ultrakonservativen Flügel weiter entfernt und gab Anlass zur Hoffnung auf eine gewisse Entspannung des Estado Novo, auf weitere Öffnung und Liberalisierung (vgl. Reis, 1996: 546).9 Mit einem neuen Mann an der Macht glaubten viele an einen bevorstehenden Sturz der portugiesischen Diktatur. Sie erwarteten das Ende der Isolierung und der Rückständigkeit Portugals:
No início da década de 60, só se falava em desenvolvimento, desenvolvimento e desenvolvimento. Os economistas defendiam que o país tinha de se abrir à Europa. […] Portugal iria modificar-se profundamente [ao longo da década; IG]. Alimentado pelas notícias que os emigrantes traziam lá de fora, estimulado pelas séries que a RTP começara a importar, invadido por turistas com hábitos estranhos, o país saía, por fim, da letargia. Quando, em 1968, Salazar caiu da cadeira, os valores que tentara inculcar aos Portugueses estavam moribundos. (Mónica, 1996: 224)
[Am Anfang der 1960er-Jahre wurde nur von Entwicklung gesprochen, Entwicklung und nochmals Entwicklung. Die Wirtschaftler traten für eine europäische Öffnung des Landes ein. […] Portugal sollte sich [während der gesamten Dekade; IG] grundlegend verändern. Durch die Nachrichten, die die Emigranten vom Ausland mitbrachten, angeregt von den von der RTP importierten Serien, geflutet von Touristen mit fremden Sitten, befreite sich das Land endlich aus seiner Lethargie. Als Salazar 1968 stürzte, waren die Werte, die er den Portugiesen einschärfen wollte, dabei abzusterben.]
Während einiger Monate im Jahr 1968 hofften viele in Portugal auf eine Transformation des Regimes.10 Jedoch dauerte es nicht lange, bis der Glaube der Portugiesen an Caetanos Reformwillen verblasste und sie einsahen, dass die Liberalisierungsversprechen sich in seinem Motto »evolução na continuidade« (zit. nach Rosas, 1994: 548) [Evolution in der Kontinuität] verflüchtigen würden. Von 1969 bis 1974 verhärtete sich das Regime gegenüber den Gegnern der Diktatur: Caetano antwortete mit mehr Gefängnis, Exilierungen und Zensur auf den Widerstand der Studenten und auf die Umsturzversuche der oppositionellen Gruppen oder der Militärs. Erst die Nelkenrevolution am 25. April 1974 ließ Portugal aus der langen Nacht der Diktatur aufwachen, in der es bis dahin gefangen war.